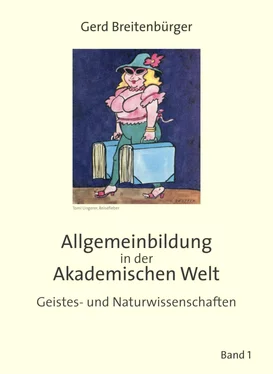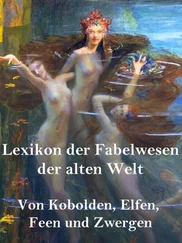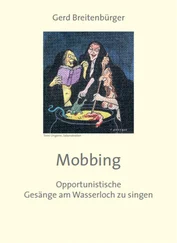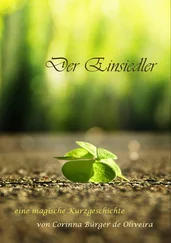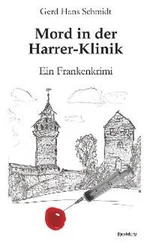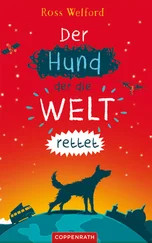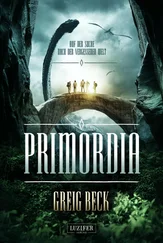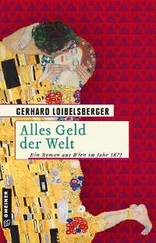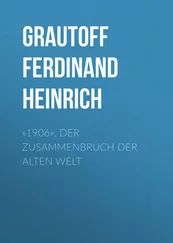Bildung scheint also sehr viel mit Werten und Beurteilungen zu tun zu haben, weniger mit dem Kanon möglicher Lektüre. Aber ein persönlich gestalteter Fundus darf es schon sein. Sonst gäbe es einen literarischen Grenzwert. Wer Faust, II. Teil bis zur Hälfte gelesen hat, na ja, hat er einen befriedigenden Prozentsatz an einer Vollbildung erworben oder steht er kurz davor? Gesagt werden soll ganz schlicht, Bildung ist anders, nämlich holistisch, ganzheitlich. Wer eine Zeichnung von Goya gesehen hat, weiß sehr viel über seine Kunst und vor allem, was der Mensch so kann.
Je enger soziale Lebensbedingungen zu werden scheinen, umso kostbarer ist eine persönliche Einstellung, die es erlaubt, das scheinbar Nutzlose und häufig auch kostenlos zu Erwerbende hoch zu halten. Zur Bildung gehört, dass man durchprobiert, ob etwas ernst zu nehmen verdient oder nicht. Ironie und satirische Einstellung helfen zum Polish up des leicht Korrodierten, den Rost von der Bildung schmirgeln. Goethes "Hermann und Dorothea", wenn es denn Vergnügen macht, enthält nur zwei Verse zur französischen Revolution, die gerade weit weg von der Landesgrenze stattfand und Goethe anscheinend nicht weiter aufregte. Das wirkt verstaubt und sagt außerordentlich viel über eine Zeit und manchen Autor, die uns zu einer distanzierten Stellungnahme herausfordern. Bildung ist auch ein herausfordernder Prozess, ist riskant, egal, ob vom Zufall gesteuert oder von einer gesellschaftlichen Meinung getragen. Kultur als Risiko, das muss auch so erlebt werden können.
Das Emotionale hat überraschenderweise fast gar keine Halbwertzeit. Der Zorn des Achilles in Homers Ilias und der des engagierten Zeichners und Utopisten Tomi Ungerer sind für uns in gleicher Weise verständlich. Die Liebe der Königin Dido und die Liebe der Callas, die sich beide verbrennen, wir verstehen sie auch in ihrer Outriertheit (äußersten Form). Es gibt für uns Zeitlosigkeiten wie auch für den Anthropologen, der noch weiter, 40 000 Jahre zurück, zum Cromagnon-Menschen geht, schließlich sogar in die biologische Anthropologie, um festzustellen: Bei allem Wandel verlässt sich der Mensch auf Gleichbleibendes. Auch die lebendigen, wandelbaren Gefühle brauchen Spurtreue, Sicherheit. In ihnen steckt Kreativität, aber ausufernd dürfen sie nicht sein. Das Phantasievolle ist unzuverlässig, umspielt und benutzt als sichere Basis das, was wir intuitiv über Jahrtausende immer wieder finden. Anderes können wir gar nicht denken. Nur so ist es möglich, alte Zeiten und Kulturen, entschlüsselte Texte zu verstehen.
Selbst wem es gelingt, seine 1,6 Liter Hirn rot, grün schwarz oder gelb zu tunken, das heißt, wie Ziegenleder durchzufärben, er braucht stabile Verhältnisse und die Basis ewiger Gefühle. Auch dieses hier: Bildung, das ist der Mensch, der von sich selbst auf akzeptable Weise fasziniert ist, wenn er im Spiegel einen Kosmos erblickt. Er braucht es allerdings nicht immer mitzuteilen, denn was er sieht, sehen die anderen schon lange. Bildung ist ein sozial verbindendes Medium, das nicht funktionieren würde, wenn nicht ein erheblicher Genuss für den abfällt, der sich um sie bemüht.
Hier, im vorliegenden Text, soll versucht werden, beide Bildungswelten, ohne die Dinge zu quälen, in eine fruchtbare Beziehung zu setzen. Natürlich also ohne irgendeine Vorstellung, was Vollständigkeit dabei auf einer abstrakten Ebene vielleicht erbringen könnte.
Analogien, Vergleiche, die im vorliegenden Text verwendet werden, das sei am Rande vermerkt, sind keine Argumente für Abhängigkeiten oder sogar Kausalitäten. Sie haben eher die Funktion, deutlich zu machen, was sonst "im Raume stehen bliebe" und schwer zu merken wäre. Es kann das Bild einer "Kette des Seins" entstehen, die so in der realen Welt aber nicht erkennbar ist. Der antike Gedanke (Platon), dass vom Sandkorn bis zum Kosmos eine durchgehende scala naturae , eine Treppe der Natur geht, hat die Forschung fasziniert und beunruhigt. Dass Neues entsteht und den Gedanken der Verkettung sprengt, hat dem Begriff „Evolution“ einen Sinn gegeben, der gerade dies ausdrücken soll. Neues widerspricht der "Kette". Assoziationen, Analogien und andere Verfahren des Geistes stellen sie bisweilen wieder her, allerdings nur im Geist und bisweilen mit dem Schwung des Mutwilligen. Selten wird man wohl eine besondere Methode der Welterfassung im Sinne der Metaphorologie finden, eine tragfähige Verkettung auf der Sinnebene durch Metaphern, die Prinzipielles nachweist. Es handelt sich um einen Topos, einen vom Geist verhätschelten Gedanken, dem ein stroboskopartiges, blitzzuckendes Denken ein Gräuel ist:
Was das Elementar- und Higgsteilchen in der Physik ist, ist das Pigment der Druckerschwärze für den Text. Was die Antimaterie für die Materie ist, ist die Materie für den Geist. Was die Evolution für die Natur ist, sind die Phantasie und die Poesie für die Kultur. Der Geist glaubt leicht an die erhellende Funktion seiner Analogien, denen er sogar im Voodoo-Zauber eine wirkungsvolle Potenz zuschreibt. Dem Naturwissenschaftler dienen sie zu Erhellung wie dem Kunstwissenschaftler, dem sie als Ordnungsprinzip dienen können. Ein reines Formprinzip, Analogie, kann erhellend sein. Alle roten Gegenstände in diesen Karton. Es scheint, so könnte man die Erkenntistheorie interpretieren, so zu sein, dass bei einem ersten Schritt, Ordnung zu wollen, die vieles umgreift, die unspezifische Analogie mehr ist als gar nichts. Dass die Druckerschwärze eine causa materialis , ein materieller Grund für den Text sein soll, so der Text für den Inhalt, muss ihn nicht interessieren. Die ersten Texte wurden sowieso mündlich vorgetragen und verstanden. Der Naturwissenschaftler setzt bei dem an, was jeweils als Ursache bezeichnen werden könnte. Damit hat er den Einstieg in die Kausalkette, die ihn beschäftigt. Als Monist darf er das nicht nur, es ist viel schöner, er muss! Die Frage ist, ob das gut so ist, ob alle Wissenschaftler mit ihm einig sind. Und ob Analogien der Erkenntnis und wenn ja, etwas hinzufügen.
Die Frage ist ein Dauerbrenner, seit im 19. Jahrhundert der Positivismus seine Konturen geschärft hat. Weiter unten wird immer wieder implizit und auch explizit darauf eingegangen, wenn über den Wunschtraum "Weltformel" berichtet wird. Die "Universalerkenntnis des Menschen" ist eine Frage nach der Abstraktionsstufe, wie wir sahen, und was uns dort beschert wird. Die Formel ist eine sehr hohe und den Forscher meist befriedigende Abstraktion, in der die Einzelheiten enthalten aber unsichtbar bleiben. Alle Insektenarten (750 000) zu kennen, lenkt ab von der Universalerkenntnis. Es ist sinnvoll, in die Ordnungen und Klassen zu gehen und die Modelle zu kennen, alles andere lenkt intellektuell und zeitökonomisch vom generellen Überblick ab. Daher muss man herausfinden, wann und wo es erwünscht ist, und bis zu welcher Tiefe, ins Detail zu gehen und wo die handliche Formel, "Klassik = Werte, die überdauern" – "Edelmetalle = Metalle, die sich nicht verändern" – völlig ausreichend sind.
Die eine oder andere Variante, sich Wissen als Basis von Bildung zu erschließen, richtet sich nach der Zielsetzung. Mehrere Fachgebiete zu berücksichtigen bringt außerdem die Gefahr mit sich, fehlerhafte Angaben zu machen (nicht überprüftes Lexikonwissen). Fehler kann man korrigieren, wie es immer beruhigend heißt, was bei einem Pilzbuch schlecht geht, wenn die erste 6-köpfige Familie schon im Koma liegt ("Pilz 'Teufelsbrut' ist genießbar aber nicht bekömmlich!"). Aber, wie immer , errare humanum est ( Irren ist menschlich) woraus man auch lernen kann. Aus dem Fehler natürlich und auch daraus, warum man ihn macht, mit welcher Frequenz, bis man es begriffen hat. Die Struktur, die die Fehleranalyse offenbart, ist dann häufig eine psychologische Aussage, bei der wir dichter am Menschen sind als an seinen Stoffen. Es gibt Ermüdungserscheinungen bei Materialien eines Flugzeugs und es gibt den Menschen, der Schwierigkeiten hat, drei oder vier Variablen gleichzeitig zu regeln. Ab dieser Komplexität haben selbst Atomkraftwerke kaum die Chance, nicht zu explodieren, wenn der Mensch sie per Hand steuern will. Er entfernt sich von einer überschaubaren Linearität. Da ist viel einer Kette und da ist viel Irrtum zu glauben, es ginge nicht auch ohne dieses Konzept einer "Kette". In dieser Welt der Kausalität wird nicht gezaubert. Es ist der Mensch, der schon mal den Überblick verliert über die Möglichkeiten der Folgen. Dafür ist die Psychologie zuständig, die prompt mit einem schillernden Begriff aushilft: Was nicht kausal ist, ist eben multikausal. Wenn das nicht reicht, nehmen wir das Ganze reziprok und reflexiv.
Читать дальше