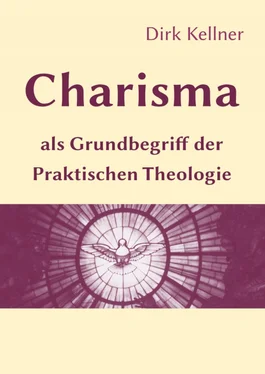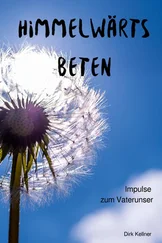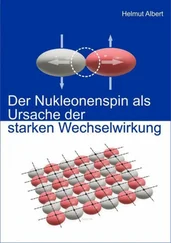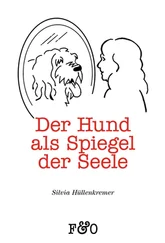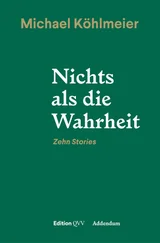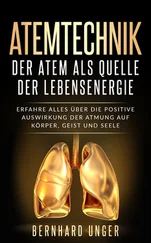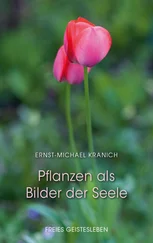1 ...6 7 8 10 11 12 ...38 «Wo sind denn die Gaben, mit und in welchen der Heil. Geist jetzt noch fortwirkt, und als ewig wirkend sich zu erkennen gibt? Wenn die Gaben doch irgendwo wären, so müßten sie sich bemerklich machen; aber man weiß nirgends von solchen, wenn auch viel Edles da und dort zu finden ist.»[183]
Erst in einer von Blumhardt in unmittelbarer Nähe erwarteten dritten Heilszeit werde es zu einer erneuten Ausgießung des Geistes bzw. – wie Blumhardt später präzisiert – zu einer Fortsetzung der sich schon in der Apostelzeit wiederholenden Ausgießungen des Geistes kommen und damit zugleich zu einer neuen Wirksamkeit der geistlichen Gaben.[184] Blumhardt zeigt sich in diesen Anschauungen einerseits abhängig vom traditionellen Verständnis der Charismen als wunderhafte und nunmehr vergangene Größen.[185] Andererseits aber überlässt er sie nicht der Vergangenheit einer vermeintlich einzigartigen Urzeit, sondern gewinnt sie neu für die Zukunft der Kirche. Die Charismen sind Gegenstand der Verheißung Gottes und Bestandteil der sehnsuchtsvollen Erwartung, mit der sich die Kirche auf eine geistliche Erneuerung ausrichtet.
Die umfassendste Darlegung seines Charismenverständnisses bietet Blumhardt in der Abhandlung «von den geistlichen Gaben», veröffentlicht in den «Blättern aus Bad Boll» (Nr.37/1876). Er ermahnt die Glaubenden, in Geduld und Demut auf eine erneute Ausgießung des Geistes mit einer umfassenden Austeilung der geistlichen Gaben zu warten.[186] Er warnt ausdrücklich davor, sie für sich selbst als «etwas Habituelles und Bleibendes» zu erstreben, «statt demüthig um ein Durchkommen im einzelnen Fall, mit stets wiederholten Hilfsleistungen von oben» zu bitten.[187] In einem eigenmächtigen Streben nach dem Besitz von geistlichen Gaben sieht Blumhardt einen ungeistlichen Unabhängigkeitsdrang, mit dem sich der Mensch von Gott lösen, und einen Geltungsdrang, mit dem er sich über den Nächsten erheben will.
«Denn es sieht sich an, als ob man sich ’ s nur bequemer machen wollte, um nicht immer wieder den Heiland bitten zu müssen, wenn man ’ s vermöge der innwohnenden Gaben von selbst, und dann gewissermaßen sicher machen könnte. Warten wir, bis es dem Herrn gefällt, im Ganzen und Großen die Kräfte des Heiligen Geistes auszugießen; und daß diese Zeit beschleunigt werde, dürfen wir immerhin bitten […]. Soll Er etwas geben, so muß Er es von sich aus thun. Um dieses aber kann und darf ich nicht bitten, ohne vor Ihm und Andern anmaßend zu erscheinen, weil ein Gelüste darin liegt, darum hoch angesehen zu werden vor den Menschen.»[188]
Von den in Demut zu erwartenden «eigentlichen ächten geistlichen Gaben» unterscheidet Blumhardt die «natürlichen Gaben». Sie sind «angeboren, im eigenen Geiste des Menschen wurzelnd», können aber «durch Nachdenken, Studium, Fleiß, Uebung, Ausdauer […] sehr gesteigert werden».[189] Weil sie aber «nie als unmittelbar von oben gegeben» erscheinen, unterliegen sie der Gefahr des Irrtums und sind «um so gefährlicher, weil sie gerne mit einer gewissen Macht auftreten, und überwältigend für kleinere Geister werden»[190]. Trotz dieser Warnungen schreibt Blumhardt den natürlichen Gaben in einer Morgenandacht zu 1Petr 4,10 eine hohe Bedeutung für den Aufbau der Gemeinde zu:[191] Im Vergleich zu den Gaben der Apostelzeit sind die heutigen zwar «nicht mehr dieselben», aber dennoch «ist ihrer Vielen Vieles gegeben». Durch den gegenseitigen Dienst, «durch Belehren, durch Ermahnen und Warnen, durch Besuche, durch tröstliche Aufrichtung, durch Hilfeleistungen mit Rath und That»[192], soll nicht nur der Gesamtheit der Glaubenden geholfen werden, vielmehr «hängt das Leben der Gemeinden, ja der ganzen Kirche [daran], dass man viel nach allen Richtungen einander dienen lerne».[193] Die gegenwärtige kirchliche Wirklichkeit sieht Blumhardt allerdings auch bei der Praktizierung der natürlichen Gaben in einem Widerspruch zur biblischen Weisung. Die Mehrheit der Gläubigen «lassen Alles liegen und überlassen Alles nur dem Amt»[194]. Dadurch liege nicht nur «die geistliche Pflege der Einzelnen durch Einzelne […] ganz darnieder»[195], auch das Amt könne nicht viel ausrichten, wenn ihm die Gaben der Gemeinde nicht dienend zur Seite stehen. So bleibt Blumhardt auch im Blick auf die natürlichen Gaben nur die sehnsüchtig bittende Hoffnung auf ein Wirken des heiligen Geistes: «Hoffen wir auf solche Gnadenzeit, welche die Christen auch wieder regsamer für einander machte!»[196]
Blumhardt ist einer der ersten Theologen, der den Mangel an Charismen als Anzeichen einer geistlichen Armut der Kirche versteht und sich durch die biblische Verheißung zu einer erneuerten «Erwartung des Geistes und seiner Gaben und Kräfte»[197] führen lässt. So problematisch die geschichtstheologische These vom Verschwinden des Geistes und die skeptische Geringschätzung der vorhanden Charismen ist, so bedeutsam ist doch die Wiedergewinnung des promissionalen Charakters der Charismen und ihrer Bedeutung für eine geistliche Erneuerung der Kirche. Mit diesen Ansichten ist Blumhardt seiner Zeit weit voraus und findet bei seinen Zeitgenossen nur wenig Verständnis – am wenigsten bei seinen Amtskollegen und den Theologen.
2.2.4 Rudolph Sohm und Max Weber: Charisma als anti-institutionelles Prinzip und außergewöhnliche personale Qualität
Der Charismabegriff erfuhr ein eigentümliches Schicksal. Nachdem er viele Jahrhunderte von der Theologie kaum beachtet und erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts allmählich wieder in seiner Bedeutung erkannt wurde, kam es bereits am Ende jenes Jahrhunderts zu einer soziologischen Rezeption durch Max Weber, die ihm über die Grenzen der Wissenschaften hinaus eine weite Bekanntheit bescherte. Mit dieser Entwicklung ging ein Bedeutungswandel einher: Die überkommene Bindung an das Amt schlug ins Gegenteil um, der Aspekt des Wunderhaften und die Tendenz zu einem habituellen Verständnis wurden wiederaufgenommen und modifiziert fortgeschrieben: «Charisma» gilt als eine außergewöhnliche Qualität des Individuums und als prinzipiell anti-institutionelle bzw. anti-amtliche Größe. Diese Akzentuierung ist von Rudolph Sohm beeinflusst, dessen Thesen einer rein charismatischen Organisation der Urchristenheit weite Verbreitung erfuhren, heftige Diskussionen auslösten und dadurch der Charismenlehre erhöhte Beachtung verschafften. Die besondere Prägung des Charismabegriffs durch Sohm und Weber beeinflusst bis heute den allgemeinen Sprachgebrauch und konnte nicht ohne Einfluss auf das theologische Denken bleiben. Eine kurze Skizze des Sohm’schen und Weber’schen Charismakonzeptes ist daher im Rahmen der gegenwärtigen Untersuchung notwendig, um bis in die Gegenwart nachweisbare Verengungen und einseitige Akzentuierungen im theologischen Charismenverständnis zu verstehen und ihnen kritisch begegnen zu können.
2.2.4.1 Rudolph Sohms Charismabegriff, seine Rezeption und Umprägung durch Max Weber
Max Weber führte mit «Charisma» einen Begriff in die Soziologie ein, der zuvor nur in der innertheologischen Diskussion gebräuchlich war: «Der Begriff ‹Charisma› (‹Gnadengabe›) ist altchristlicher Terminologie entnommen […]. Er ist also nichts Neues.»[198] Als Quelle gibt Weber u.a. die theologischen Arbeiten des Rechtshistorikers Rudolph Sohm an.[199] Es sei sein Verdienst, «für einen geschichtlich wichtigen Spezialfall […] die soziologische Eigenart dieser Kategorie von Gewaltstruktur gedanklich konsequent […] herausgearbeitet zu haben»[200]. Tatsächlich nimmt die paulinische Charismenlehre eine zentrale argumentative Funktion in Sohms historischer Rekonstruktion der urchristlichen Organisation und ihrer späteren Deformation ein. Die Geschichte der Kirche stellt sich ihm als die Geschichte ihres Abfalls vom eigentlichen Wesen dar.[201] Durch rechtlich-amtliche Reglementierungen sei die essentielle pneumatisch-charismatische Dimension zunehmend überdeckt und verdrängt worden.
Читать дальше