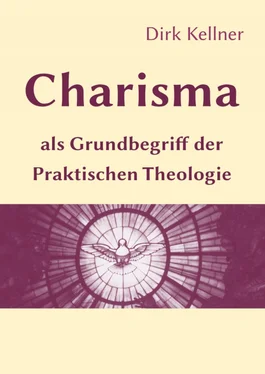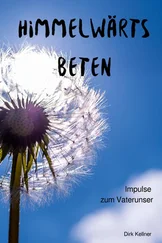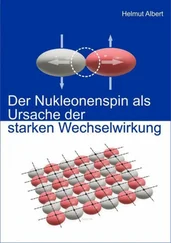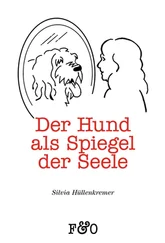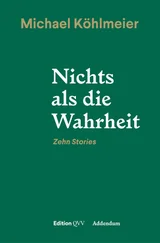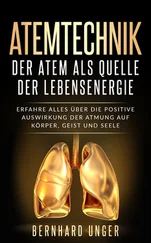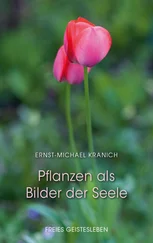2.2.1 Friedrich D. E. Schleiermacher: Evangelische Gemeinde als Prozess gegenseitiger Begabung
Der junge Schleiermacher wurde in seinen Gedanken zur Erneuerung der Kirche entscheidend vom Beispiel der Herrnhuter Brüdergemeine und ihren praktischen Ansätzen zur Wiedergewinnung der charismatischen Vielfalt geprägt. Seine berühmte Rede «Über das Gesellige in der Religion oder über Kirche und Priestertum» kann als eigentümliche Reformulierung der paulinischen Charismenlehre gelesen werden – auch wenn Schleiermacher wie sonst in seinen «Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern» biblische Begrifflichkeiten meidet und sich weder der Begriff «Charisma» noch ein entsprechendes Äquivalent («Gabe», «Geistesgabe» oder «Gnadengabe») finden lässt. Schleiermacher versteht die «wahre Kirche» als eine Gemeinschaft religiös affizierter Menschen, die auf «gegenseitige[r] Mitteilung» beruht und in der der Gegensatz zwischen Priestern und Laien überwunden ist.[158] Jeder ist Priester und bringt das «Feld» des Religiösen zur Darstellung, «welches er sich besonders zugeeignet hat, und wo er sich als Virtuose darstellen kann».[159] Jeder ist aber auch Laie, «indem er der Kunst und Weisung eines anderen dahin folgt, wo er selbst Fremder in der Religion ist»[160]. Die wahre Kirche ist eine «vollkommene Republik» ohne «tyrannische Aristokratie»[161], eine «Akademie von Priestern», in der jeder Einzelne «die reifsten Früchte seines Sinnes und Schauens, seines Ergreifens und Fühlens mit fröhlichem Herzen herbeibringt», je nachdem wie die «Religion […] aus ihrem unendlichen Reichtum […] einem jeden ein eigenes Los» erteilt hat.[162]
Das Bild, das Schleiermacher, «von dem reichen, schwelgerischen Leben in dieser Stadt Gottes» zeichnet, nimmt sprachliche Anleihen und inhaltliche Impulse sowohl aus den paulinischen Anweisungen zur gottesdienstlichen Feier in 1Kor 14,26–33a, als auch aus der Charismenliste von 1Kor 12,8–10 auf.
«Wenn ihre Bürger zusammenkommen, [ist] jeder voll einer Kraft, welche ausströmen will ins Freie, und voll heiliger Begierde, alles aufzufassen und sich anzueignen, was die anderen darbieten mögen. Wenn einer hervortritt vor den übrigen, ist es nicht ein Amt oder eine Verabredung, die ihn berechtigt […]: es ist freie Regung des Geistes […]. Er tritt hervor, um seine eigne Anschauung hinzustellen, als Objekt für die übrigen […]; er spricht das Universum aus, und im heiligen Schweigen folgt die Gemeinde seiner begeisterten Rede. Es sei nun, daß er ein verborgenes Wunder enthülle, oder in weissagender Zuversicht die Zukunft an die Gegenwart knüpfe; es sei, daß er durch neue Beispiele alte Wahrnehmungen befestige oder daß seine feurige Phantasie in erhabenen Visionen ihn in andere Teile der Welt und eine andre Ordnung der Dinge entzücke.»[163]
Schleiermachers Relecture von 1Kor 12–14 stellt trotz einzelner fragwürdiger Implikationen[164] einen bemerkenswerten Versuch dar, die paulinische Charismenlehre aus ihrem mirakulösem Missverständnis zu befreien und ihr eine gegenwärtige Relevanz zuzuschreiben. Er verbindet zentrale Aspekte zu einem Bild von Gemeinde, das den Gegensatz von Priestern und Laien überwindet und «evangelische Gemeinde als Prozeß einer gegenseitiger Begabung»[165] versteht. Im Gegensatz zu seinen späteren Schriften hält er in den Reden von 1799 diese Art religiöser Kommunikation allerdings nur im Rahmen kleiner religiöser Hausgemeinschaften für realisierbar, während für die Amtskirche der Gegensatz von Priester und Laien notwendig ist[166] und die Mehrheit der Gemeindeglieder aufgrund ihrer fehlenden religiösen Ergriffenheit «völlig passiv» bleiben muss.[167]
2.2.2 Johann Hinrich Wichern: Die christliche Gemeinde als Entwicklungsschule der Charismen
Die Bedeutung der «Inneren Mission» für den sich allmählich abzeichnenden theologischen Bewusstseinswandel kann kaum überschätzt werden. Das hohe Laienengagement und seine theologische Legitimation u.a. durch Johann Hinrich Wichern befreiten die Charismen mehr und mehr vom Schleier des Historischen und bereiteten den Weg für die Wiederentdeckung ihrer gegenwärtigen Bedeutung. Wer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts über die Charismen reflektierte, musste früher oder später auf die Innere Mission zu sprechen kommen.[168]
Johann Hinrich Wicherns Reformprogramm nimmt seinen Ausgangspunkt beim reformatorischen Prinzip des allgemeinen Priestertums.[169] Es geht ihm immer wieder um den «Beruf der Nichtgeistlichen für die Arbeiten im Reiche Gottes und den Bau der Gemeinde»[170]. Zu seiner theologischen Begründung bezieht sich Wichern nicht konsequent, aber ausführlicher als Philipp J. Spener auf die Charismenlehre. Wichern entwickelt zwar keine eingehende theologische Theorie über die Charismen,[171] doch ihre praktische Freisetzung ist ein zentrales Motiv seiner neuen Vision von Gemeinde und Gesellschaft.[172] In den bekannten zwölf Thesen zum «Beruf der Nichtgeistlichen für die Arbeit im Reiche Gottes und den Bau der Gemeinde» (vorgelegt zum Kirchentag 1867) schreibt Wichern:
«Es kommt darauf an, […] die in der Gemeinde vorhandenen und bis dahin noch vielfach gebundenen Charismen zu erwecken, zu entwickeln und zu verwerten […]. Die Gemeinde selbst mit ihren amtlich geordneten und ihren freien Institutionen […] muß die praktische Erziehungs- und Entwicklungsschule für die geweckten Charismen der Nicht-Geistlichen werden.»[173]
In der darauf folgenden, frei gehaltenen und nur in Nachschrift erhaltenen Rede ermahnt er die Zuhörer, es nicht einem badischen Pfarrer gleich zu tun, der einer engagierten Christin verbat, sich um arme Waisenkinder zu kümmern. Wer so handelt «werde […] nirgends Charismen entdecken»[174]. Vielmehr gilt: «Charismen sollen nicht getötet, sondern erweckt werden.»[175] Wichern ist überzeugt: Wer in der Gemeinde wahrhaft Seelsorge übt, Gottes Wort als lebendiger Zeuge verkündigt und «stille und treu sucht», der wird «die freudige Entdeckung machen, daß ein, ja welch’ ein Reichtum von Gaben in einer solchen Gemeinde aus der Verborgenheit erwacht»[176].
2.2.3 Johann Christoph Blumhardt: Die Verheißung des Geistes und seiner Gaben
Johann Christoph Blumhardt geht nicht wie Schleiermacher vom idealistisch geschauten Reichtum der wahren Kirche, sondern vom real erfahrenen Mangel der sichtbaren Kirche aus. Sein Verständnis der Charismen ist aufs Engste mit der Klage über die geistliche Armut der Kirche und mit der für ihn eigentümlichen sehnsüchtigen Erwartung einer erneuten Ausgießung des Pfingstgeistes verbunden.[177] Wenige Jahre vor dem Ende seines Lebens gibt Blumhardt in den «Blättern aus Bad Boll» über diese «Hoffnung des Heil[igen] Geistes» Rechenschaft und erinnert sich, dass er seit seiner Kindheit an der Diskrepanz zwischen dem, was in der Schrift über die Wirksamkeit des Geistes und seiner Gaben bezeugt ist, und der von ihm wahrgenommenen kirchlichen Wirklichkeit gelitten habe.[178] Stets war das «Bewußtsein von einer Armuth» mit einer «eine[r] Sehnsucht nach dem geheimnißvollen Etwas» verbunden.[179] In den Möttlinger Erfahrungen, v.a. im Kampf mit den «Banden der Finsternis», erfuhr Blumhardt «einen Anfang» von dem, was er sich für die ganze Menschheit erhofft: «eine neue Ausgießung des Heil[igen] Geistes».[180] Zwar sei «Vieles von dem ersten Feuer» inzwischen wieder zurückgetreten und ihm selbst sei aus dieser Zeit «nur von einer gewissen Gabe für Kranke […] etwas geblieben», doch blieb ihm umso mehr die «Sehnsucht nach der Rückkehr des Verlorenen»[181]. Die Erfahrungen der geistlichen und speziell der charismatischen Armut der Kirche verbindet er mit einer eigentümlichen geschichtstheologischen Konstruktion, in der das orthodoxe Verständnis der Charismen als « dona miraculosa antiquae ecclesiae » (Pfanner; → 2.1.6) nachklingt: «Durch fortwährendes ‹Betrüben des Heil. Geistes› von Seiten der Christenheit»[182] habe sich der persönlich im Glaubenden wohnende Pfingstgeist mitsamt seinen Gaben nach der Apostelzeit immer mehr zurückgezogen und sei schließlich verschwunden.
Читать дальше