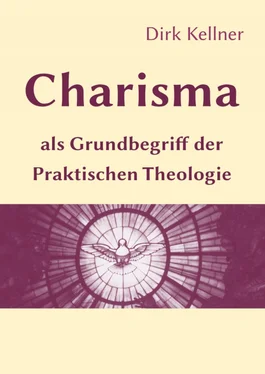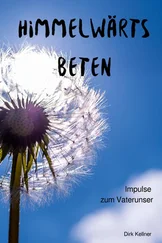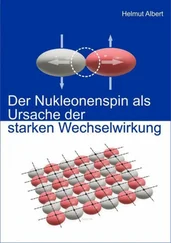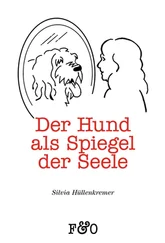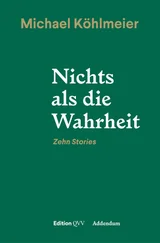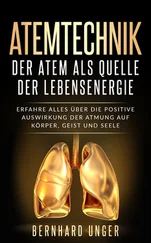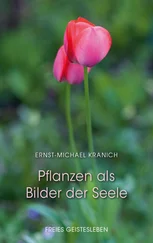Die Annäherung des Chrysostomus an die von Paulus betonte Universalität charismatischer Befähigung ist bemerkenswert.[97] Sie stellt eine kritische Stimme dar in einer Zeit, in der viele Dienste und Funktionen «im institutionellen Amt der Gemeindeleitung monopolisiert»[98] waren, zu denen Paulus alle Glaubenden durch das ihnen je individuell zukommende Charisma ermächtigt und berufen sah.[99] Dennoch kann sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass der kirchliche Klerus der eigentliche Charismenträger ist, während sich bei den Laienchristen nur schwache Abschattierungen der Geistesgaben finden und ihr Dienst auf den privaten Bereich beschränkt bleibt. Die erstmals bei Chrysostomus erscheinende bewusste Verbindung des Gleichnisses von den Talenten mit den paulinischen Charisma-Aussagen verfestigt zudem die schon bei 1Clem beobachtete Tendenz zu einem habituellen Charismenverständnis. Charisma wird zu einer einmal zugeteilten und verfügbaren Begabung. Die Souveränität des Geistes beschränkt sich auf einen initialen Akt, der nicht nur das Maß charismatischer Begabung, sondern auch den jedem zukommenden Platz in der Gemeinde bleibend festzulegen scheint.
2.1.4 Thomas von Aquin: Die Charismen als «gratiae gratis datae» zur Bevollmächtigung des kirchlichen Amtsträgers
Das entbehrlich gewordene Charisma wird in den folgenden Jahrhunderten zu einem «Randphänomen» theologischer Reflexion,[100] das außerhalb oder am Rande der großkirchlichen Theologie, im Mönchtum und in der mittelalterlichen Mystik, neue begriffliche Formen findet.[101] Erst bei Thomas von Aquin stößt das Thema wieder auf ein Interesse, das für die damalige Zeit höchst ungewöhnlich war. An zwei Stellen innerhalb der «Summa Theologica» beruft sich Thomas explizit auf 1Kor 12,4–11 und die dort genannten Gaben,[102] verwendet für sie aber nicht den latinisierten Begriff charisma ,[103] sondern das aus der augustinischen Tradition kommende Syntagma gratia gratis data («freigewährte Gnade»).[104] Im Unterschied zur «rechtfertigenden Gnade» ( gratia gratum faciens ) bewirkt die «freigewährte Gnade» nicht die eigene Rechtfertigung, sondern die des anderen. Sie ist die Gnade, «wodurch ein Mensch mit dem anderen mitwirkt, damit er zu Gott zurückgeführt werde […]. Ein solches Geschenk heißt ‹freigewährte Gnade›, weil diese dem Menschen über die Fähigkeit der Natur hinaus und über das Verdienst der Person hinaus gewährt wird.»[105]
Der Ausrichtung auf die Rechtfertigung des anderen Menschen entspricht die Konzentration auf die Lehre des Evangeliums als der einen gratia gratis data , aus der alle in 1Kor 12,8–10 genannten weiteren Formen der Gnade deduziert und je einem der drei Aspekte der Lehre (Erkenntnis, Bekräftigung, Vortrag) zugeordnet werden können:[106]
1. Erkenntnis: «Glaube» (als Zustimmung zur Glaubenswahrheit der Kirche), «Rede der Weisheit» (als Kenntnis der göttlichen Dinge) und «Rede der Wissenschaft» (als Kenntnis der menschlichen Dinge) wirken im Menschen «die Fülle der Erkenntnis der göttlichen Dinge, damit er aus dieser Fülle andere unterrichten kann».
2. Bekräftigung: Die «Gnade der Heilungen», das «Wirken von Wundern», die «Prophetengabe» (als Voraussage der Zukunft) und die «Unterscheidung der Geister» (als Offenbarung des im Herzen Verborgenen) sind gegeben, «daß er das Gesagte bekräftigen oder beweisen kann».
3. Vortrag: Die «Sprachengaben» (als Kenntnis der Sprache der Hörer) und die «Auslegung der Rede» (als Übersetzung der Tradition) helfen, «daß er das, was er empfängt, den Hörern sinnvoll vortragen kann».
Die Systematisierung[107] zeigt die Überordnung der Lehre als dem Charisma schlechthin, dem alle anderen Gnadengaben funktional unter- oder zugeordnet werden. «Während bei Paulus die Charismen vorwiegend auf die einzelnen Gemeindeglieder verteilt erscheinen, deren jedes seine Gliedfunktion erhält, sind sie bei Thomas allesamt Funktionen eines einzigen Auftrages.»[108] Diese Einschränkung der charismatischen Vielfalt führt aber unweigerlich zur Eingrenzung des Kreises charismatisch Begabter auf diejenigen, denen die gratia der Lehre zukommt: die alttestamentlichen Propheten, Christus als Quelle und Fülle aller Gnaden, die Apostel als Nachfolger Christi und der «Doktor», «da er für die heutige Kirche als Hermeneut des Wortes Gottes die Stelle der Propheten einnimmt und für den Predigerbruder Thomas die zentrale geistige Funktion in der Kirche ausübt».[109] Damit werden die Charismen Gegenstand einer vornehmlich historischen Betrachtungsweise. In der Gegenwart sind sie im Wesentlichen auf die kirchlichen Amtsträger beschränkt,[110] so dass «in einer Verschränkung von Amt und Charisma […] die kirchliche Charismatik als ganze zu einer Teilhabe an der apostolischen Vollgewalt und Vollgnade»[111] wird. Dem entspricht ihr systematisch-theologischer Ort am Ende der theologischen Ethik der Summa: Nach der Behandlung der alle Menschen bzw. Christen betreffenden Sittenlehre kommt Thomas zu der «Erwägung […], was einige Menschen im besonderen betrifft»[112]. Von den Charismen der «Laien» ist bei Thomas im Gegensatz zu Johannes Chrysostomus nicht mehr die Rede. Die aktuelle Relevanz der Charismenlehre bleibt im Wesentlichen auf den kirchlichen Amtsträger als den privilegierten Inhaber des Lehrcharismas beschränkt.
2.1.5 Martin Luther: Die Charismen als «Beigaben» des Glaubens
Bereits die Wortstatistik zeigt, dass weder der Begriff Charisma noch die mit ihm verbundenen theologischen Zusammenhänge eine entscheidende Rolle in Luthers Denken spielen.[113] Der lateinische Terminus charisma erscheint nur selten,[114] und wenn Luther von «Gaben» (bzw. lat. dona ) spricht, fasst er darunter fast ausschließlich allgemeine Heilsgaben Gottes, wie den Glauben oder das ewige Leben.[115] Oskar Föller urteilt zutreffend: «Luthers Hauptinteresse gilt nicht der Vielfalt der Charismata, sondern der einen heilsnotwendigen, Zeit und Ewigkeit umfassenden Charis.»[116] Ausführlichere Erörterungen finden sich nur in Luthers Schriftauslegung und Predigten über die entsprechenden neutestamentlichen Stellen[117] – «und auch dort äußert er sich jeweils eher zurückhaltend»[118]. Dabei zeigen sich theologische Akzentuierungen, die für die Frage nach der aktuellen praktisch-theologischen Relevanz der Charismenlehre von Bedeutung sind.
1. Relativierung des Mirakulösen: Luther hat das überkommene Urteil vom Aufhören der (außergewöhnlichen) Charismen nicht unbesehen übernommen. So schränkt er in seinen Himmelfahrtspredigten die wunderhaften Zeichen aus Mk 16,17f nicht grundsätzlich auf die Apostelzeit ein, sondern hält die Möglichkeit eines gegenwärtigen Erscheinens für besondere Situationen offen, in denen die Lehre des Evangeliums durch Wunder verteidigt oder bestätigt werden muss.[119]
«Dann ain Christen mensch hat gleich gewalt mit Christo […] Darumb wa ain Crysten mensch ist, da ist noch der gewalt solch zaichen zu thun, wenn es von noeten ist. Es sol sich aber niemandts understeen die zu ueben, wenn es nicht von noeten ist oder nit erforderet […]. Seytemal aber das Euangelium nun außgebraitet und aller welt kund worden ist, ist nit von noeten zaichen zu thun als zu der Apostel zeiten. Wann es aber die not fordern wurde unnd sye das evangelium engsten und dringen woltten, so muessendt wir warlich dran und muessen auch zaichen thun, ee wir das Euangelium uns liessen schmehen und underdrucken. Aber ich hoff es werd nit von noeten sein und wirt dahyn nyt geraichen: also das ich mit newen zungen solt alhye reden, Ist doch nit von noeten […]. Wann mich got aber hin schickte da sy mich nit vernamen, da kund er mir wol jre zung oder sprach verleyhen, dadurch ich verstanden wurde. Hierumb sol sich niemant understeen on anligende noeten wunderzaichen zu thun.»[120]
Читать дальше