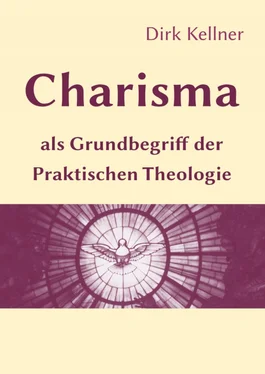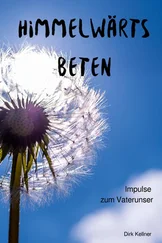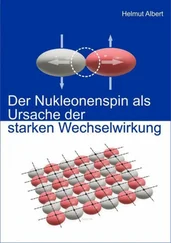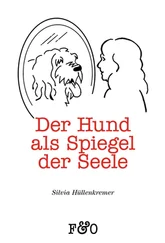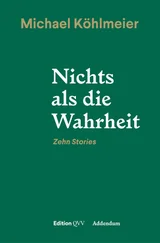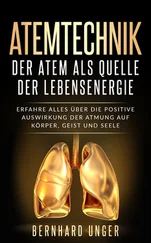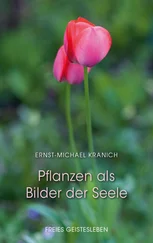Da diese Notwendigkeit aber gegenwärtig nicht gegeben sei, sind die wunderhaften Charismen für Luther ohne herausragende aktuelle Bedeutung.[121] Sie sind der Verkündigung des Evangeliums und dem Glauben als dem wahren und größten Wunder Gottes untergeordnet und verhalten sich zu ihm wie Blei zu Gold.[122] Aufgrund ihrer Zweideutigkeit sind sie wie alle anderen Gaben Gottes immer an der Lehre des Evangeliums zu prüfen.[123]
2. Betonung des Geschenkcharakters: Die rechtfertigungstheologische Prämisse des sola gratia kommt in Luthers Verständnis der geistlichen Gaben immer wieder zur Anwendung. Die Gaben sind «von oben her geschenkt» ( e supernis datum )[124], «Gnadengaben»[125], nicht aufgrund eines eigenen Verdienstes verliehen. Sie sind Beigaben, die Gott zusammen mit dem Glauben als der ersten und wichtigsten Gabe schenkt.
«Aber ich acht […], Das der Glaube mit sich bringe als ein heupbt gutt die andern gaben […], das wyr solche gaben nicht verdienet haben, sondern wo glaube ist, da ehret Gott den selben glauben mit ettlichen gaben als zur mitgabe odder ubergabe,[126] wie viel er will […]. Eben darumb spricht er auch, es seyen mancherley gaben, nicht nach unserm verdienst, sondern nach der gnaden, die uns geben ist; das also die gnade gleich wie der glaube mit sich bringe solch edle kleynot und geschencke, eym iglichen seyne mas.»[127]
Die Gaben dienen daher auch nicht dazu «fur Gott frum, selig odder besser denn der andre»[128] zu werden. Es ist eine Verkehrung von «Gottis warheyt […] ynn eyne lugen», wenn die Glaubenden «aus den gaben Gottis eynen dienst fur Gott [machen], die doch zum dienst des nehisten geben sind»[129].
3. Hervorhebung des Ordnungsgedankens: Auf dem Hintergrund der negativen Erfahrungen mit radikalen Reformbestrebungen legt Luther besonderes Gewicht auf die paulinische Mahnung zur Selbstgenügsamkeit und Ordnung. Wie die Einheit des Glaubens und die Gemeinschaft des Geistes die Geringschätzung einer Gabe ausschließt,[130] so widerspricht die Verschiedenheit des nach Gottes Willen je individuell zugeteilten Charismas der geistlichen Selbstüberschätzung. Es sei kennzeichnend für die Schwärmer, sich in einen Dienst zu drängen, zu dem sie weder Gabe noch Verständnis haben.[131] In der Schrift «Von den Schleichern und Winkelpredigern» (1532) wird die Frontstellung gegenüber den Spiritualisten des linken Flügels der Reformation exemplarisch greifbar. Luther polemisiert gegen Prediger, die ohne Berufung öffentlich auftreten und «jnn ein frembd ampt greiffen und fallen»[132] Sie legitimieren ihr Rederecht mit einem Verweis auf die Charismenlehre, besonders auf 1Kor 14,30f. Luther widerspricht, indem er in problematischer Umdeutung der paulinischen Aussagen behauptet, die Stelle habe nur die (amtlich eingesetzten) Propheten und Lehrer im Blick, nicht den «pobel, der da zu hoeret»[133]. Luther ermahnt daher, dass sich niemand als «hans ynn allen gassen»[134] zu allem berufen fühlen und in Aufgabe und Dienst der anderen eingreifen dürfe, sondern bei seinem «Amt» bleiben solle.[135] Durch die Verbindung der Leib-Christi-Metapher mit der mittelalterlichen Standes- und Berufsethik geht Luther aber über die paulinische Ermahnung zur τάξις (1Kor 14,40) hinaus.[136] Die Dynamik der paulinischen Charismenlehre geht verloren, wenn das Charisma zu einer statischen Ortzuweisung wird.[137]
4. Fokussierung auf das kirchliche Amt: Die statische Auffassung der Charismen als angelegte oder erworbene Begabung begünstigt ihre Fokussierung auf den kirchlichen Amtsträger.[138] Er wurde von Gott mit der Gabe des Weissagung, interpretiert als die Gabe der Verkündigung ausgestattet,[139] bzw. hat sich durch sein Studium die Gabe der Auslegung der Sprachen, d.h. in Luthers Verständnis die Kenntnis der biblischen Ursprachen und die Fähigkeit der Übersetzung, angeeignet.[140] In der Fastenpostille von 1525 bezieht Luther ausdrücklich die ersten sechs in Röm 12,6–8 genannten Charismen auf das «gemeyn regiment der Christenheyt, wilchs man nu heysst den geystlichen stand»[141], und hält die Begabung einer einzigen Amtsperson mit mehreren Gaben für die Regel.[142] Zu den «stücke, die yderman angehen ynn der Christenheyt»[143] zählt er neben den in Röm 12,9–16 folgenden Tugenden und Wohltaten nur das Charisma der Barmherzigkeit. Für die Gemeinde hat die paulinische Charismenlehre nur wenig Bedeutung. So beginnt Luther eine Predigt über 1Kor 12,1–11 mit den Worten: «Haec Epistola ist nicht fast von noten pro gmeinen man.»[144]
Luthers Charismenverständnis bietet somit bedeutsame Einsichten, überwindet aber letztlich nicht die überkommene Fokussierung der Charismen auf die kirchlichen Amtsträger. Dies ist umso bedauerlicher, als Luthers Lehre vom allgemeinen Priestertum in der neutestamentlichen Charismenlehre eine wichtige pneumatologische Vertiefung erfahren hätte. Damit wäre sie eventuell nachhaltiger gegen die Gefahr gewappnet gewesen, auf den Bereich der persönlichen Gottesbeziehung oder des privaten Lebensumfeldes beschränkt zu werden. Ihre reformerische Kraft konnte sie bisher jedenfalls nicht zur vollen Entfaltung bringen.[145]
2.1.6 Tobias Pfanner: Die Charismen als «dona miraculosa antiquae ecclesiae»
Während sich bei Luther die Charismen im kirchlichen Amt konzentrieren, aber nicht gänzlich der Vergangenheit überlassen werden, findet sich in der altprotestantischen Orthodoxie erstmals eine explizite definitorische Beschränkung der Charismen auf wunderhafte Phänomene der Urchristenheit. Von Tobias Pfanner stammt die erste monographische Abhandlung der Theologiegeschichte über die Charismen.[146] Schon der Titel deutet ihre Identifikation mit den Wundergaben der Alten Kirche an: « Diatribe de charismatibus sive donis miraculosis antiquae ecclesiae » (1680). Die Charismen bleiben auf die Gaben beschränkt, die der auferstandene Christus der Kirche nach Mk 16,17f verheißen hat (Exorzismus, Sprachengabe, Krankenheilung, Unversehrtheit). Hinzu kommt noch das donum prophetiae , das Pfanner allerdings nicht wie Luther auf die Verkündigung bezieht,[147] sondern als visionäre Zukunftsweissagung versteht.[148] Die weniger wunderhaften Gaben aus Röm 12,6–8 sind nicht im Blick. Zugleich versucht Pfanner mit zahlreichen Belegen aus den Schriften der Kirchenväter nachzuweisen, dass die Charismen nur die zeitlich begrenzte Funktion hatten, die Heiden zur Zeit der ersten Kirche vom Evangelium zu überzeugen.[149] Nach der Ausbreitung der Kirche hätten sie ihre Notwendigkeit und Nützlichkeit verloren, in ihrer Häufigkeit nachgelassen und schließlich gänzlich aufgehört. Seine «Diatribe» schließt folgerichtig mit dem Kapitel « De Cessatione Miraculorum ».[150] Als Größen der Vergangenheit sind die Charismen für die heutige Theologie und Kirche ohne eine Bedeutung, die das historische Interesse übersteigt.[151]
2.2 Impulse zur Neuentdeckung der Charismenlehre in der Theologie des 19. Jahrhunderts
Die von Tobias Pfanner definitorisch fixierte Historisierung des Charismabegriffs wurde von den unterschiedlichen Frömmigkeitsbewegungen des 17., 18. und 19. Jahrhunderts nur zögerlich überwunden. Die neutestamentliche Charismenlehre wurde auch dort nur selten rezipiert, wo sich die Reformbemühungen auf die geistliche Mündigkeit und Aktivierung der (erweckten) Gemeindeglieder konzentrieren.
So propagiert zum Beispiel Philipp Jacob Spener in seinen «Pia Desideria» die «auffrichtung und fleissige übung deß Geistlichen Priesterthums» und empfiehlt die Einrichtung von «versamlungen […], auff die art wie Paulus I.Corinth. 14. dieselbe beschreibet / wo nicht einer allein aufftrette zu lehren / (welches zu andernmahlen bleibet) sondern auch andere / welche mit gaben und erkanntnuß begnadet sind».[152] Die neutestamentliche Charismenlehre klingt hier und an wenigen weiteren Stellen an.[153] Sie hat aber für Speners Theologie keine konstitutive Bedeutung. Die argumentative Begründung des geistlichen Priestertums bleibt daher, wie Hans-Martin Barth bemerkt, «eher dürftig»[154], der «ihm so wichtige pneumatologische Ansatz [wird] nicht nach allen Hinsichten einfaltet, die dieser ihm zur Verfügung stellen würde»[155]. Die fehlende theologische Reflexion kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Charismenlehre den weitgehend unthematisierten Legitimationshorizont für die praktische Realisierung der Laientätigkeit in den Spener’schen Collegia pietatis oder in der Herrenhuter Brüdergemeine mit ihren an Röm 12 orientierten Ämtern und ihrer Durchgliederung in «Banden», «Classen» bzw. «Chöre» bildet.[156] So ist es wenig verwunderlich, dass ein «Herrnhuter […] von einer höheren Ordnung»[157] sich von 1Kor 12 inspirieren lässt.
Читать дальше