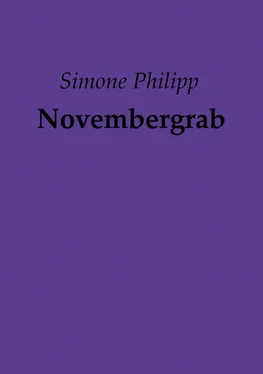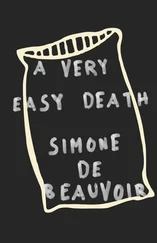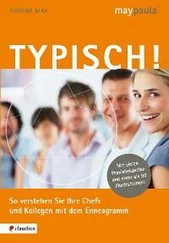„Lasst ihn doch“, sagte ein anderer und mühte sich um Versöhnung, froh darüber, dass einer bereit war, freiwillig die undankbare und gefährliche Aufgabe zu übernehmen, die Soldaten am äußeren Tor auszuschalten. „Wenn er sich unbedingt beweisen will.“
„Beweisen!“, grölte ein vierter. „Im Handumdrehen erwischen ihn die Soldaten und dann? Seht ihn euch an: der hat in seinem Lebtag noch keinen Schmerz ertragen müssen. Einer wie er wird seinen Mund aufmachen, kaum dass sie ihn nur piksen. Und am Ende lassen sie ihn laufen, weil er einer von ihnen ist. Uns aber wird es den Kopf kosten, wenn wir ihn mitnehmen. Hab ich nicht Recht?“
„Das sehe ich ganz genauso“, stimmte ein weiterer zu. „Wir sollten ihm den Hintern versohlen für seine Frechheit, wie einem ungezogenen Kind.“ Und dann sah er zu dem Jungen hinüber. „Glaubst du, wir wissen nichts über euch?“, schrie er ihn an. „Meinst du, wir hätten keine Ahnung davon, dass ihr euch euer angenehmes Leben auf euren feinen Burgen nur deswegen leisten könnt, weil andere für euch arbeiten? Andere, die ihr mit Waffengewalt unter euren Willen zwingt.“ Er spuckte aus.
Der Junge hielt dem Mann stand, ohne den Blick abzuwenden. Seine Augen waren von einem ungewöhnlich durchdringenden Blau. Und das Starren schien den Mann noch wütender zu machen.
„Sieh her!“, brüllte er. Mit einer Hand weitete er den oberen Ausschnitt seines Hemdes und entblößte von tiefen Narben zerfurchte Schultern. „Braucht es noch mehr? Was glaubst du, was die anderen hier erdulden mussten, in euren Verliesen, auf euren Feldern, in euren ...“
„Genug jetzt!“, fuhr einer dazwischen. „Was kann denn der Junge dafür? Lasst ihn in Ruhe! Er soll die Tische abräumen und wir können weiter besprechen.“
Doch einige der Männer schienen nicht zufrieden. „Nein, er soll zeigen, dass er nicht nur ein großes Maul hat!“ Einer von ihnen zog sein Schwert aus der Scheide und warf eine zweite Waffe auf den Tisch. „Wir wollen sehen, was du kannst!“
Der Junge mit dem weißen Haar tat einen Schritt, griff nach dem Heft des Schwertes und schlug dem Mann vor ihm mit einer kaum auszumachenden Bewegung die Waffe aus der Hand. Es war totenstill in der Halle, bis die anderen begriffen hatten, dass der Kampf bereits vorüber war.
„Der Junge wird morgen Nacht mit dabei sein“, sagte der Anführer endlich. „Und ich dulde keinen Widerspruch.“
Als die folgende Nacht hereinbrach, verbargen sich die Männer im Dickicht des Waldes, während sich der Junge mit dem weißen Haar auf leisen Sohlen der Burganlage näherte. Wie ein Schatten fiel er die beiden Soldaten am äußeren Tor aus dem Dunkeln an und schlug sie mit einem großen Stein zu Boden, ohne dabei auch nur ein einziges verräterisches Geräusch zu verursachen. Anschließend sprang er über die Mauer und öffnete von innen die Flügel des Einganges. Die Angreifer drangen auf den Grund und in die Gebäude vor und das Blut der Bewohner floss reichlich von ihren Klingen. Und auch der Junge selbst verstrickte sich in einen heftigen Kampf mit dem Lehnsherrn und einigen seiner Soldaten. Doch als ihm einer der Männer zu Hilfe eilen wollte, hielt ihn ein anderer zurück.
„Sieh dir das an!“, sagte er leise. „Er mag noch ein halbes Kind sein, aber er kämpft besser als selbst der Teufel. Der braucht unsere Hilfe nicht.“
Und die beiden Männer verfolgten staunend aus dem Hintergrund heraus, wie die Soldaten einer nach dem anderen von der Hand des Jungen fielen, bis ihm zuletzt der Herr der Burg allein gegenüberstand. Als dieser zu einem gewaltigen Hieb ansetzte, parierte der Junge den Schlag zur Seite hin und brachte anschließend seinen Gegner durch eine winzige Bewegung seines Fußes zu Fall. Dabei verlor der Lehnsherr seine Waffe, die klirrend über den Boden rutschte.
„Heb’ dein Schwert auf!“, wies der Junge ihn an.
„Ich ergebe mich“, stieß der Mann voller Verzweiflung hervor und zog die Beine unter seinen Körper, so dass er vor dem Jungen auf den Knien lag. „Ich flehe Euch an. Schont mein Leben. Nehmt Euch, was Ihr wollt. Ich besitze Gold … und habe ein paar hübsche Mägde …“
„Dein Gold und deine Weiber kümmern mich einen Scheißdreck!“, schrie der Junge. „Alles, was ich will, ist ein guter Kampf. Also, steh jetzt augenblicklich auf, hol’ deine Waffe und dann kämpfe wie ein Mann, du Feigling!“
Doch der Lehnsherr schüttelte lediglich stumm den Kopf und es war offensichtlich, dass er der Anweisung seines Gegenübers, den Kampf bis zum Tod fortzuführen, nicht nachkommen würde. Da ließ der Junge sein Schwert fallen und zog stattdessen ein Messer aus seinem Gürtel. Er tat einen Schritt nach vorne und fiel dann wie ein Raubtier über den unbewaffneten und am Boden knienden Mann her. Immer wieder stach er auf ihn ein und er ließ auch nicht von seinem Opfer ab, als das Bündel unter ihm nur mehr ein schlaffer Sack war, aus dem das Blut in einer hohen Fontäne aus der durchtrennten Halsschlagader schoss.
Irgendwann rissen die beiden Männer, die sich im Hintergrund des Kampfes gehalten hatten, den Jungen aus seinem Tun und als dieser sich gegen sie zur Wehr setzte, schlug ihm der eine die Faust gegen das Kinn.
„Hör endlich auf!“, brüllte er. „Er ist doch schon längst tot!“
Und der Junge starrte auf den Leichnam unter sich und verharrte eine Ewigkeit auf der Stelle, zitternd vor Berauschung an der Macht des Tötens und durchtränkt von eigenem Schweiß und fremdem Blut.
Bernadette, die löwenstarke, war eine jener Burganlagen, die ihrem Namen alle Ehre machten. Die riesige Festung war bereits vor Jahrhunderten errichtet worden und lag, beinahe unzugänglich, hoch oben auf einem steilen Felsen. Lediglich im Westen führte ein begradigter Weg durch den dichten Wald zum Tor der äußeren und mehr als dreimal mannshohen Ringmauer hinauf, breit genug, dass ein Wagen bequem von einem Doppelgespann Pferden gezogen werden konnte.
Die Burg war seit ihrem Bestehen noch niemals belagert oder gar angegriffen worden. Und dennoch hatte Richard, der Fürst, sich im Gegensatz zu seinem Großvater und Vater nicht darauf verlassen wollen, dass allein Bernadettes Größe und Mächtigkeit alle Gegner abschrecken würden. Stattdessen hatte er zahlreiche Söldner aus allen Teilen des Heiligen Römischen Reiches angeworben.
„Wenn ich mir ansehe, wie nachlässig die meisten Anlagen geschützt sind, dann kann ich mir bei so viel Dummheit nur an den Kopf greifen“, sagte Richard immer wieder zu jedem, der es hören wollte oder auch nicht. „Als ob ein Lehnsherr mit seinen drei oder vier Söhnen, die noch halbe Kinder sind, und seinen plumpen Bauern, die nicht einmal wissen, wie man ein Schwert hält, einen Angriff abwehren könnte. Dann muss der Herr sich auch nicht wundern, wenn er Gesellschaft von irgendwelchen marodierenden Haufen bekommt, die sich weigern wieder zu gehen. Er selbst hat sein Tor ja für sie offen gelassen.“
Der Fürst dagegen hielt eine gewisse Vorsicht für wesentlich angebrachter. Und anstatt auf Gott oder sein Glück zu vertrauen, die ihm wohl hoffentlich beide einen Angriff oder eine Belagerung seiner Burg ersparen mochten, setzte Richard lieber auf die Treffsicherheit seiner Bogenschützen und die mehrfach gehärteten Schwerter seiner Soldaten. „Die Sicherheit der Burgbewohner steht über allem“, konstatierte Richard und meinte damit nicht zuletzt sich selbst und seine Familie. „Auch wenn es mich vielleicht mein halbes Vermögen kosten mag, die Söldner zu bewaffnen.“
Walter lachte stets über solche Worte. „Tatsächlich aber kosten dich die Soldaten nicht nur einen Haufen Geld, sondern auch einen gut Teil deiner Nerven.“
Richard seufzte. „Ja, sie werden mich noch mal ins Grab bringen“, gab er zu.
Der Fürst bot seinen angeworbenen Männern nämlich neben der guten Ausbildung und der hervorragenden Bewaffnung, freie Unterkunft und Essen. Darüber hinaus musste er allerdings auch immer wieder nahezu klaglos ertragen, dass die Soldaten ein verhältnismäßig zügelloses Leben auf seinem Anwesen führten und er ließ sie sich sogar hin und wieder aus seinen gut gefüllten Weinkellern bedienen, nur damit sie bei Laune und auf seinem Grund blieben.
Читать дальше