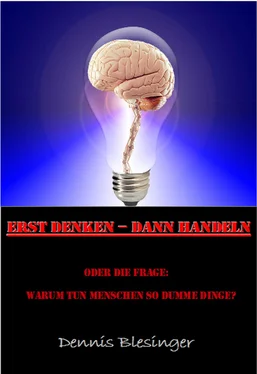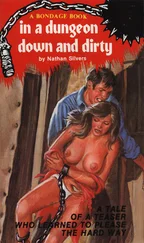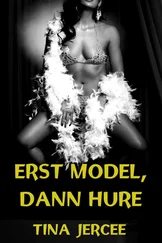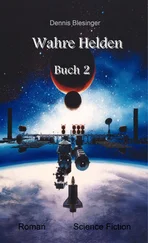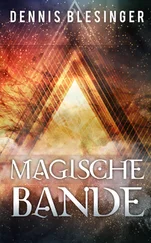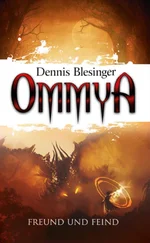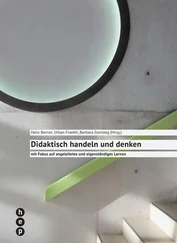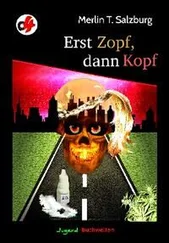Ein schlichtes und ernst gemeintes "Tschuldigung" wäre völlig okay. Alle wären glücklich. Wie schon gesagt, jeder von uns denkt mal nicht nach. Die Frage ist immer, wie man mit dieser Erkenntnis jetzt und in der Zukunft umgeht.
Die Kombination 'Mütter' und 'Supermarkt' ist eine ganz besondere. Viele Mütter benutzen nämlich ihren Kinderwagen als mobilen Einkaufskorb. Was an sich ja nicht dumm ist, im Gegenteil. Wenn sich das gute Stück dann allerdings in der bereits beschriebenen Art und Weise als Hindernis der eigenen Einkaufstour präsentiert, sollte man sich drei Mal überlegen, ob man Hand an den Wagen legt, besonders, wenn ein Kind darin ist. Man wird höchstwahrscheinlich des versuchten Kindesraubes bezichtigt. Selbst dann, wenn das Kind munter und fröhlich mit der Mutter unterwegs ist. Aber auch Mütter bekommen in diesem Buch ein eigenes Kapitel. Auch dazu also später mehr.
Letztendlich kämpft man sich aber jedes Mal durch die Gänge und findet sich in am Schluss der Einkaufstour am Ende der mehr oder weniger langen Schlange wieder, die zur Kasse führt.
Um den Umfang dieses Kapitels nicht zu sprengen, und weil es ein Kapitel mit dem Namen 'Das Ende der Schlange' gibt, verzichte ich auf solche profane Dinge, wie 'dem Vordermann von hinten die Hacken fahren', 'Wie man sich korrekt in einer Schlange anstellt', was es mit einem Laufband auf sich hat und das allseits beliebte Phänomen 'Oh, ich habe noch was vergessen, ich bin gleich wieder da', sondern komme gleich zum Ende: Dem Bezahlen.
Ich persönlich mache immer Folgendes: Nachdem ich meine Ware auf das Band gelegt habe, überfliege ich Pi mal Daumen, wie der Endbetrag wahrscheinlich aussehen wird, den ich zu entrichten habe, um all die schönen Dinge, die ich mir mühsam ersammelt habe, auch rechtmäßig nach Hause befördern zu dürfen. Dann werfe ich einen geschwinden Blick in meine Geldbörse, um zu überprüfen, ob die Liquidität ausreichend ist. Dann nehme ich entweder die entsprechenden Geldeinheiten aus besagter Börse oder nehme die EC-Karte in die Hand.
Was auch immer: In jedem Falle sorge ich dafür, dass das blöde Portemonnaie griffbereit ist, wenn die freundliche Kassiererin ihren magischen Satz sagt: "27,95 bitte". Dann gebe ich ihr das Geld/die Karte, räume, während sie abrechnet, weiter und zu Ende ein, nehme das Wechselgeld und gehe dann irgendwohin, wo ich meine Sachen in Ruhe einpacken kann, ohne den weiteren Betrieb zu stören.
Soweit zur Theorie. Bei jedem dritten bis vierten Kunden in der Schlange passiert nun aber Folgendes:
Kurz nachdem der zu entrichtende Betrag verkündigt wurde, fällt diesen Leuten völlig unvorbereitet auf, dass heute ausnahmsweise nicht 'Frei-Einkaufen-Tag' ist, sondern ein Tag wie jeder andere, und dass sie das Zeug auf dem Band ja auch wirklich bezahlen müssen. Umständlich wird jetzt das Portemonnaie herausgeholt (dabei werden auch gerne mal sämtliche Taschen durchsucht, wobei ich mich frage, ob ich der Einzige bin, der sein Portemonnaie immer am selben Ort aufbewahrt). Während des Bezahlvorganges wird nicht weiter eingeräumt. Nein. Weil: Hier geht es schließlich um Geld, da hört der Spaß auf und man muss man dem anderen auf die Finger gucken. Er könnte ja sein, dass er sich mit den horrenden Wechselgeldsummen aus dem Staub macht.
Erst nachdem das Wechselgeld geprüft und verstaut wurde (das dauert oftmals genau so lange wie das Herausholen), wird dann zu Ende eingepackt, möglichst noch so, dass die Sachen im Korb geometrisch ordentlich angeordnet sind. Dann wird sich umgeguckt, wo denn der beste Platz zum endgültigen Verstauen der Ware ist. Sollte man spontan keinen entsprechenden Platz finden, der einem behagt, so wird das ganz einfach an der Kasse getan, womit man höchst effizient verhindert, dass der Nächste in der Schlange bedient werden kann.
Auch gerne genommen ist die Erwiderung: "27,95? Warten Sie mal, das hab ich passend." Nach gefühlten zweieinhalb Stunden kommt man zu dem Schluss, dass das leider doch nicht der Fall ist, und holt jetzt die EC-Karte raus (mehr dazu im letzten Kapitel). Warum fünf weitere Münzen Wechselgeld im Portemonnaie offensichtlich das Ende der Welt bedeuten, habe ich bis heute nicht verstanden.
Inzwischen ist die Schlange an der Kasse auf 27 Leute angewachsen, was dazu führt, dass die Angestellte, die gerade dabei war, die Bestände aufzufüllen, ihren Palettenwagen kurz alleine lassen muss, um eine weitere Kasse zu besetzen, was unweigerlich dazu führt, dass jemand seinen Einkaufswagen sofort genau daneben abstellt.
Einkaufen ist harte Arbeit. Vor allem im Kopf. Aber mal ganz ehrlich: Rein, Wagen holen, Sachen rein, an die Kasse, bezahlen, einpacken, Wagen zurückstellen, raus.
Ist doch nicht so schwer. Sollte man meinen.
Kommentare und Erklärungsversuche bitte an mich.
Zwischenmenschlicher Verkehrsfluss
Öffentliche Verkehrsmittel sind eine feine Sache, vor allem für die Umwelt. Vom Faktor Geld mal ganz abgesehen. Auch wenn es einem jeden Monat die Tränen in die Augen treibt, was der jeweilige ÖPNV für eine Monatskarte nimmt, kommt man damit doch meist deutlich besser weg als mit einem eigenen Auto, das die Straßen noch mehr verstopft als das ohnehin schon der Fall ist.
Der Vorteil beim Auto ist, ganz klar, dass man alleine ist. Man kann die Musik so weit aufreißen, wie man will, man braucht sich keine Gedanken darüber machen, ob andere bemerken könnten, dass man vergessen hat, ein Deodorant zu benutzen, man kann rauchen, wenn einem danach zumute ist usw.
Die Tatsache, dass man trotz der Abgeschiedenheit innerhalb des eigenen Wagens mitnichten alleine unterwegs ist, dieser Umstand aber irgendwie einigen Menschen nicht klar ist und die daraus resultierenden Probleme werden im nächsten Kapitel beschrieben.
Hier geht es erst einmal um öffentliche Verkehrsmittel. Bei Reisen in Bus, Straßenbahn, der S- und der U-Bahn gilt: Auch hier ist man nicht alleine, auch hier gibt es noch andere Menschen. Und zwar eine Menge. Das sollte einem nach der ersten Woche aufgefallen sein, entsprechend könnte man seine Handlungsweise darauf einstellen.
So ist es zum Beispiel so, dass zwei Menschen nebeneinander auf diesen Bänken in Bussen und Bahnen sitzen können, auf den hinteren meistens fünf.
Jetzt gibt ein psychologisches Phänomen, das sich "Distanzzone" nennt und den optimalen Mindestabstand zwischen zwei Menschen im täglichen Leben definiert, bevor es unangenehm wird. Man unterscheidet zwischen:
1) Gesellschaftliche Distanz
Menschen, die man nicht kennt und denen man vielleicht auch gar nicht zu nahe kommen möchte. Der optimale Abstand beträgt hier mindestens 2-3 Meter, die Skala ist nach oben offen. Je weiter weg, desto besser.
2) Persönliche Distanz
Freunde, Bekannte und Kollegen dürfen auch gerne mal bis zu einem Meter an einen ran. Spätestens, wenn man sich begrüßt, geht das auch nicht anders. Wichtig ist hier, dass man den anderen zumindest ansatzweise kennt und auch sympathisch findet.
3) Intime Distanz
Diese Kategorie ist sehr guten Freunden, der eigenen Familie und Partnern vorbehalten und der Abstand beträgt nur noch einen halben Meter oder noch weniger, je nachdem, was man gerade vorhat.
Rein theoretisch müsste man also eine Menge sehr guter Freunde haben, wenn man morgens in die Bahn steigt. Das ist aber leider nicht so. Situationen wie der morgendliche Berufsverkehr fallen nämlich genau genommen unter die 'Gesellschaftliche Distanz'-Ebene, weil man 99,99 Prozent aller Menschen dort nicht kennt.
Es ist also normal, dass man sich einen Platz sucht, wo man möglichst alleine sitzt und den Rest der Leute ein wenig meidet. Das ist der Grund, warum zuerst immer alle Vierergruppen mit einer Person besetzt sind, und zwar am Fenster. Danach füllt sich das Ganze dann langsam auf. Diese großzügige Verteilung funktioniert aber nur so lange, wie die Bahn oder der Bus einigermaßen leer ist. Spätestens im besagten Berufsverkehr wird diese Grenze regelmäßig unterschritten.
Читать дальше