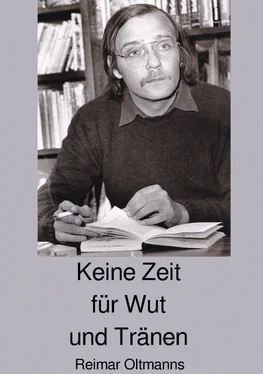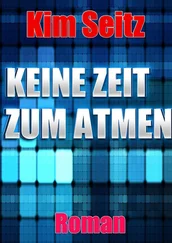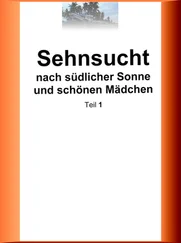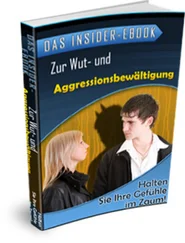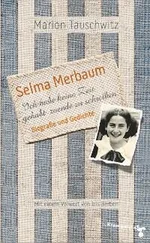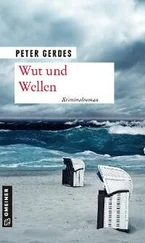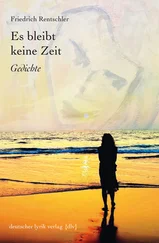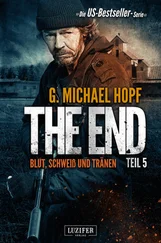Reimar Oltmanns - Keine Zeit für Wut und Tränen
Здесь есть возможность читать онлайн «Reimar Oltmanns - Keine Zeit für Wut und Tränen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Keine Zeit für Wut und Tränen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Keine Zeit für Wut und Tränen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Keine Zeit für Wut und Tränen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Keine Zeit für Wut und Tränen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Keine Zeit für Wut und Tränen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Am 19. November 1989 öffnete sich plötzlich – mir nichts, dir nichts – die schwer bewaffnete Staatsgrenze gen Westen; unvorstellbar, Hoffnung auf Nähe. Hastige Blicke in den Ortskern des DDR-Städtchens verrieten eine innere Leere der Verlassenheit, Aufgeräumtheit, auch der Lieblosigkeit. Leblos verstaubte HO-Läden, verfallene Höfe, rissiges Backsteingemäuer. Einsilbig protzte die Partei-Propaganda an ausgefransten Straßenrändern: „Tag der Nationalen Volksarmee…Tag der Frauen… Es lebe die Deutsche Demokratische Republik der Staat der deutschen Zukunft…“.
Auf mich wirkte Hötensleben wie eine Geisterstadt oder auch eine Filmstudio-Attrappe. Gespenstisch – ein Ort ohne Widerhall. Menschen, die dieses kommunistische Gemeinwesen aufbauen sollten, die waren nirgendwo mehr zu sehen. Sie hatten sich allesamt aufgemacht in die Freiheit, die sie Schöningen nannten; wo in Supermärkten Regale vom Schnellkauf leergefegt wurden. Nachholbedarf.
Mit ihrem heiseren Geschrei „Urat! Urräh!“ berichtete mit belegter Stimme Frau Zirkler damals nach dem Zweiten Weltkrieg ihrer Frauen-Runde. Sie standen ganz plötzlich in ihren knallgelben Uniformen auf unserem Hof. Unvergessen. Mit ihren Kalaschnikows im Anschlag zerrten sie uns in den Keller: „Dawai! Dawai!“ …
In den drauf folgenden Nächten kauerten die Frauen bei Kerzenlicht im Verließ. Strom gab es nicht, an Schlaf mochte keine denken. Ihre Gesichter hatten sie mit Ruß beschmiert und dreckige Sachen angezogen. Draußen vor der Tür lungerten russische Soldaten umher, stöberten Mädchen und Mütter auf. Ihnen eilte der gefürchtete Ruf voraus: „Frau komm, dawai, dawai.“ Als die Damen in der Kaffeerunde so erzählten, ihr Leid und sich beklagten, schienen sie jemanden ganz vergessen zu haben - nämlich mich, der ihnen wie gebannt zuhören mochte.
Vor der Wiedervereinigung im Jahre 1990 war die Ortschaft Hötensleben mit seinen 2.500 Einwohnern für mich jedenfalls unerreichbar; eine andere, in sich verschlossene Welt. Neugierde. Hier, genau hier, verlief der zehn Meter breite „Antifaschistische Schutzwall“. Es war ein Todesstreifen von 1.378 Kilometer inmitten durch Deutschland mit Grenzzäunen, Grenzmauern und ein Bollwerk aus zusammengeschweißten Eisenschwellen, Kontrolltürmen. Genau 872 Grenzgänger, Flüchtlinge fanden zwischen der BRD und der DDR in den Jahren 1961 bis 1989 den Tod. In der Ära des Kalten Krieges sah ich diese mit Waffen übersäte Demarkationslinie zwischen Ost und West fast an jedem Wochenende. Da spielte ich Zöllner. Das hatte ich den Uniformierten abgeguckt, glaubte ich doch einer von ihnen sein.
Vor ihnen musste ich mich nun verstecken. Ich wollte nicht wieder wie ein aufgegriffener Flüchtling von westdeutschen Grenzern mit einem VW-Bus nach Hause geschickt und meiner Mutter übergeben werden. Nein – da war ich lieber unbemerkt mit meinem Gummi-Roller auf den stummen, unkontrollierten Grenzen zum „Alten Fährhaus“ unterwegs, Limo trinken; vorbei an Schussanlagen, kläffenden Hunden an Laufleinen, den Zäunen, Selbstschussanlagen, Sichtblendmauern. Hektisch sprangen die Scheinwerferlichter in den Abendstunden von Baum zu Baum.
Über die Wipfel fegte der Lichtstrahl die Böschung hinab in die Weiten des Niemandslandes des morastigen Unterholzes. Ich glaubte mich an diese Landschaft zu erinnern. Schließlich hatte ich dort wichtige Jahre meiner Kindheit durchlebt. Aber was mir bleibt, ist sentimental und verschwommen, eine heimatlich verdichtete Atmosphäre mehr als ein präzises Gedächtnis. Schweigen. Grabes-Stille.
Gleichwohl suchten meine Pupillen die ehedem grabentiefe Frontverläufe; Gesinnungsgrenzen zwischen kapitalistischer wie kommunistischer Hegemonie – und das nicht nur für mich. Spannend, ja richtig prickelnd aufregend waren solch abgründige Frontabschnitte, Gesinnungsgrenzen. Atemnot. Unvorstellbar, wie hier Menschen systematisch wie Hasen über das Niemandsland gejagt, erschossen wurden.
Zur eigenen „Sicherheit“ hatte ich mir von meiner Eisenbahner-Kinder-Uniform die rote Schaffner-Mütze aufgesetzt, auch eine Trillerpfeife, gar eine Signalkelle umgehängt. Kinder-Fantasien als eine Kopie der Wirklichkeit, der Welt der Erwachsenen. Auch ich fühlte mich als Grenzer – ein Grenzer ohnedies.
Dabei konnte das Leben im Sperrgebiet einsam, still, sehr einsam sein. Nichts zum Spielen, keine Kinder, keinen Kumpanen, gar nichts. Langeweile. Dafür atmete ich eine unheimliche, fortwährende innewohnende, gespenstige Ruhe ein. Hier und nur hier erspürte ich die Metaphorik eines Satzes, der mich ein Leben lang begleiten sollte.
„Mit jeder Grenzüberschreitung nähert man sich dem Tod.“ Der war nicht nur in Hötensleben, der war mir später überall gegenwärtig. Es sollte noch Jahrzehnte dauern, bis ich mich als Grenzgänger begriff – eben als einen Reporter, der überall und nirgends Grenzen überschritt, Grenzen verletzte, ebnete, Ich-Grenzen, Schmerz-Grenzen ausprobierte.
Hunger trieb die Menschen unten auf dem Markt mit ihren Bollerwagen und Brotkörben nach dem Krieg umher. Ein halbes Pfund Butter kostete 100 Mark auf dem Schwarzmarkt. Im einstöckigen Fachwerkgemäuer aus dem 19. Jahrhundert lebte ich mit zwei Frauen – besser gesagt mit Mutter und Großmutter. Mein Vater, ein Handelsvertreter namens Otto Friebel (*1903+1983 ), hatte mich im Jahre 1948 gezeugt. Als sogenannter eingedeutschter Nachfahre eines italienischen „Barons“ mit Land- wie Schlossbesitz in Umbrien empfahl er sich vornehmlich der Kleinbürgergesellschaft. Meiner Mutter sollen vor Liebes- und Lebensglück Tränchen gekullert sein. Keiner mochte es glauben, allesamt waren sie aber leichtgläubig einem Hochstapler aufgesessen. Wenige Monate später verschwand er über Nacht auf Nimmerwiedersehen. Alimente zahlte er nicht. „Wer überall zu Hause ist, haust nirgendwo“, war offenkundig seine Lebensmaxime. Seinerzeit waren Briketts bekanntlich knapp, das Abendlicht rar und unter den Bettdecken angenehm warm. Zwischenlager.
„Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft“ 15nannte der Frankfurter Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich (*1908+1982) ein bereits 1963 veröffentlichte Standard-Werk über deutsche Erosion, den Niedergang alter Familienstrukturen. Ich war solch ein vaterloses, unerwünschtes, halbwegs geduldetes Kind im Nachkriegsdeutschland – ein Bastard, Bankert, Niemandskind, Hurenkind. Es sollte nahezu zwei Jahrzehnte dauern, bevor Vorurteil und Vernunft in der Reform des Unehelichen Rechts im Jahre 1968 ein Stück Gerechtigkeit widerfuhr; der Gleichstellung ehelicher mit unehelichen Kindern.
Am Markt 6 – unserem Haus – war alles niedrig und dicht gedrängt. Wir hatten zwei Zimmerchen mit schmalen Innenraum, eine selten gelüftete Kammer, winzige Küche, ein giftgrün bemalter Kabuff als Wasserklosett auf dem Hof, Badewanne gab es nicht. Auf dem Hinterhof hausten in durchnässten Verließen, Ställen zusammengepfercht durchgängig 30 Flüchtlinge. Kein Wasser, kein Klo, kein Licht – praktisch nichts. Die Freiheit. Oft in der Nacht schlich meine Großmutter mit Frauen aus der Nachbarschaft an der Demarkationslinie entlang zum russischen Sektor. Herzklopfen. Sie klauten Kohle von streng bewachten Waggons. Sie nahmen neu angekommene Flüchtlinge aus dem Osten in Empfang – mit nach Hause, in die Ställe auf den Hinterhof. Sie gab elternlosen Mädchen Obhut, egal, ob sich die Väter wieder nach England oder Süditalien davongestohlen hatten. Sie kamen wie Kartoffelkäfer über die Felder und verschwanden wieder. Keiner konnte sie stoppen.
Wir zählten die Jahre Mitte der Fünfziger. Damals sahen die obligaten Anstands-Regeln für Sonntage nach dem Mittagsschläfchen Familien-Spaziergänge oder auch mehrere Rundgänge auf dem Marktplatz vor. Viel mehr hatte das Städtchen wohl auch nicht zu bieten. Gesehen und gesehen werden, wenn nötig, zwei- oder dreimal auf der Promenade vom Rathaus bis zum Schloss rauf wie runter. Galt es doch Sonntag für Sonntag wohlbedacht die Hüte zu ziehen, Verbeugung hier wie dort, spärlich nicken, wenn der Chef kommt, tiefer bücken. Unbeirrte Artigkeiten nach Verbrecher-Zeiten.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Keine Zeit für Wut und Tränen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Keine Zeit für Wut und Tränen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Keine Zeit für Wut und Tränen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.