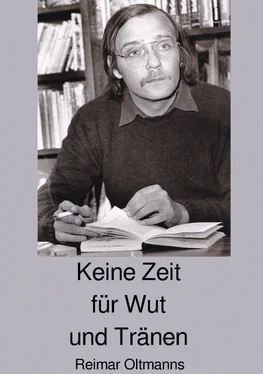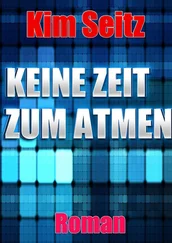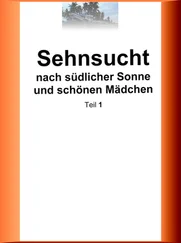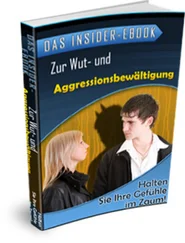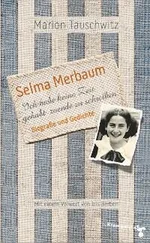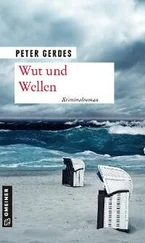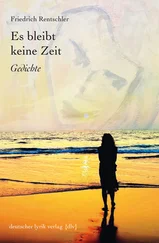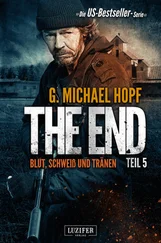Ich war und bin ein Linkshänder, der nun auf einmal alles mit der rechten Hand zu schreiben hatte; ein junger Bub, der von einer latenten Lese- wie Rechtschreibschwäche begleitet wurde, statt „ei“ immer und immer wieder „ie“ vorlas; zur allseitigen Belastung seiner Klassenkameraden. Außenseiter. Jeden Schul-Vormittag vor der großen Pause packte Grunwald sein Frühstücks-Brot aus. Er verteilte tagein, tagaus, Schnitten an seine hungernden Jungen wie Mädchen. Auch den Begriff Solidarität kannten wir damals noch nicht.
Ich lernte in Schöningen aber sehr schnell und nachhaltig für mein Leben: einer für alle, alle für einen. – Heimatgefühl oder auch das, was ich dafür einstweilen gehalten habe.
„Heimat“, schrieb der Philosophie-Professor Christoph Tücke 12, in einem Essay über die Rehabilitierung dieses Begriffs, „ist ein deutsches Wort, das sich nicht umstandslos in andere Sprachen übersetzen lässt. Heim, Haus, Schutz, Sesshaftigkeit schwingen da mit. … Heimat ist, wo man zu Hause, geborgen, mit allem vertraut ist. Heimat ist keine heile Welt. … Heimat – das sind gleichsam Ausdünstungen, Lärm und Laute, Farb-Kolorierungen, Architektur, Tradition und Sprache. Erst „in der Fremde erfährt man, was die Heimat wert ist“, resümierte der Romancier Ernst Wichert (*1831+1931) 13.
Ich erinnere mich noch sehr genau an den alten andächtig daliegenden Staatsbahnhof, damals ein Kernstück dieser Stadt; irgendwie schon das Tor zur Welt sozusagen. Das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert mit seinen geduckten Giebeldächern, üppigen Buchen auf dem Vorplatz mit Uhranzeiger auf dem Bushalteplatz und dem schwarz-weißen Ortsschild Schöningen für die Züge nach Jerxheim und irgendwo – diese zweigleisige Bahnstation war ein ruhender Pol, Ankunft und Aufbruch in einem. Hier jedenfalls kamen alle an in welchen Epochen auch immer – zusammengeschossene Kriegsgefangene, ausgemergelte Flüchtlinge, verwirrte Mütter mit ihren Kindern, seelisch Kranke, behinderte Menschen vom Ersten, vom Zweiten Weltkrieg, vom Kalten Krieg.
Sie alle quetschten sich mehr oder minder durch den schmalen, gesichtslos erkalteten Flur in die Freiheit oder das, was sie für Freiheit hielten. Diese kleine, unscheinbare Bahnstation war in ihrer weit gefächerten oft verwirrenden Wahrnehmung alles oder nichts. Abschied, Trauer, Hoffnung, Neubeginn. „Hier ist Schöningen, der Eilzug aus Helmstedt erhält Einfahrt auf Gleis eins. Der Zug endet hier.“ Endstation. Ein Bahnhof, der Jahrzehnte später zu einem verklärten Mythos gedieh. Mit dieser zweigleisigen Haltestation war eine bemerkenswerte patriotische Gefühlshingabe verbunden. Seine Gleise, Gebäude legten deutsche Ersatzhandlungen frei, die früher in den Strophen des Deutschlands-Liedes zu finden waren.
Damals knipste Eisenbahner Klaus Hoffmeister (er spielte des Sonntags Fußball bei Schöningen 08, linker Außenverteidiger zu glanzvollen Zeiten) all die Fahrkarten in seinem Kontrollhäuschen. Als ich einmal von ihm als siebenjähriger Bub mir eine Fahrkarte nach Jerxheim entwerten ließ, war ich stolz wie Oskar. Ich spürte in mir zum ersten Mal offenkundig das, was sich Fernweh nennt. Als ich im Jahre 2009 den zugesperrten Bahnhof mit seinen Abstellgleisen wieder in Augenschein nahm, da wurde ich stumm. Nein – in solch einem baulichen Verfall an diesem Ort – „hier ist Schöningen, bitte aussteigen, der Zug endet hier“ – das darf und kann nicht wahr sein. Mit der Schließung des Bahnhofs hat man meinem Schöningen kurzerhand ein Stück seiner Seele genommen. – Das Städtchen atmete provinziellen Mief. Fernweh.
Allenfalls der alljährliche Rummel in diesem Städtchen zwischen den Ost-West-Welten verlockte im Nachkriegs-Deutschland zu Aufbruchsstimmungen. Eine befreiende Ausnahme. Alle wollten beim Jahrmarkt dabei sein, Dreck wie Elend vergessen machen – Budenzauber, Spielmannszüge, Kneipengesänge, trunkenen Raufereien. Dabei reicht es vielen schon, sich mit selbst gebranntem Fusel zwischen Schießbuden und Karussells die Hucke volllaufen zu lassen. Genugtuung. Keine Kraft zum Feiern. Der Suff – eine einzige Quälerei.
Die Menschen kamen von weit her mit eigenen Mopeds, frisierten Motorrädern oder sogar in kleinen Autos. Mit Rene Carols (*1920+1978) Gassenhauer „rote Rosen, rote Lippen, roter Wein“ schnalzten und schmachteten gekrümmte Gemüter dieser Jahre nur so dahin. Gelegentlich durfte auch ich mit meinen 50 Pfennig ein Karussell besteigen, auch Eiskugeln schlecken. Meistens verfolgte ich Budenzauber, Jubelklänge des Spielmannszugs „Rot Weiß“, Tanz und Jux an der Achterbahn, Raufereien, Kneipengesänge oben im ersten Stock vom Fenster – mein Logenplatz.
Meine Großmutter hatte nach dem Krieg ihren vierten Mann zu sich in ihr Haus geholt. Sie war eine sehr lebendige, zuweilen wilde Frau. Sie hatte eine Menge heimlich gelebter Männer-Geschichten bereits hinter sich gelassen und war infolge dessen ihrer Zeit weit voraus. Sie könne und wolle nicht allein sein und könne auch nicht nein sagen, wenn Männer sie nach Sex fragten, beteuerte sie zuweilen ganz beherzt. Ob sie jemals in ihrem Leben die „wahre Liebe“ gefunden habe, darauf konnte sie mir auch im hohen Alter keine Antwort geben. „Was heißt schon wahre, große Liebe“, entgegnete sie mit einer Gegenfrage.
„Papa“, wie sie ihren Mann Nummer vier nannte, wurde geheiratet. Vielleicht hat sie sich von ihrem „Papa“ Sicherheit versprochen. Schließlich war er ja in früheren Jahren für die Stempelgelder beim Arbeitsamt in Braunschweig zuständig. Eben eine Vertrauensperson, ein deutscher Kleinbürger mit Beamtenstatus. „Papa“ – Hans Hoff war ein sturer, kauziger Zeitgenosse von dickbäuchiger Gestalt. Er trug stets ein Jackett, an dem die ausgebeulten Seitenschlitze auf seine Extras der „Eigenversorgung“ auffällig hinwiesen; Würstchen, Frikadellen, Jagdwurstscheiben in Hamstertaschen – griffbereit.
Auf sogenannte Hamsterfahrten zu den Bauern im Umland war er häufig, fast täglich unterwegs. Er tauschte Pelze, Besteck oder auch Schmuck gegen Kartoffeln, Eier und Schinken, mauschelte um Preise, Schwarzmarkt-Preise. Vielleicht hat er auch seine Moral auf dem Schwarz-Markt verhökert? Keiner wusste es, keiner wollte es wissen. So manche Hungertoten säumten damals Ausfallstraßen zu den Rübenfeldern in Jahren des Elends.
Wenn der „Papa“ etwas zum Besten gab, war seine Tonlage grob. Grundsätzlich redete er nicht viel. Er muss es wohl geahnt haben, dass Hans Hoff in diesen Frauen-Haushalten mit ihren vielen unter zu bringenden Flüchtlingsfamilien der „Hanswurst“ war. Eine Randfigur. Er verbreitete das Fluidum vom traurigen, alten Clown. Teilnahmslos schlurfte er in seinen Hausschuhen mit Hacke und Wassereimer über den Markt zu den Schrebergärten. Hauptsächlich hockte er beinahe apathisch in der guten Stube, paffte Zigarren um Zigarren. Kein Ton, gelegentlich knackte eine Bockwurst direkten Weges aus der Jackettasche in seinem Kiefer.
Einmal in der Woche, das war sein Höhepunkt, ging es zum Pferderennen nach Braunschweig. Mal soll er bei den Rennwetten sogar etwas gewonnen haben. Mal. Fast immer gingen die Mieteinnahmen des Hauses meiner Großmutter drauf. Sie hingegen hielt unbeirrt zu ihrem Papa; gestand sie mir, er sei der erste Mann in ihrem Leben gewesen, der sie nicht geschlagen habe. Und das will schon was heißen in all den Jahren, in denen Männer ihre Ehefrauen wie nach einem „Naturgesetz“ abstraften, prügelten, erniedrigten je nach Belieben.
Ihr erster Mann, mein Großvater August Köhler, hatte es sogar in einem Anfall des Jähzorns fertiggebracht, ihr Kätzchen Mimie aus Eifersucht ins offene Feuer des Küchenherds zu werfen. Eines schien schon damals gewiss, obwohl ich als junger Bub allenfalls eine Vorahnung davon haben konnte. Ich wurde in einer zerrütteten oder auch zusammengewürfelten Familie groß, die nie eine glückliche Stunde erlebt hat oder auch erleben sollte.
Читать дальше