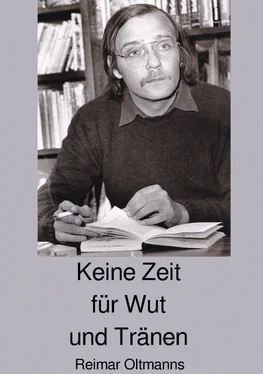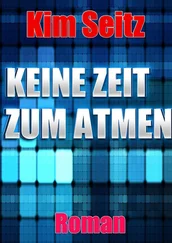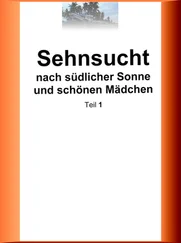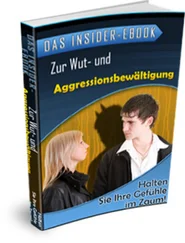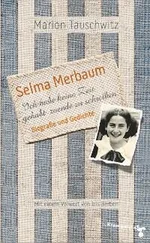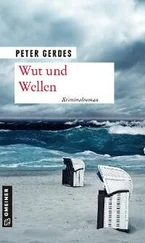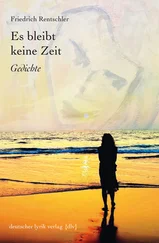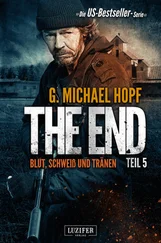So manche Journalisten aus meinem Umkreis blieben auf der Strecke, hielten den tagtäglichen Druck nicht stand, wurden als „Betriebsunfälle“ abgebucht. Sie soffen sich zu Tode, sprangen aus dem Fenster, verschwanden monatelang von der Bildfläche, kratzten sich Pulsadern auf, landeten in der Psychiatrie, erstickten im eigenen Kot. Oder sie waren vom Konkurrenz- oder Leistungsdruck Getriebene, auf Kriegsschauplätzen ferner Länder – gejagt, erschossen. Ihre Leichen geben zumindest so viel her: eine hautnah bebilderte Illustrierten-Story, auch im TV-Format. Ein Leben für ein Leben. Klappe zu.
Jean Amérys Diskurs über den Freitod 8fand ich die bemerkenswerte Passage: „Es ist, als stieße man eine sehr schwere, in den Angeln ächzende, dem Druck widerstrebende Holztür auf, um ins Helle zu gelangen, Man wendet all seine Kraft auf, tritt über die Schwelle, erwartet nach dem Dämmergrau, in dem man stand, das Licht: stattdessen aber ist es nunmehr eine ganz undurchdringliche Finsternis, die einen umgibt. Verstört und angstvoll tastet man um sich, erfühlt Gegenstände da und dort, ohne sie identifizieren zu können. Sehr langsam gewöhnt schließlich das Auge sich ans Dunkel …“.
Hamburgs Totenacker Ohlsdorf, der größte Park-Friedhof der Welt mit 235.000 Gräbern, war längst zu einem ungewollten Ort vergessener Evergreens geworden. Trauer. Melancholie. Immer wieder galt es für die Verlagsspitzen Nino Rossos (*1926+1994) „Il Silenzio“ oder Fabrizio de Andrés (*1940+1999) „Andrea“ als Abschiedsmelodie an den Gräbern intonieren zu lassen. – Ein bisschen Nostalgie, viel Wehmut, Tränen über Tränen, Legenden über Legenden, Abschiedszeremonien. Alle hatten sich mit dem Tod einst erfolgreicher, vieler nahestehender Kollegen abzufinden. Und zur Abfindung aus dem Arbeitsverhältnis gab es einen Beileids-Scheck der Konzernspitze für die Hinterbliebenen. Schweigen. Seelen aus Holz.
Jahrzehnte saß ich in Zeitungsredaktionen ein. Die längste Zeit verbrachte ich in einer schmalen mit grau getönten Magnet-Wänden ausgestatteten, klimatisierten Zelle – den beschaulich weitläufigen Blick auf die Hamburger Außenalster inbegriffen. Wehmut nach Freiheit. Damals, als ich anfing, glaubte ich noch an den „Marsch durch die Institutionen“, an größere soziale Teilhabe vieler an dem unverschämten Reichtum in diesem Land, auch an Chancengleichheit in der Bildungspolitik; überhaupt an den gesellschaftspolitischen Veränderungswillen, an die Offenheit eines kritischen Dialogs, an meine und an die Lernfähigkeit anderer. An Menschlichkeit. Als ich dann aufhörte, besser gesagt ausstieg, war ich nicht resigniert. Vielmehr ging mir immer und immer wieder ein Satz durch den Kopf, der mich seither begleitet: „Das kann doch nicht alles gewesen sein.“
Misstrauen, Hab-Acht-Stellungen waren zu meinen Wegbegleitern geworden. Doppelrollen, Doppelbödigkeiten, Doppelspiel – überall. Die authentischen, tatsächlichen Biografien erschreckten jeden, der von ihnen erfuhr. Ein Reporter-Kollege für die Dritte Welt, der bei mir ständig freundschaftlich ein und ausging, war in seinem früheren Nazi-Dasein KZ-Kommandant. Der Nachbar von nebenan lieferte regelmäßig Berichte, Eindrücke, Befindlichkeiten ans Ostberliner Ministerium für Staatssicherheit nach Ostberlin. Der Freund aus Prag entpuppte sich in späteren Jahren als Agent der Geheimpolizei StB. Die Zimmer-Nachbarin in Bonn mauserte sich zur Liebesdienerin eines Bundeskanzlers.
Unbemerkt war mir mein Lebensrhythmus, mein ureigenes Lebensgefühl genommen, umgepolt worden. Ganz allmählich begann zudem die Technokratie-Elite der westlichen Welt, den Mensch zu entmenschlichen, die Demokratie zu entdemokratisieren und die viel zitierten Politiker zu entpolitisieren.
Wir leben in der Gegenwart in einer atemberaubend flüchtigen wie auch gehetzten modernen Zeit. Die Konsumgesellschaften, das materielle Verlangen weisen dem Menschen die Rolle zu, einzig und allein ihrer Befriedigung nachzujagen. Im Blickfeld rückt nicht etwa eine postmoderne Moral, Verantwortung, Daseinsfürsorge, allenfalls das geschmeidige Wohlgefallen eines Markenartikels. Das Behagliche, das Bequeme wird nur deutlich, wenn das Nutzlose in den Mülleimer fliegt. Und Weggeworfen, aussortiert wird in dieser Wegwerfgesellschaft gedankenlos, rücksichtslos.
Mich hatte das Grundgefühl eines sterilen, stereotyp vorbestimmten Lebens erfasst. Auch die scheinbar unabdingbare Einsicht, dass ich mich dieser technologisch-digitalen Diktatur zu beugen habe, löste in mir tiefe Verbitterung, Ohnmachtsgefühle, Resignation aus. Das war eben nicht der Stoff, die Konfliktfelder, aus denen meine Träume, Hoffnungen, Ziele waren. Menschen, denen ich unterwegs begegnete, wurden dabei zu Figuren, Leute zum >Anmachen<, >Ausquetschen< und >Abmelken< auf die harte, mal auf die weiche Tour. Warum sie an die Öffentlichkeit gingen, ihr Leid, ihr Schicksal oder auch ihre Ängste schilderten – das war im Prinzip nebensächlich. Was zählte, war die Geschichte, die andere „vom Stuhl reißen“ sollte. „Output“ hieß das in der Redaktion, Zeile um Zeile, Story um Story, Auflage um Auflage, Profit um Profit.
Dabei gab es von außen betrachtet nicht einen wesentlichen Grund, larmoyant Klage zu führen, innere Befindlichkeiten kokett zu kultivieren. Im Gegenteil: Ich verdiente gut, Sportwagen, Jet-Set-Journalismus, Luxus-Hotels, an vielen Airports wartende Mädels.
Ehefrauen wurden unter Stuck verzierten Decken mit Gobelin-Wandteppich im Altbau zu Hamburg abgestellt, Boutiquen-Einkäufe inbegriffen. Heute hier, morgen dort – Paris, Rom, New York, Buenos Aires, Nairobi … Wir durchlebten eine Ära in diesem Journaille-Milieu, in der das Zusammensein offenbar nur eine Faszination freisetzte, kannte, duldete, immer erneut speiste. Vordringlich galt es den Bedeutungsdrang zu füttern, Selbstbespiegelung zu schärfen und natürlich Triebe zu befriedigen. Über Sex wurde fortan geredet, getuschelt, gelispelt. Die Lust galt es zu entblößen, die Wichtigkeit heraus zu kitzeln, die Libertinage zu durchleben – Promiskuität der leisen Lagen – Tonlagen.
„Sie alle hielten sich für Persönlichkeiten der Geschichte, für öffentliche Größen, nur weil sie ein Amt hatten, weil ihre Gesichter durch die Presse liefen, denn die Presse will ihr Futter haben, weil ihre Namen durch den Äther sprangen … Und wenn die Welt auch nicht viel von den beamteten Weltgeschichtlern hielt, so raschelten sie doch ständig mit ihnen, um zu beweisen, dass der Vorrat an Nichtigkeiten und Schrecken nicht erschöpft, dass Geschichte noch immer da sei.“ So gedacht, so formulierte der Schriftsteller Wolfgang Koeppen (*1906+1996) in seinem bereits 1953 erschienenen Buch „Das Treibhaus“ Sein und Schein der Politiker-Klasse in der Bonner Republik 9. Diese Koeppen Aphorismen galten letztendlich so manchen kritischen Antriebsfedern in Bonn, nunmehr in Berlin wie auch anderswo.
Ich blickte hinter die Fassaden des neureich erkalteten >Machertums<, war ich doch über lange Strecken ein Teil jener Männer-Kulisse. Ich hatte damals schon das Gefühl, dass der Kampf zwischen Männern und Frauen mehr war als ein Geschlechter-Kampf, wie er wohl immer noch dort zu beobachten ist, wo Männer sich in ihren angestammten Positionen bedroht fühlen. Es schien mir so, als würde sich mit den Frauen ein neues kulturelles Gesellschafts-Verständnis durchsetzen, als ginge hierum der eigentliche Kampf zwischen den routinierten Alleskönnern und Frauen neuer Nachdenklichkeit.
Es war der Sozial-Philosoph Jürgen Habermas , der von einer zunehmenden Entkoppelung von System und Lebenswelt sprach. Aus dem System der verwalteten Welt gliedere sich nicht nur die Lebenswelt aus; innerhalb dieses Systems erfolge zudem ein Substanzverlust des Politischen; Politik in einem ernst zu nehmenden Sinne sei in Basisinitiativen und neuen sozialen Bewegungen zu finden.
Читать дальше