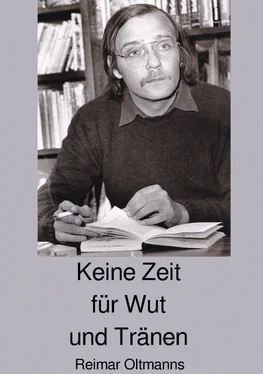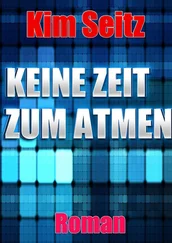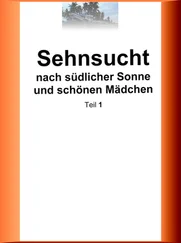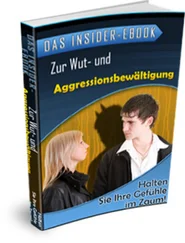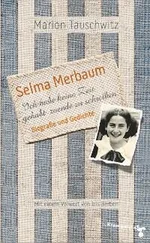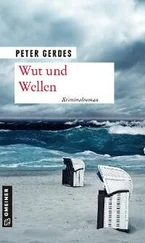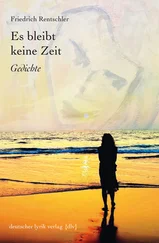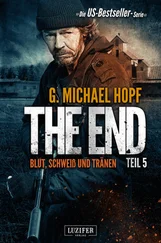Stille ist mehr als die Abwesenheit von Geräuschen, schrieben Uli Hauser und Stephanie Brinkkötter 2: „Wer der Sehnsucht nach Stille nicht folgt und sein Unwohlsein stattdessen damit tröstet, dass die Anspannung eines Tages wohl nachlassen wird, braucht den großen Knall, um wach zu werden.“
Alte, ehrwürdige Bäume am malerischen Wegesrand gedeihen unerwartet zu Schnittstellen zwischen Vergangenheit – der Gegenwart. Lang gehegte Träume, scheinbar verstaubte Ideen, unerledigte Begegnungen treten urplötzlich zwischen Bäumen entlang der pittoresken Wege aus dem Unterbewussten ganz unerwartet ans Tageslicht. Sie markieren, ob wir wollen oder auch nicht, die Vergänglichkeit. Grenzen zwischen Leben und Tod. Furcht vor dem Nichts? Die Zeit rast in Windeseile. Verschlungene Jahre drücken aufs Tempo, pressen die Gemüter bis zur Unkenntlichkeit. Melancholie des Augenblicks? Heimweh nach dem Traurig sein? Was uns am Ende festhält, überleben, weiterleben lässt – das ist ein engmaschiges Netz aus Erinnerungen.
Gedächtnis, Gedenken – an wen? Ganz plötzlich, ganz unvermittelt fallen mir Personen, die mich in meinem Leben begleitetet haben; ganz gleich, ob ich sie persönlich kannte oder sie mich durch ihre Reflexionen oder Literatur mit auf ihren Lebensweg nahmen. Ich denke an den Bänkelsänger Franz-Josef Degenhardt (*1931+2011) – „Ich möchte Weintrinker sein“. Ich entsinne mich an den Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter (*1923+2011) – „Flüchten oder Standhalten“. Mein Langzeit-Gedächtnis verweilt bei dem unvergessenen Schriftsteller Heinrich Böll ( * 1917+1985) – „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“.
Meine Erinnerungen begleiten den ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler im Nachkriegs-Deutschland Willy Brandt (*1913+1992). Er war auch für mich zu Beginn der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts eine Vater-Figur im deutschen Durcheinander. Nur – sie alle waren nicht mehr, haben mich jählings verlassen. So empfand ich ihren Tod, fühlte ich mich von ihnen auf dem Friedhof zu Schöningen allein gelassen; für Momente auch verraten. Verlassenheit. Meine Rückbesinnung verweilt für Augenblicke bei Peter von Oertzen (*1924+2008).
Er war ein brillanter Gesellschaftstheoretiker, Bildungspolitiker, auch Gerechtigkeitsfanatiker. Für ihn formulierte ich Reden und Pressetexte, ging mit ihm ein Stück des Weges. Peter von Oertzen scheiterte – war seiner Zeit weit voraus. Programm-Vordenker.
Vieles ist gesagt, geschrieben worden in all jenen Jahren der Wissbegierde. Fast alles ist gesellschaftlich abgegrast, gewagt worden an Provokationen, Regelverletzungen. Kaum ein gesellschaftliches Tabu dümpelt noch vor sich hin. Kaum einer hört noch hingebungsvoll zu. Gemeinsam erlebte Langeweile. Nahezu alles mündet in schnelllebigen Duplikaten der Billigheimer-Industrie. Zu selbstverständlich scheint sich alles in dieser funktionalen Welt auszunehmen. Selbstverständliche Grenzüberschreitungen signalisieren Fernweh, das sich oft im Zeitlupentempo als Heimweh zu erkennen gibt. Nur welches Heimweh lauert da? Mit meinen eng umzäunten Wurzeln fühlte ich mich an den Grenzpfählen ein wenig im Exil – fremd im eigenen Land.
Nur wo sind eigentlich unsere Hoffnungen, Sehnsüchte, Verheißungen, Perspektiven geblieben? Wo? Sie beeinflussten uns Jahrzehnte, bestimmten unser Verhalten, unsere Lektüre, unsere Diskussionskultur. Utopie – ist zu einem lieblosen Unwort geworden. Es wird kaum noch benutzt, ist praktisch aus unserem Leben verschwunden. Kaum einer begreift noch eine Utopie als für sein praktisches Leben erstrebenswert. Sie war auch für uns in unserer oft sperrigen Alltagsbewältigung ein Zufluchtsort, eine Alternative – jedenfalls immer so lange, wie es noch unentdeckte Regionen auf der Erde gab, die wir mit unseren Sehnsüchten in Einklang brachten.
Der Roman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ von Marcel Proust (*1871+1922) 3findet in diesem neuen Jahrtausend seine ungeahnte Fortsetzung. Fernweh entblättert sich zunehmend im Umkehrschluss als Heimweh. Es sind Erinnerungen, die unser Lebensgefühl mit oft diffusen Sehnsüchten nach Heimat und Identität versorgen. Heimat ist so gut wie zu Hause, Architektur, Landschaft. Und das bedeutet für viele nun einmal Heimeligkeit, Kindheit, Geborgenheit – Bezugspersonen, Bezugs- und Geburtsorte. Es sind allseits schleichende Ich-Verluste, die wir Tag für Tag zu erfahren haben. Es sind unsere unweigerlichen Bestrebungen, uns mit unseren Wurzeln in Zeit wie Raum wiederzufinden, anzuknüpfen, aufzubauen. – Heimat.
Meter um Meter näherte ich mich auf dem Todesacker meiner Heimat, meiner Kindheit, meiner Jugend über die breite, altehrwürdige Friedhofs-Allee. Sonnenstrahlen brachen durch das Blätterdach, irgendwie begannen sich meine Erinnerungen aufzuladen. Diese von hohen Bäumen dicht gesäumte, malerisch angehauchte Straße hatte sich in meinem Gedächtnis fest eingegraben. Schon als Kind in den Fünfziger des vergangenen Jahrhunderts harkte ich dort den Kies oder pflanzte mit meiner Mutter Primeln, Efeu, wahrscheinlich auch Zwiebelblümchen auf das Grab meines Großvaters.
Nur als mittlerweile nahezu 70 Jahre alter Zeitgenosse, der ich bin, verhieß der Friedhof zu Schöningen nicht Abschied, nicht Schwermut, keine Reminiszenzen an vergilbte, unwiederbringliche fast vergessene Jahre. Selten ertappte ich mich auf Spuren von Traurigkeit. Jene Grabstätten mit ihrer weichen, duldsamen Atmosphäre luden mich ein zu einer unvermuteten Nähe längst verblichener Epochen, Ereignissen, Erlebnissen. Heimat-Gefühl. Der Friedhof als Zufluchtsort vor Krematorien modern anmutender Zeitläufe.
Dabei ertappte ich mich mit dem Eingeständnis, dass meine Ich-Sehnsucht nach Stille, Frieden und der Gewissheit vor dem Tod vornehmlich einer Bestätigung nachhing – mich als einzigen Mittelpunkt des Lebens vor den Gräber-Verzierungen abzuheben, abzugrenzen, abzuschotten. Es ist landauf, landab ein vielerorts eingeübter, ungestillter Narzissmus – ein Überlebensgefühl, das sich als ein Antlitz meiner Epoche einzuschleichen verstand. Ich schaute über die scheinbar messerscharf gemeißelten, oft im Planquadrat geschnittenen Steinplatten und wanderte mit meinen Gedanken an die Grabstätte von Thomas Bernhard (*1931+1989) 4auf den Grinzinger Friedhof in Wien. Dort hatte ich dem wichtigsten Autor deutscher Sprache in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Gruppe 21, Reihe 6, Nummer 1 ein befreiendes Andenken gewidmet. Hatte er bezeichnender Weise geäußert: „Es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt.“
Auch die das Leben umspannende Dramaturgie des britischen Literatur-Nobelpreisträgers T.S. Eliots (*1888+1965) von „Geburt, Koitus und Tod“ charakterisiert „das Schreiben als Versuch, sich den Tod vom Leib zu halten“. Insgeheim dürfte es wohl keinen Autor geben, der sich nicht des Zusammenhanges zwischen dem Schreiben und der nagenden Ängstlichkeit vor dem Tode bewusst ist.
Gerade hier, auf meinem Heimat-Friedhof zu Schöningen, musste ich wieder an den österreichischen Literaten Thomas Bernhard denken. Er hatte vor langen Jahren einmal die Achillesferse oder auch fortwährende Ego der Schriftsteller lokalisiert. Demnach ist für viele, unzählige Autoren das Schreiben nichts wesentlich anderes, „als ein verzweifelter Kampf gegen die eigene Vergänglichkeit, ein beharrlicher, aber vollkommen kindischer Versuch, den Tod zu überlisten, um etwas Ewigkeit zu erlangen…“.
Zusehends unruhiger verloren sich meine Blicke an irgendwelche Grabsteine im Irgendwo – schemenhaft, endlos. Ich kramte in meiner Umhängetasche nach dem Notizblock. Ich wollte die ängstlichen Augenblicke, die Furcht vor dem verflossenen, dem hastig entglittenen Leben notieren, bevor sich meine Erinnerung so schnell, wie so oft, verflüchtigen. „Der Augenblick“, schrieb Robert Musil (*1880+1942), „ist nichts als der wehmütige Punkt zwischen Verlangen und Erinnern“.
Читать дальше