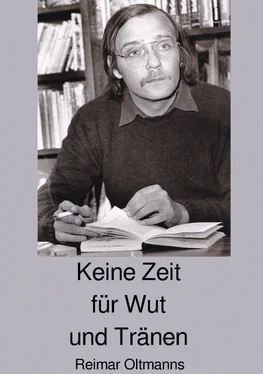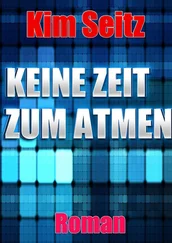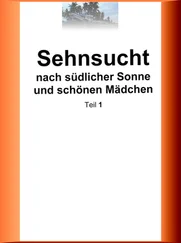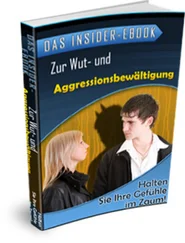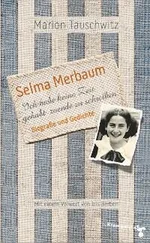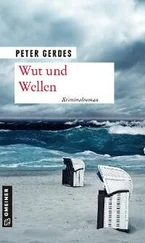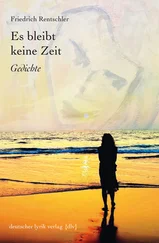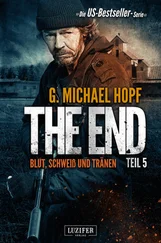Apropos Notizblock, später Tonbänder – sie waren über Jahrzehnte meine Wegbegleiter. Der Satz, das Credo von Egon Erwin Kisch (*1885 +1948) 5des bedeutendsten Reporters in der Geschichte des Journalismus – der war für mich zur Lebens-Maßgabe geworden. „Schreib das auf, Kisch!“ nannte er seine im Einband-Buch edierten Tagebücher aus dem Ersten Weltkrieg von der russischen Front. Junge Menschen brauchen Vorbilder; junge Journalisten, die sich der Wahrheit, Wahrhaftigkeit verpflichtet zu glauben wissen, erst recht. Egon Erwin Kisch, jüdischer Herkunft, zunächst österreichischer- ungarischer, sodann tschechoslowakischer Staatsbürger – dieser „rasende Reporter“ war für mich eine solche Leitfigur – eben die investigative, unbestechliche Hintergrund-Recherche im von Show-Effekten gejagten Infotainment dieser Jahrzehnte.
Im Deutschen gibt es kein Äquivalent für den Begriff Grand Reporter, der in Frankreich eine große gelebte Tradition hat durch Reisende, Augenzeugen; Reporter, die auf höchstem literarischen Niveau, aber mit Engagement und Bestimmtheit Zeugnis ablegen von den Krisen in uns, beim Nachbarn, im Land und der Welt.
So reiste ich als Reporter oder auch als teilnehmender Beobachter mein Leben lang mit besagten Notizblock durch die Lande, durch Deutschlands Metropolen wie Provinzen – flog zu anderen Kontinenten, tauchte irgendwo anders in Landstriche ein. Innenansichten. Immer war ich auf der Suche nach Aufbruch und Hoffnung, Spontaneität, Umbruch, Erneuerung, Menschlichkeit, Mitgefühl und Mitempfinden, Anteilnahme – auf der Suche nach Nähe, nach menschlicherem Umgang des Miteinanders.
Oft, allzu oft wurde ich konfrontiert mit Gewalt, Tod, Folter, Unterdrückung, Ausgrenzung, Diskriminierung, Armut – verzweifelten, hilflosen Gesichtern; auch mit Charaktermasken, Karrieristen, deren Bilder sich wie Fratzen tief in meinem Gedächtnis eingegraben haben. In vielen Ländern des materiellen Wohlstands schien das Gewissen ausgebürgert, ausgewandert zu sein. Viele Dinge machen arm. Ich begriff sehr schnell, dass ich nur eine Heimat habe: meine deutsche Sprache.
Nach so manchen Erkundungs-Fahrten als Reporter deutscher Magazine wurde es mir vor der eigenen Haustür, dem Land meiner Väter, fremd, fremder – unnahbarer, kalt. Fremd im eigenen Land. Fremd im linkischen Verhalten versteckt angedeuteter Gesten, fremd in der Art und in Diktion der Wortführung, fremd beim unaufhörlichen Finassieren; selten ein Lächeln, kaum eine entspannte Lebensart. – Die Deutschen. Die offenkundige Spaltung der Gesellschaft zerfrisst das Miteinander.
Die Gesellschaft sei „vergiftet“, befand Sozialwissenschaftlicher Wilhelm Heitmeyer in seiner über zehn Jahre währende Langzeitstudie. 6Das ehedem vornehmlich gepriesene Bürgerliche reduziert sich zunehmend auf das zähe Anwachsen gesellschaftlicher Besitzstandswahrung. Ich beobachtete, ich erlebte die viel zitierte Enge der Bourgeoisie. Ich schien mich in ein engmaschiges Milieu verlockender Freiheitsansprüche zu begeben. Nur die Wirklichkeit, das soziale Umfeld insgesamt, erzeugte unabdingbare Gebote – Zwangscharaktere. Dort, wo gesellschaftliche Normen Alltäglichkeiten diktieren, sind kleinbürgerliche Eigenschaften nahe, auffällig dicht beieinander. Sein Habitus kennt viele Gesichter und so mancherlei Gemeinsamkeiten, die sich aus Feigheit, Spießertum wie Raffgier speisen.
In den vergangenen achtziger Jahren lebte ich in Frankfurt am Main, auch als Bankfurt, Zankfurt, Krankfurt als zerrüttete Metropole apostrophiert. In jenem Jahrzehnt war ich viel mit der Eisenbahn unterwegs, meist gen Bonn – der damaligen Bundeshauptstadt. Wie heute kann ich mich an unvergessene, romantische ICE-Fahrten entlang des Rheins entsinnen; vornehmlich an den hohen steil aufragenden Felsriegel der Loreley, der sich dem Strom in den Weg stellt. Dort hing ich gelegentlich einer fernen, offenkundig sehr rar gewordenen Eigenschaft nach – dem Lachen, dem Lächeln, der Heiterkeit. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich mich im Anblick der Burg Katz fragte, wo eigentlich die Ursachen dafür zu suchen sind, dass die Schönheit dieser Landschaft weder in den blick-scheuen Augen noch in den einbetonierten Seelen der Bewohner einen Widerhall gefunden haben.
Weltfremd? Vielleicht auch nicht: Das Fremde wird nah, die Nähe dagegen fremd. „Ist die Fremdheit also die paradoxe Signatur unseres Zeitalters“, schrieb die Historikerin Karin Priester 7„das sich rühmt, Grenzen, Distanzen, Zeitunterschiede zu überwinden, Mentalitäten zu verschmelzen, kulturelle Unterschiede nur noch als folkloristische Restgrößen zu erleben und der ‚einen Welt‘ näherzukommen.“
Einem herbstlichen Schäferidyll gleicht mein Friedhof zu Schöningen. Endzeitstimmung überkommt mich, Verausgabungen des eigenen Ichs aus Vergangenem holen mich plötzlich ein. Zeitlupentempo, das nicht weichen will. Klar, sonnenklar scheint die Luft, gletscherblau das Firmament. Über all den Wipfeln ist Ruh. Unter der Erde sowieso.
Ich denke an meinen Jugendfreund – den Dorfschulmeister mit seiner Gitarre. „Testament eines Verkommenen“ hatte er im Anflug seiner Depressionen auf einen Zettel geschmiert, bevor er auf einem Nebel verhangenen Landweg Hand an sich legte. Für ihn gab es keinen Baum geschmückten Friedhof, keinen dauerhaften Grabstein nirgendwo.
Ich denke an meinen langjährigen Journalisten-Kollegen. Aufgerieben zwischen den Kriegs-Fronten im Nahen Osten. Erschossen vor seiner Haustür in Beirut. Nachruf keinen. Friedhof keinen. Ich denke an eine Freundin zu meiner Frankfurter Zeit in den Jahren 1980 bis 1990. Einst hatte sie als erfolgsversprechende, attraktive junge Soziologin „den Marsch durch die Institutionen“ riskiert. Bevor sie sich – aufgedunsen und ausgemergelt – arbeitslos um ihren Verstand in den Tod getrunken hatte.
Viele, sehr viele, ja zu viele verrannten sich in ihrer autonomen Lebensvision, jagten ihren Lebensideen und ihren Lebensgefühlen unablässig hinterher. Zu viele liegen nach nahezu zwei Jahrzehnten später verstreut auf den Friedhöfen des Landes, wenn überhaupt. Aus den Demonstrationen, aus dem Aufbegehren von einst wurden Schweige- oder auch Trauermärsche meist auf den anonymen Begräbniswiesen.
In der deutschen Sprache summen kaum Melodien. Kein Ort nirgendwo. Sehnsucht nach Weltweitweg-Grenzen. Ich fühlte Fernweh und meinte Heimweh. Augenblicke. Heimat ist mir früh genommen worden. Heimjahre mit weggesperrten Kindern folgten. Gewalt an Kindern. Kasernierung wie Sträflinge. Und immer wieder Gewalt mit Knüppeln, Einschlag mit Fäusten in junge, verängstigte Gesichter auf ihrem ohnehin beschwerlichen Weg zu einem ordentlichen Deutschen.
Sehnsucht nach dem Friedhof zu Schöningen? Nein, schon der Klang des deutschen Tonfalls in meinen Ohren beantwortete solch ein Liebäugeln. Diese Schallwellen speisen Herrschaftsinstrumente der Abgrenzung, Ausgrenzung, Entgrenzungen – Sprachgrenzen von Oben und Unten. Es bleiben fremde Misstöne in einem lustfeindlichen, entsinnlichten Lebensrhythmus. „Entfremdung“, schrieb mein Kollege Norbert Klugmann , „geschieht auch in Zehntelsekunden. Ich habe es erlebt. Und sie hält an, man kann dann kaum noch was dagegen machen. Müsste es wohl auch wollen.“ Ich wollte nicht.
In meinen jungen Jahren konnte ich derlei wiederkehrende Fremdheits-Momente übersehen, verharmlosen. War ich doch selbst atemlos, ein vom täglichen Konkurrenz- und Leistungsdruck in Redaktionskasernen deutscher Magazine Getriebener, von leidenschaftlicher Unrast beseelt nicht unter zu gehen, einfach bestehen, überleben zu wollen. Eben ein junger Schreiberling, der in seiner aufklärerischen Besessenheit in vielen, vielen Druckzeilen monomanisch nach seinem eigenen gedruckten Namen fahndete. Einfach deshalb, weil sich eine fett markierte Benennung des Egos in Schwindel erregender Millionenauflage wie ein Lebensdurchbruch, wie eine selbst gestrickte Karriere anfühlte. Trügerisch.
Читать дальше