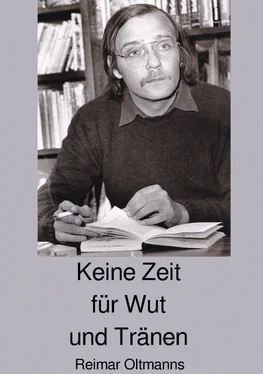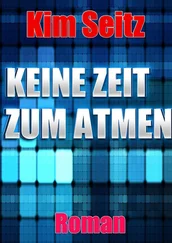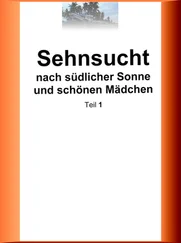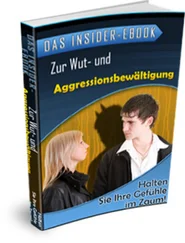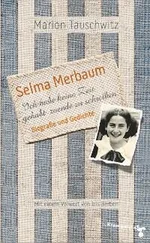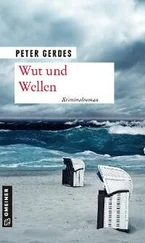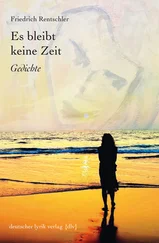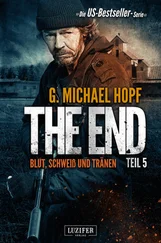Wenn ich nun noch einmal in meinen Notizblöcken blättere, so ließ ich mich von dem Grundgedanken leiten, dass ich über weite Strecken Zeitzeuge, Begleiter eines aberwitzigen Jahrhunderts war. Mein Buch umfasst 60 Jahre – und sechs Jahrzehnte sind kein Tag. – Was ich wollte, was aus mir geworden ist. Innenansichten. Meine Leserinnen und Leser werden unweigerlich Rückschlüsse zu ihrem Leben suchen, Vergleiche anstellen. Sie werden sich auch fragen, welche Fortschritte oder Verbesserungen erreicht worden sind. Fehlanzeigen.
Aber die allerersten Rückläufe gelten mir als Autor. In diesen Zeilen und Betrachtungen öffne ich mich – nicht als Exhibitionist, Voyeur, Exot oder Abenteurer aus fernen Ländern. Ich betrachte mich als einen gesellschaftskritischen Wegbegleiter dieser Zeitläufe. Ich skizziere mein Leben, um Vergangenes, Erreichtes, Verlorenes ins Blickfeld zu rücken. Dabei habe ich es niemanden heimzuzahlen oder offene Rechnungen nirgendwo mit irgendjemanden zu begleichen.
Ich erzähle mein Leben, ich betrachte – auch selbstkritisch – mein Lebensschicksal als symptomatisch für viele Hunderttausende von Menschen der Nachkriegsgeneration. Ich schildere Ereignisse aus meiner Wahrnehmung, Deformationen im deutschen Journalismus, Eitelkeiten und Koketterien in der Politiker-Klasse. Verzagtheit. Ohnmacht. Ich skizziere meine Zeitläufe aus Deutschland, meine Jahre in Italien, Frankreich, Österreich. Ich berichte über meine Reporter-Reisen in Europa, Süd- und Nordamerika, Asien und Afrika. Versager-Ängste. Es ist die Wirklichkeit, aus dem der Stoff für Romane entsteht. Nur mit dem Unterschied – für mich gilt der deutsche Buchtitel des amerikanischen Autors Norman Mailer (*1923+2007) „… und nichts als die Wahrheit“. 10
Als ich Deutschland Ende der achtziger Jahre im vergangenen Jahrhundert verließ, zunächst nach Italien, dann nach Frankreich und letztendlich nach Österreich zog, wollte ich in einen anderen kulturellen Lebenskreis treten, eintauchen und mich neu entdecken. Ich suchte nach Entspannung, höflicheren, freundlicheren, den Menschen direkt betreffenden Umgangsformen als sie im Land meiner Väter gelebt wurden. Ich suchte nach Authentizität. Ich war den selbstinszenierten Stress – das alltägliche Misstrauen der Menschen untereinander, die Hahnenkämpfe, Wichtigtuereien, Statussymbole Leid. Sehr oft, wenn ich von einem langen Auslandsaufenthalt nach Deutschland zurückkam, spürte ich die Verrohung des zwischenmenschlichen Umgangs besonders scharf, war ich der Kälte in diesem Land überdrüssig. Gefühlsverarmung drohte. Ich fror.
Gewiss, gewiss. Gründe dafür gibt es derlei viele und nicht nur solche, die Deutschland zuzuschreiben sind. Wohl keine Zeit, wohl kein Jahrhundert, folgte so bedingungslos niederschmetternd seinem Niedergang; dem Verfall von Moral wie die Zerrüttung unserer Zivilisation. Wohl in keinem Jahrhundert keimten unverhofft zaghafte Träume, Visionen, Zukunftsfragmente, klagte sich das Prinzip Hoffnung ins Alltagsleben der Menschen ein. Vielleicht ein Aufbruch zu einer zaghaft angedeuteten >konkreten Utopie<. Wunschträume?
Da waren die beiden Weltkriege, die systematische Ausrottung von 14 Millionen Menschen in den Hitler-Stalin-Diktaturen, deutsche Orte der Juden-Vernichtung – ihre Befreiung. Es folgten die fünfziger Jahre, Wiederaufbau, Wohlstand, Verdrängung der Nazi-Verbrechen, Unfähigkeit zu trauern, Kalter Krieg zwischen Ost und West, Wiederaufrüstung, Freund-Feind-Denken.
An den Notstandsgesetzen in den sechziger Jahren entzündete sich die Rebellion der Außerparlamentarischen Opposition (APO) gegen die Generationen der Väter. Die bleierne Zeit der Siebziger waren geprägt durch den Baader-Meinhof-Terrorismus, Berufsverbote; Feminismus, Wandel der Liebesmoral, Frauen-Rechte. Die Wiedervereinigung der alten Bundesrepublik mit der nicht mehr überlebensfähigen DDR verdeutlichte, dass die postindustrielle Gesellschaft bereits Wirklichkeit geworden ist.
Auf dem Wege nach Europa folgte die Einführung des Euro als europäische Einheitswährung zu Beginn des zweiten Jahrtausends.
Im neunziger Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts zeichnete sich bereits der Paradigmen-Wechsel, nämlich das Ende der alten arbeitsteiligen Industrie-Gesellschaft ab. Das alte Jahrhundert mit seinen Gewohnheiten und Erfordernissen hatte sich schleichend verabschiedet. Der Euro sollte die Antwort der Europäer auf Globalisierung, die Digitalisierung der Welt durchs Internet und ihrer Märkte – das Leben schlechthin sein. Wettbewerbsschlachten durchdrangen unser Leben, Leistungsdruck oder auch Leistungsoptimierung in Unternehmen – Krieg an den Börsen der Finanzspekulanten. Gewinnsucht als Glaubensbekenntnis. Aktiennotierungen, Börsen-News glichen der Frontberichterstattung einstiger Kriegsverläufen. Nationen kapitulierten ohne dass ein Schuss gefallen war. Banken brachen zusammen, neue Super-Reiche zockten, sahnten, schöpften ab, ohne je gearbeitet zu haben.
Bittere Armut, Elends-Flüchtlinge, Elends-Steppen waren zwangsläufig. Entwertung des Faktors Arbeit einschließlich ihrer Menschen folgten. Sie galt es sinnigerweise „freizusetzen“ mit Billiglöhnen, Billigpreisen – hinein in die Massen-Erwerbslosigkeit von Millionen und Abermillionen arbeitslosen Menschen allein in Europa.
Hastige Epochen schnelllebiger Austauschbarkeit schwappten schon zu Beginn des zweiten Jahrtausends über unsere Kontinente; Umbau wie Verfall des Sozialstaats inklusive. Soziale Kriege der Verteilung.
Und in Afrika? Dieser an Bodenschätzen immens reiche Kontinent erlebt unvorstellbar Trockenheit großer Regionen, Hungersnöte, Epidemien. Alle zwei Sekunden stirbt ein Mensch an Unterernährung bei blühendem, profitablem Organhandel in und aus der Dritten Welt.
Dabei wussten wir allesamt nicht so recht, ob der homo sapiens tatsächlich über die weltumspannende Tragweite jener Umbrüche umfassend informiert war. Und das eingedenk mit unseren nahezu 100 TV-Kanälen, iPads, Laptops; eben den Welten des Internets, die Tag für Tag in unserem Bewusstsein jonglieren, auf unseren Schaltzentrum einhämmern. Die Boulevardisierung des gesamten öffentlichen Lebens zum Ende des neunziger Jahrzehnts, vorangetrieben durchs Privatfernsehen und Internet, verschlangen Summen – Unsummen.
Die vielen Dinge machen arm. Zumindest nach Befinden des Schriftstellers Max Frisch (*1911+1991) „leben wir in einer Zeit, in der die Menschen nicht mehr in der Lage sind, zu definieren, was eigentlich Kultur ist“. Schöne Zeiten, schöne Aussichten. Sie deuten das Ende einer Denkweise an, die sich als eine Epoche übergreifende Aufklärung verstand. Der mit Terroranschlägen geführte „Dritte Weltkrieg“ um kulturelle Hegemonie und Selbstverständnis hat längst begonnen. Wir haben den Überblick verloren, wenn wir ihn je gehabt haben sollten oder auch nur wollten. Wir wissen hingegen eines zweifelsfrei: Unsere Freiheitsrechte sterben zentimeterweise.
Indes: Ich begreife auch mein Dasein, meine Erinnerungen, Widersprüche, Konflikte, Verzagtheit wie Euphorie als unverbrüchliche Seismografen in den Übergangs-Jahrzehnten aus dem analogen ins digitalisierte Zeitalter. Ich zeichne mein Dasein auf, um Vergangenheit, Verdrängtes, Vergessenes vieler ins Blickfeld, ins Bewusstsein zu rücken, als gesellschaftspolitischen Aufriss sozusagen. Mein Leben glich atemberaubenden, auch lustigen wie spannenden Berg- und Talfahrten in einer Achterbahn.
Es ging stets rauf wie runter. Dabei rast die Zeit übereilt davon. Wir spüren es, alles wird uns im Alltag zu viel. Das ständige Blinken und Bimmeln von Handy und Smartphone, die ausnahmslos jedes Vier-Augen-Gespräche, jeden Blickkontakt zu sprengen drohen, Prestige, Status, Reputation. Unisono – wir haben abrufbar zu sein. Leise deuten Philosophen der Moderne auf einen Ausweg hin: wieder Muße zu empfinden, Muße zu leben.
Читать дальше