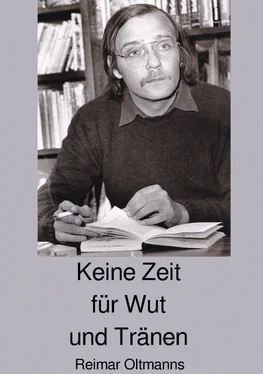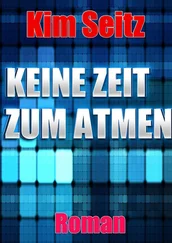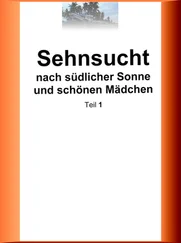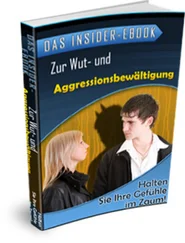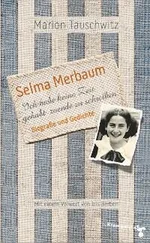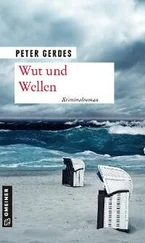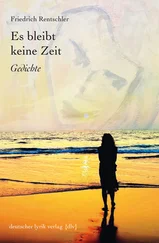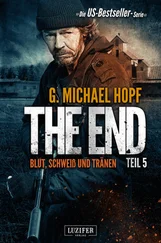Reimar Oltmanns - Keine Zeit für Wut und Tränen
Здесь есть возможность читать онлайн «Reimar Oltmanns - Keine Zeit für Wut und Tränen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Keine Zeit für Wut und Tränen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Keine Zeit für Wut und Tränen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Keine Zeit für Wut und Tränen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Keine Zeit für Wut und Tränen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Keine Zeit für Wut und Tränen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Schon ihr französischer Akzent – wenn Pierrette deutsch sprach, „isch abbee disch geseenn“ (ich habe dich gesehen) – öffnete mein Herz. Ich war fasziniert von ihrem Temperament. Ich war beeindruckt von ihrem Selbstbewusstsein, von ihrem Selbstverständnis zu reden, sich einzubringen, ihre gesellschaftskritischen Beobachtungen in beiden Ländern coram publico zu formulieren. Letztendlich war ich berauscht vom Zärtlichkeits-Gefühl, als Pierrette meine Liebkosungen erwidern mochte. Solch seine feminine Vehemenz war mir in Deutschland noch nicht begegnet. Für mich war in diesem Sommer jeder Tag ein emotionaler Ausnahmezustand, wie ihn der Sänger Pascal Danel in seinem damals aktuellen Schlager „Kilimandjaro“ einzufangen suchte. Ich liebte süße, sentimentale Augenblicke, die in der Wirklichkeit kaum eine Entsprechung fanden. Kitsch.
Wir schrieben uns. Zu Weihnachten 1966 fuhr ich noch in den alten Bahnhof Perrache in Lyon ein. Ich eilte zu Pierrette in die rue de Dieu im Stadtteil Villeurbanne. Typisch Frankreich, dachte ich, Baguette, Baskenmützen, Gauloises, Gitanes Papier Maïs, freundliche Menschen, an jeder Ecke eine Bar mit Musik und Wehmut. Durch Gänge und Treppenhäuser eilten hier inmitten der Stadt die Menschen, durch ein labyrinthisches Gewirr der Traboules, deren Passagen sich hinter ganz gewöhnlichen Haustüren verbergen. Allzu leicht kann man sich verlaufen. Lyon. Doch ich wollte bei ihr bleiben, mit Pierrette mein Leben teilen, für immer sein. Dort in dem heruntergekommenen Altbau mit seinen morschen Fensterrahmen, auf den ausgetretenen, knarrenden Treppenstiegen. Ja dort und nur dort, wollte ich mein neues Leben beginnen, Franzose werden.
Sie lachte, schien gerührt und antwortete: Wir machen Revolution in diesem Land, ich bin in der Uni und bei den Demos auf den Straßen. „Ich habe keine Zeit für einen Mann, für die Liebe. Ich brauche auch keinen Typen – weder Softie noch Macho. Ich bin eine radikale Marxistin. Radikal zu sein heißt, das Übel an der Wurzel zu packen. Dies und nichts anderes realisieren wir jetzt. Morgens arbeite ich in der Fabrik, um mein Studium zu bezahlen, nachmittags Vorlesungen, abends Demos. Und das Tag für Tag, Monat für Monat. Geh zurück nach Deutschland, lies im philosophischen Werk „Das Sein und das Nichts“ (1943) von Jean-Paul Sartre (*1905+1980) und lerne, lerne denken und handeln. – Adieu. Es sollte 23 Jahre dauern, bis ich Pierrette wiedertraf.
Eine alte Regel besagt, Urerlebnisse wirken am nachhaltigsten. Sie beeinflussen Einstellungen, sie bestimmen Verhaltensweisen, sie prägen sich unauslöschlich ein. Fernab meiner Affinität nach Romantik lernte ich als Schüler in Frankreich an den Elite-Universitäten zu Lyon für junge Leute in meinem Alter unvorstellbare gewalttätige, sadistische Rituale kennen. Wie zu Beginn oder auch mitten des Semesters zu Neujahr haben sich die Aspiranten der Grandes Écoles einer besonderen Tauglichkeits-Disziplin zu unterwerfen: „le bizutage“ genannt.
Ich war verstört, schockiert, als ich erlebte, wie junge Franzosen etwa in meinem Alter, sich draußen auf dem Land mit Alkohol abfüllten und angetrunken mit Latten, Stöcken wie Fäusten aufeinander einschlugen. Debattierten wir nicht sonst über Chancengleichheit in der Bildungspolitik oder auch soziale Gerechtigkeit? Nichts dergleichen. Ich war entsetzt, wie sorglos sich Studentinnen für ihre „Miss Nympho“-Wahl entkleideten, sich filmen ließen. Elite-Rituale, Klassen-Rituale, Männer-Spiele wiesen einen schmalen Weg in ein längst vergessen geglaubtes Milieu.
In früheren Jahrzehnten war die Bizutage, die seit der Zeit von Napoleon III. (1851-1870) existiert, quasi eine Taufe; nichts anderes als ein „hübscher“ Schabernack, den ältere Studenten mit den Neuankömmlingen erlesener Lehranstalten trieben. Ein Initiationsritus, der mit der Fuchstaufe in deutschen schlagenden Verbindungen vergleichbar ist. Einfach deshalb, um den Schülern einerseits Ehrfurcht vor den Grandes Écoles zu nehmen, andererseits eingeschworenen Korpsgeist sinnlich erfahrbar zu machen – als einen neuen Lebensabschnitt sozusagen.
Zumindest bekamen mein französischer Jugendfreund Jean-Louis Damble und Reimar Oltmanns ein klassisches Aufnahmeritual jener sonderlich bizarren Frohsinns-Fassade zu spüren. Brav dinierten wir ein „Elite-Menü“ aus Katzenfutter und Urin. Wir tranken Unmengen frisch gezapftes Bier aus großen Krügen. Mittelalter am Ende des 21. Jahrhunderts mit designierten Oberschicht-Allüren. Nein Danke.
Zeitenwende, Epochensprung in die Moderne, gedanklicher Einschub: Im Mai 1968 erlebte Frankreich eine Jugendrevolte der Hoffnung. Im neuen Jahrtausend eine der Hoffnungslosigkeit. Im Mai 1968 wurde noch im Namen einer idealisierten Vergangenheit an die Politik, an Pläne, Projekte, Programm geglaubt; vier Jahrzehnte nur noch ans Faustrecht. Für die Achtundsechziger war die Droge ein poetischer Versuch. Ganz allmählich ist sie zur Plage geworden, eine Krankheit zum Tode.
1968 hatten viele Jugendliche Angst, „vom System vereinnahmt“ zu werden, ängstigten sie sich vor der Unmenschlichkeit der Wirtschaftsgesellschaft. Nunmehr fürchten sie sich fortwährend davor, noch weiter ausgegrenzt zu werden. Seinerzeit hätten die drei Toten während der Unruhen beinahe Staatspräsident Charles de Gaulle (*1890+1970) 55die Macht gekostet. Nunmehr sind Tote in den Gettos seelenloser Vorstädte zum Regelfall geworden. Ausgrenzung, Härte, Grausamkeit, Tod sind Routine. Alltag.
Aber auch dies: Hastiger, immer schneller rast die Zeit im zweitausendsten Jahrhundert. Der Mensch in seiner Maßlosigkeit hat die Orientierung weitgehend verloren. >Echtzeit< zwischen den Erdteilen ist fortan ein Erfordernis; Realraum, Telekontinente, Daten-Autobahnen, Cyber-Parks, Cyber-Sex lassen natürliche Grenzen verschwinden, jahrhundertealte gesellschaftspolitische Strukturen verwischen. Staaten zerfallen. Neue Begriffe, neue Lebensformen.
Die Länder auf dem Weg zum Einheitsgesicht, die Städte machen es vor. Atemlos zerhackt die Tele-Technokratie räumlich gewachsene Eigenarten mit ihren historischen Bezügen, Wahrnehmungen, Empfindungen. Kulturen werden unwiederbringlich ausgelöscht. Postindustrielle Unternehmen brauchen vieles, nur keinen Zeitabstand zu anderen Völkern und zur Erhöhung ihrer Produktivität keine Arbeitsplätze, keine Menschen mehr. Überall beklagt man Sinnverluste, Misstrauen, Zynismus – und das weltweit.
Damals vor mehr als vier Jahrzehnten konnte ich mir solch eine bahnbrechende Zäsur in unseren Gesellschaften nicht vorstellen. Sie sprengte meine Phantasie, mein Denkvermögen. Auch ich befand mich seinerzeit im Umbruch, Phasen neuerlicher Orientierungssuche. Aber was für eine konventionelle Wandlung, welch ein Häutungsprozess auf dem Weg ins Erwachsenenleben war das schon. Ich wusste es nicht, konnte es nicht einmal ahnen – noch nicht. Das Zuhause, das es für mich in dieser Form kaum gab, war längst zu einer Art Jugendherberge verkommen. Man begnügte sich damit, pünktlich zu sein und die Mahlzeiten regelmäßig einzunehmen.
Ich war ja nicht der einzige Zeitgenosse, der sich keineswegs in einem halbwegs intakten Elternhaus eingebettet wusste. Für all meine Freunde oder auch Kumpane waren ihre Familien längst kein geborgenes Zuhause, kein Hort zum Auftanken mehr. Irgendwie waren und fühlten wir uns vogelfrei; vielleicht auch „ausgesetzt“, wenngleich das niemand so klar zu formulieren wagte. Zumindest gab es keine sogenannten Eltern-Schutzräume mehr, selten Gespräche, zu selten, in denen seelisch labile oder auch leistungsgeplagte Jugendliche ihre Kräfte sammeln konnten. Familien-Zerrissenheit.
Verständlich, dass ich keine sonderlichen Berührungspunkte zu meiner Mutter suchte. Ich wollte, wie viele meiner Freunde, ein anderes, sinnerfülltes Leben. Diese einsilbigen „Friss-Vogel-oder-stirb“-Diktate blieben erstickend. Ich bekam schon Atemnot, wenn ich hörte, miterlebte, wie die Älteren bedingungslose Anpassung an fragwürdige Normen in der Arbeitswelt von uns einforderten. Dem zu folgen, wäre einer Selbstaufgabe gleichgekommen. So bekam ich reichlich wenig mit für meine Zukunft; kaum Verwertbares aus dem Elternhaus, keine gedanklichen Perspektiven, keine Dialoge, weder Geld zum Lebensunterhalt, keine Fresspakete oder Jeans, noch Ratschläge, wobei diese auch Schläge sein können. Nörgelnde Apathie. Desinteresse.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Keine Zeit für Wut und Tränen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Keine Zeit für Wut und Tränen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Keine Zeit für Wut und Tränen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.