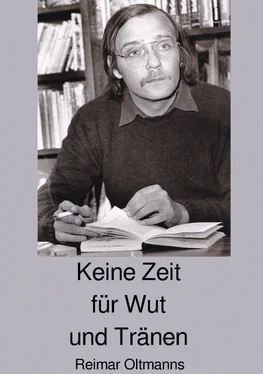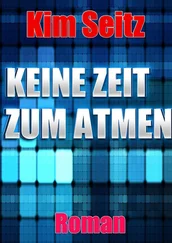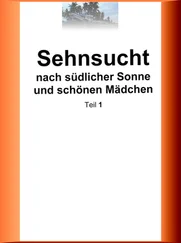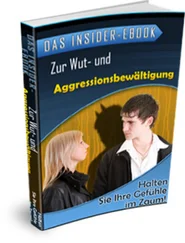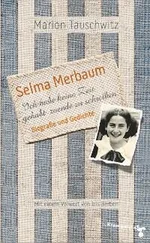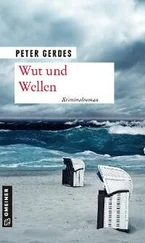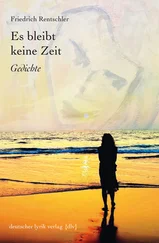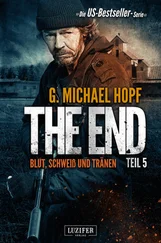Für gelebte Freundschaften gab es keinen seelischen Aufenthaltsort, jedenfalls nicht für mich. Viele husteten im täglichen Umgang Flüchtigkeiten, den sogenannten VGT – den vorgetäuschten Tiefgang. Oft schien es mir so, als guckte ich durch die Menschen hindurch. Meine Tagebuch-Aufzeichnungen aus dem Jahr 1968 skizzierten mir einen jungen Mann, der teils schwermütig, teils melancholisch sein Leben betrat. Damit ist wohl kein Krankheitsbild, sondern eher die Definition eines Weltschmerzes gemeint. Ich denke damit auch schon meine eigene Unzulänglichkeit, aber auch die Unzulänglichkeit der Welt, bestehende, unerträgliche Verhältnisse zu ändern, abschaffen zu wollen. Enge, beängstigende Enge vielerorts. Zugegeben: Zeitweilig gefiel ich mir in dieser Rolle schon, glaubte ich an die Exklusivität meiner selbst. So stärkte ich einstweilen mein Sendungsbewusstsein.
Selbst die schwerblütigen fünfziger Jahre, der heimliche Krieg gegen alle, schienen überwunden; das Aufbegehren vieler Ehefrauen gegen ihre oft hilflosen patriarchalischen Männer, die Gymnasiasten gegen die Volksschüler, Großunternehmen gegen den Mittelstand. Kleinbürgerliche Milieus, wohin ich auch schaute, waren eng, sehr eng. Atemnot. Beamte, Handwerker, Einzelhändler, ehemalige NSDAP-Mitglieder – sie alle trugen ihr Weltbild trotzig und unnahbar mit sich herum. Es war mein Kollege Peter Mosler 52, der auch mein Lebensgefühl jener Jahre in seinem Buch „Was wir wollten. Was wir wurden“ formulierte. Einer jungen (studentische) Generation, die „ausgezehrt von einer tödlichen Leere“ gekennzeichnet war, die nur auf eine Gelegenheit gewartet hatte, „dem scheintoten Körper dieses Landes“ zu entrinnen.
Wir zählten das Jahre 1968. Ich wohnte im Zentrum an einem breiten Ausfall-Boulevard in einem kleinen, winzigen Zimmer nahe dem Schloss in der danach benannten Straße. Ich kannte niemanden, der mich finanziell unterstützte, mir des Abends meinen „Strammen Max“ (Rühreier, Bratkartoffeln) in der Gastwirtschaft zum „Timpen“ in der Sutthauser Straße, gar den monatlichen Krankenkassen-Beitrag bei der AOK bezahlte.
Ich liebte die „Timpen-Kneipe“ mit ihren aus Bunt Glas verkleideten Fenster und rustikalen Knobelbecher Tischplatten. Sie gab mir etwas von jener verschämt gemochten Romantik, zu der sich kaum jemand öffentlich bekannte. Zu kitschig. Kaum dort, drückte ich Tastaturen der Musikbox – die nur Chansons der französischen Schlagersängerin kannten. Da war ich Abend für Abend mit „mon amie la rose“ den Abendwind fragend . Françoise Hardy vermittelte in ihren Liedern tiefe Melancholie, die in mir schon schlummerte; alle seien verliebt, nur sie nicht. Sie schrieb Lieder und debütierte 1962 im französischen Fernsehen mit ihrem Lied „Tout les garçons et les filles“. Im Regenmantel schlich sie da, apart und schüchtern, durch enge, verschlungene Gassen. Au backe.
Ich jedenfalls schlich nicht – ich trampte einfach gen Frankreich drauf los. Natürlich schaute ich gedanklich schon lange, lange Zeit über die Grenze. Deutsch-Französische Jugendlager an der Ostsee hatte ich in den Sommerferien bereits erlebt. Nach Frankreich selbst zog es mich zu jeder Ferienzeit zu meinem Freund Jean-Louis Damble nach Lyon-La Duchère. Frankophil nannte ich mich auch ungefragt. Dort ins Land von Albert Camus wollte ich hin, dort im Land der Französinnen und Franzosen wollte ich leben, lieben und auch lachen können. Es sollte noch Jahre dauern, bis ich mich westlich des Rheins heimisch fühlte.
Der Stadtteil La Duchère im neunten Bezirk mit seinen grau in grau hochgeschossenen Beton-Bananen sollte mein Ort des Rückzugs werden. Rechts und links ragten eilig montierten Platten des sozialen Wohnungsbaus in den Himmel, dem flüchtigen Einblick des Autofahrers entzogen. In diesem Getto lebten etwa 20.000 sogenannte Pieds-noirs (Schwarzfuß), Algerien-Franzosen, die nach der Unabhängigkeit Algiers 1962 Nordafrika verlassen mussten. Viele Pieds-noirs waren geradezu über Nacht umgesiedelt worden. Viele von ihnen hatten keine Wurzeln in Frankreich, La Duchère sollte ihre neue Heimat werden.
Mit meinem Freund, dem Pied-noir Jean-Louis, verband mich ein Fremdheits-Gefühl beschriebener Jahre. Wir beide waren Zugereiste. Wir lebten in einem anonymen Quartier mit Mutter Clairette und Schwester Ninou in der neunten Etage. Wir gingen oft wahllos durch die Straßen und lasen in Gesichtern der Passanten. Wir sprachen über die Ausdrucksweisen jener Menschen, denen wir begegneten. Wir redeten über ihre aufgesetzte Mimik, hinter der sich der wirkliche Ausdruck verbarg, den wir erraten wollten.
Sein und Schein Anderer, Gebrochenheit und Fremdheit blieben unsere Antriebsfedern. Das Zitat des ungarischen Schriftstellers György Konrad kannten wir damals noch nicht. Viel später drückte er aber zeitversetzt unser Lebensgefühl in jenen Jahren aus. „In der Heimat vermisst dich niemand, in der Fremde erwartet dich niemand.“ Seinerzeit konnten wir noch ahnen, dass uns die Jugendfreundschaft noch weit ins kommende Jahrzehnt tragen würde. In Schulferien bügelten wir Kleider wie Hosenanzüge in Reinigungen, putzten WCs im VW-Werk in Emden. Wir standen winkend an Autobahn-Auffahrten nach Barcelona, nach Stockholm usw. Nur über ein zentrales Anliegen hatten wir uns einvernehmlich verständigt, die Freundin des Freundes, die blieb tabu. Voilà.
Immerhin hielt es mich bei den Studenten-, Schüler- und Arbeiterrebellion nicht in der deutschen Provinz. Über Nacht trampte ich auf Autobahnen über die Schweiz nach Lyon; 5.40 Mark hatte ich in der Tasche. Von Autobahn zu Autobahn, von Raststätte zu Raststätte; Abfahrt um 14 Uhr in Osnabrück, 16 Uhr in Hagen, 20 Uhr Frankfurt am Main, 5 Uhr morgens in Genf am Grenzübergang St. Denis ins französische Département Ain. Endstation. Einreiseverbot für deutsche Schüler und Studenten. Angst vor weiteren Massenprotesten. Was also tun? Flüchten oder Standhalten? Rein in den unkontrollierten Kofferraum eines Franzosen, in dem ich mich kauernd krümmte und so die Grenze passierte. Weiter ging’s.
Ich wollte in Frankreich dabei sein, wenn Aufbruchs-Parolen nach Gerechtigkeit in Löhnen und Ausbildung über die Avenuen hallten, zischten. Ich erlebte, was in Deutschland unvorstellbar schien und bisher noch fortwährend ist. Generalstreiks, Massenproteste landauf, landab. Frankreich, unser Nachbar, lahmgelegt durch wochenlange Arbeitsniederlegungen und das ohne Streikgelder. Nichts ging mehr in der Republik mit ihren Institutionen. Morgenluft, Durchbruch.
Zehntausende, Hunderttausende von Menschen, ob Studenten oder Arbeiter (ein Novum), marschierten gemeinsam eingehakt auf den Boulevards. Autos flogen reihenweise um, kaum ein PKW fuhr, Pflastersteine aus Straßen rausgerissen und zu Schutzbarrieren aufgetürmt, Räumungsdiktate, Prügelattacken, Tankstellen ohne Sprit, kein Brot wurde gebacken, Barrikaden. Bürgerkrieg. Euphorie auf ein neues Leben. Rotwein, Chansons und Liebe in eng gewundenen Gassen. Klischees waren Wirklichkeit. La France.
Krieg machten freilich die Amerikaner in Vietnam (1965-1975), westwärts des Rheins probten junge Franzosen und Französinnen den Aufstand gegen selbstgerechte Väter, Unrecht, Willkür, gegen gesellschaftliche Verkrustungen. Sie forderten die freie Liebe. Sie suchten die sexuelle Revolution vielerorts auf dem Weg zu einer neuen Selbstverwirklichung, fernab vom moralischen Diktat katholischer Würdenträger. Der Mai 1968.
Meine Françoise Hardy im realen Leben war die um vier Jahre ältere Germanistik-Studentin Pierrette Michel 53aus Lyon. Ich lernte sie im deutsch-französischen Jugendlager in Heiligenhafen an der Ostsee im Juli 1966 kennen. Sie betreute in den Semester-Ferien oft als Monitrice viele Jugendliche aus beiden Ländern. Es war der Beginn des deutsch-französischen Jugendaustausches. Er ist bekanntlich nach dem deutsch-französischen Vertrag zwischen den Staatsmännern Charles de Gaulle (*1890+1970) und Konrad Adenauer (+1876*1967) geschlossen worden. 54
Читать дальше