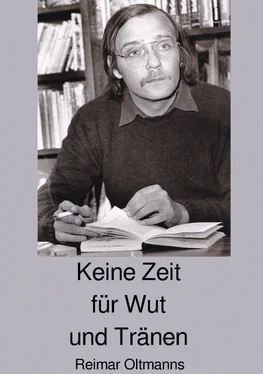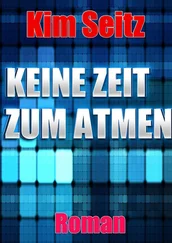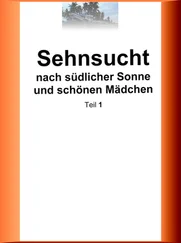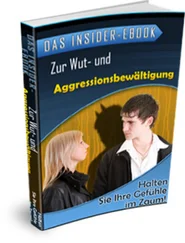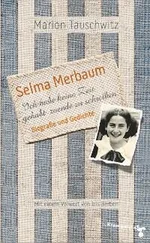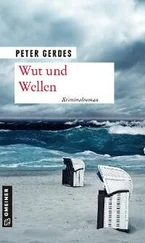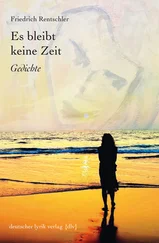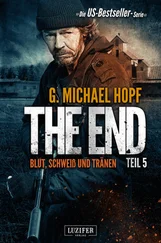Es war die einst in der Schweiz lebende Kindheitsforscherin und Psychoanalytikerin Alice Miller (*1923+2010), die sich erstmals kritisch mit den allseits vorherrschenden Einsichten der Kind-Eltern-Beziehung auseinandersetzte. Ihr bekanntestes Werk, „Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem waren Selbst“ 39, erschien im Jahr 1979.
Alice Miller griff die sogenannte Triebtheorie vehement an, weil sie Traumen der Kindheit als kindliche Fantasien darstelle und die Realität von Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung als kindliches Trugbild bagatellisierte. Sie schrieb, dass auch ohne vitales Erinnern die Langzeitfolgen von Gewalt, sexuellem Missbrauch latent in Körper und Seele lauern, dort eine bedenkliche Eigendynamik freisetzen können. Pfade am gesellschaftlichen Wegesrand waren somit vorgezeichnet. Mit anderen Worten: Hier sorgte eine wegschauende Gesellschaft dafür, wie sie aus dem Gewaltopfer Kind, ausweglose Täter späterer Jahre macht. Gewalt gegen sich selbst, Gewalt gegen andere.
Alice Miller konstatierte: Um solche Gefahren-Potenziale zu verhindern sei es für solche Kinder wichtig, im Laufe ihres Erwachsenenwerden die eigenen authentischen Gefühle von Schmerz in der Kindheit zu erkennen, und vor allem zu verarbeiten. Ohne dieses präzise Erinnern, jenes erneute Erlebbare sei ein Bezug zur eigenen Geschichte zum eigenen Geschehen versperrt. Meist ist eine schonungslose, oft beherzte wie auch schmerzhafte Offenheit zum hastig Verdrängten der Beginn einer langwierigen Entwicklung, die die Seele erstarken lässt. Kärrnerarbeit. Befreiung. Wer aber hat dafür das Geld, wer mag schon solche seelischen Anstrengungen, Irritationen, mitunter Verzweiflung auf sich nehmen? Die wenigsten.
Ich kannte die Bahnhöfe dieser Städte – Emden, Osnabrück, Rheine, Lingen, Meppen, Papenburg und Leer. Ich wusste um die kahlen, ergrauten Hallen, um menschenleere Bahnsteige, die alles in ihrer Gleichmut und Monotonie zu erdrücken schienen. Kälte. Verladebahnhöfe, ob Menschen oder Güter, sind unverrückbare Orte von Trennung, Schmerz, Hoffnung, Freude oder auch Verdrängtem, gar Endzeitlichem. Frachtgut. Ankommen, Warten, Abschied nehmen, Abfahren.
Ich spürte die Leere. Aber ich liebte diese Eisenbahn-Knotenpunkte aus altem Backstein. Sie gaben mir Raum, auch im Getöse die Stille, mich zu finden, zu lernen, mich zu spüren, auf mich zu hören. Kein Lärm. Kein Krach. Keine Schläge – das kannte ich. Es gibt sie noch, diese einsilbigen Schienenverläufe, bedächtiges Schnaufen oder schrilles Pfeifen der Dampfloks ohne Ende in den flachen norddeutschen Landen, soweit das Auge reicht.
Diese, meine Stille war für mich mehr als lediglich die Abwesenheit eines begleitenden Geräusches, das ich nicht wahrnahm. Vielleicht dämmerte in mir ein Moment der Selbstvergessenheit, die ich sonst nicht kennen durfte. Ich suchte die Unnahbarkeit im Zugabteil, um mir selbst nahe zu sein. Jedenfalls seit meiner Kindheit lebt in mir eine heimliche Sehnsucht fort, möglichst in Zügen Grenzen zu passieren, seelisch Grenzen zu überschreiten, das Rattern der Schienen als Dauerzustand, irgendwo hinziehen, einfach fliehen – immerfort. Auch in späteren Zeitfolgen haben mich als Reporter Groß-Bahnhöfe in Frankfurt, Paris, Mailand oder Warschau, auch im fernen Buenos Aires, Daressalam angezogen. Sie blieben Anziehungspunkte, Kristallisationskugeln, denen ich mich nicht entziehen konnte. Oft waren es von Fernweh begleitete Zwischenstationen auf meinen Durchfahrten zu einem anderen, neuen Leben. – Verschnaufpausen.
Viermal im Jahr zog ich den Gleisen entlang zur Mutter nach Norden ans Meer – als „Heimat-Urlaub“ tituliert. Aber war es wirklich Heimat da draußen? Vertrautheit, mitunter Geborgenheit? Oder gar Urlaub im Refugium Elternhaus? Nur Kinder leben intuitiv ihre Vergangenheit, die sie praktisch nicht zu leben hatten oder auch durften. Ich verbrachte meine großen Schulferien in der Konservenfabrik BoB draußen auf dem entlegenen Marsch-Acker um das Dorf Wybelsum in der Krummhörn – dort, wo hauptsächlich in Kitteln wie Gummistiefeln verkleidete Hausfrauen rund um die Uhr schufteten, immer auf Trab waren – Dosen abfüllten, packten und Kisten schleppten für 2,74 Mark pro Stunde. Oder beim Rostklopfen in den Trocken-Docks der Nordsee-Werke im Emder Hafen. Dort, wo ramponierte Schiffe nach schweren Seegängen generalüberholt werden mussten. Stunden um Überstunden, Ferientage für Ferientage klopfte ich mit spitzem Hammer im blauen Arbeitskittel und gelben Helm auf dem Kopf in Akkord-Kolonnen den Rost von den Rümpfen der Frachter – immerhin für 4,20 Mark pro Stunde. Jede Pausensirene war ein Stück Befreiung.
Eine alte Regel besagt, Ur-Erlebnisse in der Kindheit wirken am nachhaltigsten. Sie beeinflussen Einstellungen, sie bestimmen Verhaltensweisen, sie prägen sich unauslöschlich ein. Gravierend sind Ur-Erlebnisse immer dann, wenn sie ein Sich auseinanderleben, ein Sich fremdwerden – Entfremdungen offenbaren. Nahezu unbemerkt hatten einstige Bindungen zu meiner Mutter eine kaum für denkbar gehaltene Entwurzelung erfahren.
Ich wusste hinlänglich um die förmliche Grundausstattung ihrer an mich gerichteten Korrespondenz; von ihrem umschweifenden Lamento des ihr entrissenen „geliebten Sohns“. So begann sie meist ihre Briefe einzuleiten. Sie endeten meist mit Elogen auf ihren Mann, diesem offenkundig einzigartigen „Vati“, der sogar in der Lage war, eine Hollywood-Schaukel für den Vorgarten zu bauen. Familien-Idylle aus einem Pseudo-Milieu, das mich nicht erreichen konnte oder auch sollte. Es waren frank und frei formulierte Fiktionen. Lebenslügen galt es vorzugaukeln und der Heimzensur vorzuführen.
Als der Bruch passierte, vergewisserte ich mich meines Willens. Schon oft hatte ich die Vorstellung zu verletzen. Ich fühlte mich zu schwach, und ich weiß um die Unbedingtheit und um das Unwiederbringliche dieses Schrittes.
Tage habe ich an Formulierungen gefeilt, Worte gedreht, gewendet, verworfen – neu platziert. Ich konnte noch nicht ahnen, dass ich überhaupt so etwas wie ein Selbstbewusstsein hatte. Mit dem Heim als Refugium im Hintergrund fühlte ich plötzlich ungeahnte Stärke, einen neu entdeckten Überlebenswillen. Jedenfalls sicherlich am 9. März 1963, an dem ich Mutters Offerte widerstand. „Ich war sehr überrascht, dass ihr mich übers Wochenende eingeladen habt. Leider muss ich euch sagen, dass ich nicht kommen möchte. Einfach aus dem Grunde, weil wir sehr verschiedene Ansichten haben und das geht nicht gut. Außerdem bin ich für euch ja sowieso ein ‚Rüpel‘. Es wird euch keine Freude machen, mit mir zusammen zu sein. Einmal sagen wir uns so oder so die Meinung. Vater hat das ja schon brüllend und um sich schlagend in den Weihnachtsferien getan.“ Meine Antwort kommt verspätet, aber sie kommt.
„Du hast diesen Mann geheiratet, und Du ganz allein musst dafür aufkommen. Du hast mich beizeiten ins Heim gesteckt. Ich als Dein Sohn möchte mit diesen Krächen nichts mehr zu tun haben. Wir sehen ja immer wieder, wir sind nicht fähig, ein geordnetes Familienleben zu organisieren. Es besteht nur Misstrauen. Es hat gar keinen Sinn, dass ich zu euch nach Emden zurückkehre. Bitte rege Dich nicht auf. Du schadest dir nur selbst.“
Geschrieben an meine Familie, die mich ausgesetzt hat, weil das zu lebende Leben eine Ausnahme blieb, und die Hamburger Bild-Zeitung die einzige Hauptlektüre war.
Naheliegend, ja geradezu zwangsläufig, folgte mein Wortschatz den Tag für Tag gehörten Kalenderphrasen einer unbewohnten Sprache. Altklug kamen meine gestanzten, nachgeplapperten Sätze daher, „weil eben nicht aller Tage Abend ist“. Vornehmlich „hat die Morgenstunde Gold im Mund“, auch wenn es „in der Schule hart auf hart zur Sache geht“ Es wurden Briefe geschrieben, in denen sich der „Ernst des Lebens“ darin bewahrheitete, „weil der kluge Mann vorbaute; vielleicht auch deshalb, weil „auch beim Fußball der Ball rund ist und wie im Leben immer weiter rollt“. – Heimerziehung.
Читать дальше