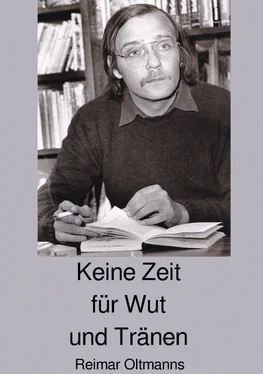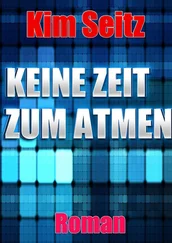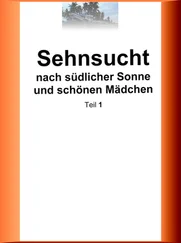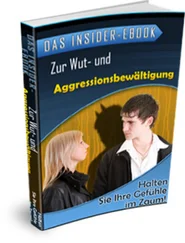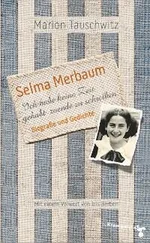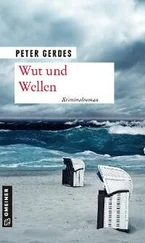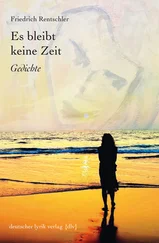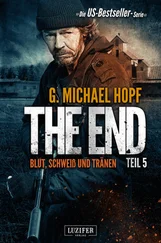Reimar Oltmanns - Keine Zeit für Wut und Tränen
Здесь есть возможность читать онлайн «Reimar Oltmanns - Keine Zeit für Wut und Tränen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Keine Zeit für Wut und Tränen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Keine Zeit für Wut und Tränen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Keine Zeit für Wut und Tränen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Keine Zeit für Wut und Tränen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Keine Zeit für Wut und Tränen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Im Haus Neuer Kamp hatten Frauen alle Macht über Männer, über heranwachsende Jungen; voran Heimleiterin Gertrud Berling . Damals waren es vornehmlich noch Frauen mit streng frisiertem Knoten, die dort ihr kurzatmiges, rigides Kommando unter dem Kreuz im Namen evangelischer Pastoren führten. Ein Knoten beim Wecken, ein Knoten bei der Essensausgabe der Suppenkübel, ein Knoten im Büro, ein Knoten beim Abendlied, viele teilnahmslose Knotengesichter bei den wöchentlichen Abendandachten mit dem obligaten Schlusskanon „Herr erbarme dich“ – „Lobet den Herren den mächtigen König der Ehren“. Und letztlich war es der aufgemachte Knoten im Halbdunkel der Nacht irgendwo mit irgendwem auf einer abgewetzten Matratze. Die überall und nirgends auftauchende Knotenfrisur in den fünfziger wie sechziger Heim-Jahren war keine Modeerscheinung. Für Zöglinge dieser Epoche symbolisierte der Dutt ein unnahbares Schreckgespenst. Er blieb das stählerne Frauen-Symbol aus düsteren, Angst machenden Zeiten der braunen Epoche.
Was hatte sich in Zeiten der jungen Bundesrepublik eigentlich verbessert? Wohl recht wenig. Unbeherrschte, unnahbare, launische, oft unausgebildete Fräuleins diktierten in Heimen das Wohlbefinden der ihnen Ausgelieferten. Hin und wieder gab es einen kurzen Schlag ins Gesicht oder mit dem Lineal eins auf die Finger. Hin und wieder hieß so viel, ausnahmslos jeden Tag. Und im Foyer hallte abgehacktes Geschrei ans Gemäuer, klatschten Backpfeifen im Drei-Minuten-Takt.
Es waren die Prügel-Nachmittage des Führungspersonals um Heimleiterin Gertrud Berling mit ihrer Stellvertreterin Ursula Knabke (*1923+2013). Erzieher-Stunden. Scheinbar ewig wirkte ihr immer und immer wieder ausbrechendes Gebrüll krächzend nach; auf den unendlich langen, nie enden wollenden schallgedämpften, schummrigen Fluren des verfluchten Kellergangs. Dort lungerte Gewalt. Angeführt vom baumlangen Hausmeister Granert. Erzieher-Gewalt, rohe Gewalt. Ihm oblag es, widerspenstige Kinder auf Weisung der Heimleitung im Kellergang mit Faustschlägen und Knüppel zu malträtieren. Am Eingang schallte Gekreisch, am Ausgang kullerten Tränen.
Pastor Eckhard Pfannkuche , der mich in seiner weiß getünchten, neu erbauten Melanchthonkirche am Bergerskamp 1964 konfirmierte, gab mir mit auf den Weg: „Beiße die Zähne zusammen, auch wenn es noch so schwerfällt. Da hilft nur Beten.“ Fortan machte mich der Gemeindepfarrer zum Kindergottesdiensthelfer. Psalmen, Gebete und Lieder, in denen sich das gottesdienstliche Leben widerspiegelte. Zeit zum Durchatmen.
Der Pastor schenkte mir die damals neue Fassung der Lutherbibel; die Übersetzung des Alten und Neuen Testaments der Bibel aus dem althebräischen, dem aramäischen bzw. der altgriechischen in die deutsche Sprache. Der Pastor schickte mich auf Landesseminare der Kindergottesdiensthelfer zur zweifelsfreien theologischen Interpretation der Agende. Ihm lag besonders daran, dass ich im Kreise von 200 Gymnasiasten „Selbstbewusstsein tankte“ und, wie er sich ausdrückte, „die Ehrfurcht vor höheren Schulen“ ablegte. Ich sollte „einfach lebhaft mitdiskutieren“, ermunterte er mich häufig.
Pfannkuche war Kettenraucher und ein Mann der Bibliothek. Kein Platz in seinem Pfarrhaus blieb leer, Bücher über Bücher. Dort verschanzte er sich, schrieb seine Predigten meistens in den Nächten. Tagsüber ging es im Pfarrhaus oft zu wie in der Villa Kunterbunt – ein Kommen und Gehen. Seelsorge. Ich staunte und staunte über Geduld wie Demut; mit welcher Leichtigkeit dieser hoch gewachsene Mann mit scheinbar weltfremder Lesebrille und stramm zurück gekämmten Haaren zitierte, rezitierte, rekapitulierte, zuhörte, half. Bezugsperson.
Es sollte mein erster, selbst verfasster und auch gedruckter Artikel sein, den ich als 15jährige Schüler im Kirchen-Kreis 34, dem Nachrichten-Blatt für die Evangelisch-lutherische Gemeinde Osnabrück schrieb. Heftige Auseinandersetzungen gab es in der Gemeinde, wie Christus vom damaligen kirchlichen Kunstverständnis her im Gotteshaus optisch wahrzunehmen ist; als leidender, sentimental dreinschauender Petrus vergangener Epochen? Oder als gegenwartsbezogener Christus am Kreuz in der Form einer nüchternen, eher abstrakten Skulptur eines Hingerichteten, der sich noch offenen Blickes seiner Schlächter vergewissert? Kulturkampf.
Ich fragte hingegen, ob wir Angst davor haben, Christus in die Augen die schauen. Deshalb bevorzuge man schließlich das alte, atmosphärisch einschläfernde Kreuz, weil es hingebungsvoll sentimental anzubeten sei. Nur, so meine Schlussfolgerung, ein Hingerichteter sei nie schön.
Wer aber war der Kirchen-Reformator Philipp Melanchthon (*1497+1560), der eigentlich Philipp Schwartzerdt hieß und mit Martin Luther treibende Kraft der deutschen und europäischen kirchenpolitischen Reformation wurde. Er war Philologe, Philosoph, Humanist, Theologe – von Krankheit und Zweifel geplagt. Von ihm stammt die einst beruhigende Mahnung: „Die Geheimnisse der Gottheit sollten wir besser angebetet als erforscht haben.“ Martin Luther hingegen suchte eher mit markanten Sprüchen vom “Fressen, Furzen, Rülpsen“ seine Aufmerksamkeit. Wie dem auch sei: ich hatte einen Pastor als Bezugsperson – ein Vorbild.
Nachvollziehbar, auch naheliegend: Auch ich wollte Theologie studieren, ein evangelischer Seelsorger sein. Auf dem sogenannten Nachhauseweg von der Kirche ins Heim sang ich oft das Kirchenlied „ein feste Burg ist unser Gott“ vom Reformator Martin Luther (*1483+1546) um 1529 geschrieben trotzig und voller Inbrunst vor mich hin. Damals konnte ich nicht wissen, welch eine Symbolkraft für den Protestantismus von Luthers Versen ausgegangen war.
Wer hier im Heim durchkommen wollte in diesem ausgegrenzten Kinder-Getto kleiner Mädchen wie Jungs, das wollten eigentlich alle, hatte sehr schnell im Flüsterton lernen müssen, seine Empfindungen, Gefühle wohlkalkuliert den sich andeutenden Vorteilen unterzuordnen und sich instrumentalisieren zu lassen. Prostitution der Zärtlichkeit. Augenzwinkern. Achselzucken. Bedrohung. Belohnung. Punktum. Heimjahre, um wenigstens an den Sonntagen stundenweise im Gotteshaus Obhut zu finden.
Unwürdige Abhängigkeiten, Grauzonen überall Grauzonen. Vielerorts wucherten Übergriffe. Nur keiner wusste so recht, wer mit wem, wo und wann. Gewiss gab es zeitweilig Praktikanten, die mitbekamen, was in Betten, auf Fluren und Toiletten geschah. Aber keiner verspürte auch die Courage, wenigstens einmal dem Einzelfall nachzugehen, einfach Beweise an die Öffentlichkeit zu bringen. Stattdessen wurden Schilderungen missbrauchter Zöglinge verdrängt, bagatellisiert. Zudem sahen sich missbrauchte Kinder als unglaubwürdige Nestbeschmutzer ausgegrenzt – immerwährenden seelischen Zerreißproben ausgeliefert. Ganz nach dem Gutdünken des Erziehungspersonals: „Es konnte einfach nicht sein, was nicht sein durfte.“
„Sie wurden geschlagen, erniedrigt und eingesperrt“, berichtet der Journalist Peter Wensierski in seinem Report für das Magazin Der Spiegel 35. Unter oft unvorstellbaren Bedingungen wuchsen in den fünfziger und sechziger Jahren Hunderttausende Kinder und Jugendliche in dreitausend kirchlichen Heimen mit mehr als 200.000 Plätzen auf. Weltweit sterben nach Mitteilung der Kinderhilfsorganisation UNICEF 36jährlich über 50.000 Kinder an den Folgen von Gewalt und Missbrauch, allein werden 20.000 Kinder Opfer von sexuellen Übergriffen 37.
Die Sozialwissenschaftler und Bildungsforscher der Universität Bielefeld, Klaus Hurrelmann und Sabine Andresen, kamen in ihrer ersten umfassenden Milieu-Untersuchung (World Vision Kinder-Studie, 2008) 38bei Kindern zwischen acht und elf Jahren zu dem Ergebnis, „dass die Klassengesellschaft in Deutschland keine neue Entwicklung ist. Erschreckend ist aber, wie sich in einem reichen Land wie Deutschland die Armut von Kindern ‚eklatant‘ auf ihre Biografien auswirkte. Das bedeute: geistige und kulturelle Armut, soziale Armut, materielle Armut, seelische, emotionale und psychische Armut, schulisches Versagen – und immer wieder Gewalt gegen Kinder, durchgängig Gewalt.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Keine Zeit für Wut und Tränen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Keine Zeit für Wut und Tränen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Keine Zeit für Wut und Tränen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.