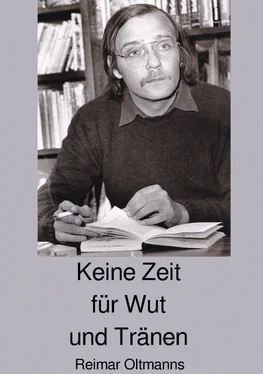Die sogenannte Heimerziehung war das „letzte Mittel“, der Notnagel in zerrütteten Familien vielerorts. Sie wurde im Wesentlichen im Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt. Dieser Paragraph sah vor, Kinder und Jugendliche außerhalb des Elternhauses extern Tag und Nacht pädagogisch zu beobachten, zu erziehen, anzuleiten, abzurichten – freiwillig. Die Kosten für derlei außerhäuslicher Unterbringung, freiwillige Erziehungsbeihilfe genannt, trug der Staat. In meinem Fall hatte der Stiefvater lediglich monatlich 35 Mark Kindergeld für den Heimaufenthalt abzuführen.
Ihren Ursprung hatte die Heimerziehung in Deutschland in der Armenfürsorge im Mittelalter. Dort wurden Alte, Kranke und geistig Verwirrte versorgt. Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939-1945) wurden Waisenhäuser gegründet; aus der Armenfürsorge entwickelten sich zunehmend Kinderheime, Fürsorgeerziehungsanstalten unter Bedingungen des Strafvollzugs.
Die Heimleiterin vom Haus Neuer Kamp zu Osnabrück , Frau Gertrud Berling (*1919+2009), eine Psychagogin , winkte mir vom Balkon des ersten Stockwerks im Verwaltungsgebäudes bei meiner Ankunft zu. Hier stand sie oft, verbrachte Stunden mit dem Fernglas vor ihren Pupillen. Von hier aus hatte sie den gesamten Gebäudekomplex unter Kontrolle, konnte blitzschnell wegrennende, herumstreunende Heimkinder wie Karnickel auf den Feldern ausmachen, aufscheuchen und als Strafe mit einem dreimonatigen Stubenarrest belegen. Fernglas hin, Feldstecher her, es trippelten viele Kids aus dem evangelischen Kinder- und Jugendheim; meist des Nachts über die Blitzableiter. Zu viele. Nach Rückkehr drakonische Strafen; Prügel, Gebrüll, Prügel, Gebrüll, Stubenarrest, Sonderarbeiten. Gespenstisch dieser Exodus junger Menschen.
Mein Heim-Kumpel Stefan , ein Zimmer-Genosse, war solch ein Ausreißer vom Dienst, ein Trippelbruder, ein Blitzableiter-Spezialist, über die er fast jede Nacht in Windeseile seine Freiheit suchte und einstweilen auch fand. Stefans Heimleben war von Phlegma oder auch Abwesenheit gekennzeichnet. Er redete auch nicht viel, lachte wenig. Apathisch. Scheidungskind, Trennungsschock. Seine tiefliegenden Augen, seine Blässe signalisierten Desinteresse – tagsüber. Nachts zog es ihn potz Blitz zum Blitzableiter, der ihn aus dem zweiten Stock auf die Erde brachte. Hannover war sein Ziel. Immer wieder Hannover an der Leine. Dort lebte seine Mutter frisch verliebt und verheiratet mit einem scheinbar erfolgreichen Architekten zusammen. Bungalow, Springbrunnen, Siegertyp.
Stefan konnte und wollte nicht verwinden, warum Mutter seinen Papa kurzerhand rausgeschmissen und ihn direkten Weges ins Heim gesteckt hatte. Ausgerechnet in diesen Beton-Bau mit seinen verschlungenen, düsteren Kellergängen, in dem es Samstag für Samstag Eintopf mit Steckrüben gab. Und ausgerechnet er, der Stefan , hatte aus dem feuchten, dunklen unterirdischen Geschoss diesen labbrigen Eintopf in großen, schweren Kübeln in die zweite Etage hoch zu schleppen. Da schwappte die Suppe schon mal über. Aber des Nachmittags an den Wochenenden waren ohnehin die Sauber-Mach-Dienste angesagt. Und an diesen Diensten kam Stefan mit seiner oft bekleckerten Schürze nicht vorbei.
Da musste er Flure fegen, wischen, Bohnerwachs dick auftragen und dann immer wieder wienern bis es glänzte. Galgenhumor, gequält lächelnd schaute er drein. Zu allem Überfluss war er zudem meist dazu auserkoren, auch abends die Sülzbrote aus dem Küchen-Keller zu holen. Die Extra-Portionen mit Aufschnitt Platten für die Erzieherinnen und einer verschlossenen Haube, die hatte er natürlich auch gleich mitzubringen. Da durften wir alle miterleben, zuschauen, wie sich unsere „Vorbilder“ abendlich mit Schinken, Spanferkel-Schnittchen ihre Mäuler stopften. Sie stopften sich ihre Mäuler und zeigten, gestikulierten mit ihrem Besteck auf die Anempfohlenen. Sie sollten endlich lernen, beim Essen „das Maul zu halten“ und den Arm zu heben. Sonst ginge es alsbald ohne mampfen ans Putzen. Heimjahre.
Er haute oft ab, dieser Stefan. Er wurde aber immer wieder ins Heim gebracht – von der Polizei. Nur eines Tages, da ward er nicht mehr gesehen. Verschwunden. Achselzucken. Stefan war am Autobahnkreuz Lotte in einen LKW gelaufen – sofort tot. Hier am Stadtrand zu Osnabrück sahen geschulte Polizisten-Blicke eigentlich sehr genau, welche Jugendliche zum Viertel gehören oder auch nicht – also aus dem Heim fortgelaufen waren. Es sind waren ahnungslose, entwurzelte Kinder, die sich im neudeutschen Sprachgebrauch „Off Road Kids“ nennen dürfen.
Es sind, damals wie heute, abgeschobene Heimkinder fernab von ihren desaströsen, zerrissenen Elternhäusern. Wo sich ihre Seelen wund gerieben, entblößt haben, ist Linderung oder auch die Aufarbeitung des Schadens langatmig, oft besonders schwierig. Sie irren und lungern Tage oder einige Wochen auf Boulevards naheliegender Städte umher, bevor sie wieder eingefangen werden. Allemal gilt, wer sich nicht anpasst, Widerworte gibt, plötzlich wieder ausreißt und auch sonst im Heim über die „Stränge schlägt“, der wird abgeschoben hinter Schloss und Riegel in eine geschlossene Unterbringung, ausgegrenzt hinter meterhohem Gemäuer. Das hatte mir meine Fürsorgerin Fräulein Helene Klaebig (*1917+2013) vom Jugendamt in Emden als Amtsvormund mit auf den Weg in meine Heim-Jahre gegeben, abschreckend versteht sich. Disziplin und ein bedingungsloser Gehorsam hießen nun einmal die Erziehungsideale dieser Jahre.
In der mit glänzendem Parkett ausgelegten Eingangshalle des Haus Neuer Kamp zu Osnabrück übergab mich bei Ankunft meine Mutter bereits wartenden Erzieherinnen. Sie verschwand. Wortlos. Es sollte wohl das erste Mal gewesen sein, dass mich in diesem erkalteten, arg fremd-bedrohlich wirkenden Heim-Foyer das Gefühl von Verlassenheit, Abgeschiedenheit, Hilflosigkeit, ja Verrat heimsuchte. Tränen und Bitterkeit.
Die einst als felsenfest apostrophierte Mutter-Kind-Bindung aus siebenjähriger Zweisamkeit zu Schöningen, ja das Ur-Vertrauen, hatte nunmehr ihr jähes, nicht mehr zu reparierendes Ende gefunden. Nur ich war und blieb kein Einzelfall, kein Einzelschicksal. An die 800.000 Kinder und Jugendliche wurden in den 50er und 60er Jahren ohne viel Aufhebens mehr oder weniger in Erziehungsanstalten oder auch Heimen weggesperrt – „entsorgt“. 25Die Anzahl der Heimzöglinge sank Ende der Neunziger des vergangenen Jahrhunderts immerhin auf 40.000 Kinder in der alten Bundesrepublik. 26Nur quantitative Größenordnungen sagen selten etwas für die gesellschaftliche Tragweite dieser seelischen Zerstörungskraft – in diesem Fall bei – Jugendlichen aus.
Das Haus Neuer Kamp nahm als Dauerkinderheim Jungen im Alter von 3 bis 15, Mädchen von 3 bis 18 Jahren auf und verfügte zur damaligen Zeit über eine Aufnahmekapazität von 100 Plätzen. Gewohnt wurde in kleinen Gruppen von zehn bis zwölf Kids gemeinsam mit einer Gruppenerzieherin in einer Etagenwohnung mit vier Schlaf-, einem Wohn-, Schularbeiten Zimmer, Teeküche sowie Toiletten, Wasch- und Duschräumen.
Wir Heimkinder mussten jeden Morgen vor Schulbeginn den Fußboden zu schrubben, Suppenkübel auf Stockwerke zu schleppen, Geschirr abzuwaschen, Betten zu bauen; nach dem Unterricht an den Nachmittagen in der Wäscherei oder auch in der Großküche zu helfen. Gelegentlich missfiel Aufpassern die Akkuratesse beim Putzen. Wieder wurde mal eben ein Eimer Wasser auf den Boden gekippt und laut getönt: „Jetzt wischt ihr noch mal, gefälligst ordentlich.“
Wenn wir uns aus dem Heim auf den Schulweg machten, wurden Zähne wie Fingernägel mit Argus-Augen bei der sogenannten Verabschiedung kontrolliert. Aufgestanden wurde des Morgens um 6 Uhr, die Schlafenszeit begann um 19.45 Uhr mit einem Liedchen des deutschen Komponisten Heinrich Leberecht August Mühling (*1786+1847) , das da lautete: „Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König.“ Heim-Humor.
Читать дальше