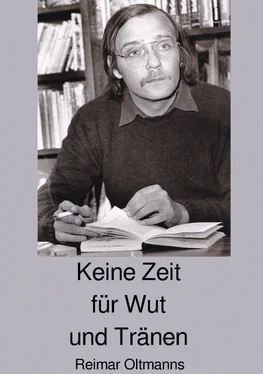Reimar Oltmanns - Keine Zeit für Wut und Tränen
Здесь есть возможность читать онлайн «Reimar Oltmanns - Keine Zeit für Wut und Tränen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Keine Zeit für Wut und Tränen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Keine Zeit für Wut und Tränen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Keine Zeit für Wut und Tränen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Keine Zeit für Wut und Tränen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Keine Zeit für Wut und Tränen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Meine Mutter freilich wollte schon ihren Ehemann zur Rede stellen. Auf erregte Fragen bekam sie Antworten – Prügel-Antworten. Wieder erhob er seine Pranken, wieder setzte es Hiebe auf die Backen – dieses Mal gleich in einem Aufwasch Frau wie Kind. Sie kassierte oft Ohrfeigen, ohne Ansatz, ohne Vorgeplänkel, einfach nur so; die Hiebe waren einfach nicht auszumachen wie aus heiterem Himmel. Sie sagte auch nichts, schminkte sich bunt. Wie ein kleiner Tuschkasten zog des Weges durch die Hafenstadt, die zufällig Emden hieß.
Es ist hinreichend verbrieft, dass Eltern und Erziehungsberechtigte versuchen, bei Verletzungen durch Misshandlungen Ärzte und Ämter zu täuschen, zu belügen. Es werden die raffiniertesten Mittel benutzt. Schwere Blessuren werden als Sturz von der Treppe, vom Stuhl oder Fallen auf den Fußboden gedeutet. Empfindliche Verbrennungen und auch Erfrierungen lassen sich mit unglücklichem Zufall, entschuldbarem Irrtum oder eigenem Verschulden des Kindes erklären. Es sind Fälle bekannt geworden, in denen Kinder während einiger Monate mehrfach mit Gewaltspuren jeweils in eine andere Klinik eingewiesen wurden. Die eigentlichen Ursachen wurden in den seltensten Fällen ans Tageslicht der Öffentlichkeit geholt. Schweigen.
Angstträume begleiteten mich in den Nächten, rissen mich aus dem Schlaf. Entweder sollte ich getötet werden oder ich hatte jemanden umgebracht. Stets wähnte ich mich auf der Flucht ganz sicher vor unverarbeiteter Drangsal des Tages, traumatischer oder traumatisierenden Gewalterlebnissen. Ich kletterte auf den Fenstersims und schrie in die Tiefe der Nacht – bis Nachbarn von der gegenüberliegenden Häuserseite klingelten. Ich schlug mit der Faust, die Scheibe von der Korridortür ein, blutete, konnte mich nicht wieder beruhigen. Negative Gefühle, Angst und Panik, auch Wahn. Spielten in solch furchtbaren Nächten Pingpong mit mir. Ich rief meist meine Mutter um Hilfe. Wenn sie kam – mir nahe war, wehrte ich mich, fühlte ich mich auch von ihr bedroht.
In meinen jungen Jahren verabreichten mir Ärzteschaften ein ganzes Arsenal Beruhigungshämmer, auch Psychopharmaka; von Belladenal Tabletten bis Megaphen-Tropfen und immer wieder die Adumbran-Tranquilizer. Tag für Tag ein oft teilnahmsloses Leben im Namen der Ruhe, Beruhigung. Abgeschaltet, stillgestanden. Jahr für Jahr suchte ich nach Verstecken; entweder im Kleiderschrank meiner Mutter oder unter den Tischreihen des Zolls im großen Sitzungssaal; Hauptsache unentdeckt bleiben.
Gern fuhr ich mit meinem Tretroller in den Außenhafen. Meist saß ich auf dem Kai, der zur Mole führte viele Stunden. Weitläufige Blicke. Ich schaute auslaufenden Schiffen nach irgendwo hinterher. Ich stellte mir das Leben an Bord vor und erzählte mir frei erfundene Geschichten. Ich war bei mir angekommen. Vorbei zog gerade ein vom Rost befallenes Frachtschiff. Ich erinnere mich noch genau an seinen Namen „Blue Point New York“. Dort wollte ich hin. Dort sollte die Welt besser sein, dachte ich. Fernweh. Ich war zwar bei meiner Familie zu den Mahlzeiten an der Oberfläche noch präsent, vom inneren Verständnis her war ich längst aussortiert, abgeschoben. Ein Heilpraktiker konstatierte gar, dass ich durch Einnahme so vieler Medikamente „spätestens in einem halben Jahr durchgedreht wäre.“ Er verordnete stattdessen Bäder und Umschläge. Gebadet wurde freilich nur einmal wöchentlich. Beim Substantiv Umschläge blieben kurzerhand die ersten beiden Buchstaben auf der Strecke.
Verständlich, dass in den ersten Volksschulklassen meine „Bestnote“ ein ausreichend war. Verständlich auch, dass ich meiner Mutter aus ihrem Schreibtisch 50 Mark stahl. Am Schalter des Bahnhofs Emden-West löste ich eine Fahrkarte nach Hamm. Dort lebte ein junges Mädchen namens Ursula . Mit ihr – der schwarzhaarigen Ursula Raukohl – hatte ich im Frühling am Strand der Nordsee-Insel Borkum Volleyball gespielt. Ich war 11, sie 14 Jahre alt. Sie wollte ich wiedersehen, mit ihr alles teilen. Auf dem Bahnstieg 2 im westfälischen Rheine holten mich Bahnpolizisten mit festem Griff aus dem Zugabteil.
Ich rollte unter polizeilicher Beobachtung mit dem nächsten Eil-Zug zurück zur Bahnhofsbaracke Emden-West; über die Klappbrücke des Binnenhafens, vorbei an unwirtlich ergrautem Bunker-Beton und Wassertürmen, vorbei am Gestank des Heringshafens. Schiffssirenen heulten auf. Das taten sie immer, wenn ein KüMo (Küstenmotorschiff) um Einlass in den Binnenhafen bat, die Eisenbahn-Schienen diagonal die Lüfte kreuzten und die Schiffe passieren konnten. Keine 500 Meter Luftlinie von dieser Klappbrücken-Konstruktion lag „mein Zuhause“.
Dorthin hatte ich mich wieder einzufinden. Wo „der Krüppel“, wie ich ja nun einmal hieß, weiter mit Fäusten oder auch Lederriemen die Zuwendung des Stiefvaters erfuhr. All das geschah nicht etwa zufällig. Es passierte ausgesucht auf den nach Linoleum riechenden glatten Fluren des Hauptzollamtes; vorzugsweise an dienstfreien Wochenenden. Fürsorgepflicht? Kindesmisshandlung.
Die Moral der jungen Jahre: Die Familie-Misere galt es nicht zu hinterfragen. Ich allein war der sogenannte „Symptomträger“ von Gewalt und Zerrüttung. Ich war die Ursache, war ja letztendlich „krank, geisteskrank“. Ich war der Sprengsatz, ein „Sündenbock“, eben ein Störenfried, der eigentlich einer intakten Familienharmonie aus Bier- und Doornkaat Flaschen sein Gleichgewicht nahm.
Ich hingegen spürte nur einen Wunsch, den dumpfen Stiefelschritten des Zöllners zu entkommen. Egal wohin – nur raus aus den Klauen elterlicher Gewalt. Seinerzeit konnte ich natürlich nicht wissen, dass nach Erhebungen des Statistischen Bundesamtes etwa 1,42 Millionen Kinder 24in der alten Bundesrepublik schwersten familiären Misshandlungen ausgesetzt waren. Zerrissenheit.
An einem nasskalten, verschneiten Wintertag, dem 22. Januar 1962 war es so weit – endlich. Kinder-Emigration. Unter innere Emigration wird die innere geistige Auswanderung verstanden. Ich befand mich in einer seelischen Emigration. Ausgewandert in eine gewaltfreie Zeit. Wenigstens das. Es begannen meine Heim-Jahre, dort draußen auf unendlich weiten, sich überlassenen, nahezu vergessenen morastigen Feldern zu Osnabrück am Rande des Teutoburger Waldes. Hier stand das Haus Neuer Kamp in der Sutthauser Straße 288. Es sollte für viele Jahre mein Zuhause werden.
Im Heim zu Osnabrück – Lazarett der Kinder – Sex und Prügel in Verlassenheit
Ausholen ist so gut wie geschlagen
Sprichwort aus Afrika
Meine neue Heimstatt war ein H-förmiger Betonkasten mit 98 Fenstern in der Größe eines Fußballplatzes. Sie lag draußen an der Stadt-Peripherie von Osnabrück der Landstraße zum Vorort Sutthausen, eingezäunt zwischen Wald und Acker. Weit und breit nur Wiesen, Lehm Wege. Einsamkeit. Es war ein auch nachts beleuchtetes Getto, aus dem es eigentlich kein Entkommen, kein Abhauen gab. Eigentlich.
Dorthin hatte Mutter Jutta ihren Sohn Reimar im Rahmen der „freiwilligen Jugendhilfe“ in ein evangelisches Jugendheim abgeschoben, abgestellt, außer Sichtweite gebracht. Im Haus Neuer Kamp in Osnabrück arbeiteten etwa zwanzig Erzieher oder auch Erzieherinnen. Während ihrer Arbeitszeit schlossen sie durchschnittlich mit 64 Einzelschlüsseln Räume auf und wieder zu, öffneten mit dem Vierkantschlüssel verriegelte Toiletten-Türen. Wer aufs Klo musste, der hatte zunächst nach Klopapier zu fragen – und das Tag für Tag, Nacht für Nacht, Monat für Monat, Jahr für Jahr. – Kinder-Gefängnis.
Schon einen Tag nach meiner Ankunft hatte ich auf einer Zehn-Pfennig-Postkarte mit dem Konterfei des Malers Albrecht Dürer (*1571+1628) den „lieben Eltern“ einen vorgefertigten Satz zu schreiben: „… mir gefällt es hier sehr. Schade, dass ich erst so spät hier angekommen bin.“ Es waren von Erziehern vorformulierte Phrasen. Je positiver Heim und Leute im kindlichen Darstellungsvermögen geschildert wurden, desto entspannter und erträglicher verlief der Heimalltag. Kinder hatten ihre Gefühle und Befindlichkeiten abzurichten; Opportunität als Sozialisations-Mosaik erlernbar machen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Keine Zeit für Wut und Tränen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Keine Zeit für Wut und Tränen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Keine Zeit für Wut und Tränen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.