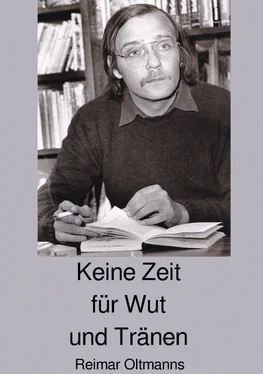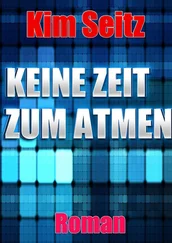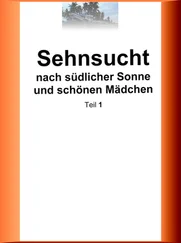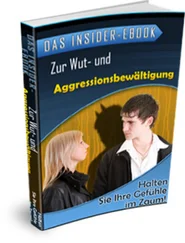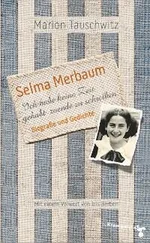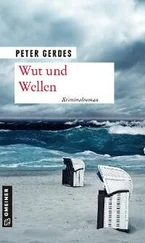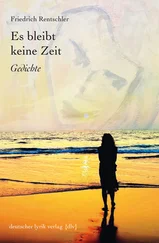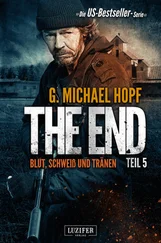Reimar Oltmanns - Keine Zeit für Wut und Tränen
Здесь есть возможность читать онлайн «Reimar Oltmanns - Keine Zeit für Wut und Tränen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Keine Zeit für Wut und Tränen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Keine Zeit für Wut und Tränen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Keine Zeit für Wut und Tränen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Keine Zeit für Wut und Tränen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Keine Zeit für Wut und Tränen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Emden in jenen Jahren durchlebte vom Sturmtief begleitete Aggressionswellen nach außen wie innen. Wenig, fast nichts, blieb im Innenleben der Stadt übrig, etwa von der hinlänglich besungenen Seefahrer-Romantik eines Freddy Quinn, dem Nationaldenkmal am Dollart. In Hafen-Bars und Spelunken leierten die Musikboxen bis zum geht nicht mehr seinen Gassenhauer: „So schön war die Zeit / Hört mich an, ihr goldenen Sterne / Grüßt die Lieben in der Ferne.“
Jeder fühlte sich irgendwie und irgendwo verkannt, glaubte etwas Besonderes zu sein. Nach Schicksal roch es fast überall. Schicksalsschläge lauerten in so manchen Ecken. Nahezu alle hofften auf Seelenmassage. Es bedurfte nicht viel, aus welchen nichtigen Anlässen auch immer, flogen die Fäuste, ging das Inventar zu Bruch – Krankenwagen. Notaufnahme. „Nostalgie“, formulierte der französische Sänger Charles Aznavour , „ist die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, in der man nichts zu lachen hatte“.
Die Kneipen waren dreckig und verrucht, Schiffsbilder, Wimpel, Fischkarten klebten an den Wänden im „Goldenen Anker“ in Hafen-Nähe wie eh und je. Der Leitspruch an der Theke unübersehbar: „Wer Geld hat, hat gute Laune und lässt sich vollsaufen, wer keines hat, erst recht.“ Die Augen des Wirtes Dieter waren glasig, seine Haut blass, seine Haare fettig strähnig, Bartstoppeln – fern der Heimat. „Was willst du Lottel denn hier“ stammelte Dieter mir zu. Na klar, die Stimmung im „Goldenen Anker“ war so schlecht wie die Luft. Da drückte Dieter mal eben die Taste F4 seines Leierkastens mit Lale Andersen (*1905+1972) Wieder war Lili Marleen unter uns. Bis zum geht nicht mehr. Immer nur Lale, Lale und nochmals Lale in einem fort.
Meine Aufmerksamkeit dort draußen am Borkum-Kai galt einem spröden abweisenden Klinkerbau – dem Seemannsheim, dem Wohnzimmer für Fremde aller Länder. Hier war ständiges Kommen und Gehen wie in einem Durchlauferhitzer, der viele Sprachen kannte. In Zahlen: 6.000 Übernachtungen, 773 Tagesgäste, exakt 51 Gottesdienste mit 700 Besuchern im Jahr. Ich lernte sehr schnell, dass hier Seeleute aus 40 Nationen eine Zwischenrast einlegten; auf ein neues Schiff warteten oder gar ihren Lebensabend lebten. In Wirklichkeit aber verdichtete sich diese Unterkunft zu einem Refugium für Seemänner, die nirgendwo an Land ein Zuhause finden konnten. Wenn sie nicht auf See waren, blieben sie heimatlos; oft an Land wurden sie auch krank und standen ohne Arbeit da.
Ich fühlte mich hingezogen zu Waldemar , einem großen kräftigen Mann, der häufig auf der Parkbank neben dem Haupteingang hockte. Freundlich war er. Er suchte mit mir, dem Pimpf, Gesprächskontakt. Verlorenheit. Frührentner war er, als Schiffkoch unterwegs, fünfundzwanzig Jahre auf den Meeren lagen hinter ihm. Mit 64 Jahren fand Waldemar kein Schiff mehr – trotz großer Kajüten Erfahrung. Erst gab es Arbeitslosengeld, dann Frührente. Was blieb, das sind Erinnerungen an längst verblichene Augenblicke bei hohem Seegang. Waldemar sagt: „Wer einmal draußen war, im Sturm sein Ende ins Auge geschaut hat, der will etwa den Streit an Land um die Höhe einer Hecke am Eigenheim nicht mehr verstehen. Dann fahre ich lieber zur See.“ – Einzelgänger Waldemar , ein Aussteiger eigenen Zuschnitts.
Und die Gegenwart? Das sind Kartenspiele Tag für Tag im kahlen Aufenthaltssaal des Heims; einer Bude mit Bett, Tisch, Stuhl, Schrank, ein großes Fenster und einen kleinen Schlüssel für sein persönliches Fach in der Küche. Hin und wieder übermannt ihn der Suff, hin und wieder Barbeleuchtung mit Weiber, ausnahmslos ein und dieselbe Lebensgeschichte. Erzählt wird jeden Abend, sieben Mal in der Woche. Das Leben verträgt viele Wiederholungen. Sicher trägt er eine Vorahnung von seinem Tod in sich – an die Urnenversenkung irgendwo draußen auf See. Das hat Waldemar jedenfalls beizeiten testamentarisch verfügt.
Waldemar hatte schon vielen seiner Kameraden geholfen, erlebte auch notgedrungen, wie einige seiner Mitbewohner regelrecht „vor die Hunde“ gingen. Seeleute im Seemannsheim, die täglich bis zu zwei Litern klaren Schnaps in sich hineingossen. Pförtnerloge ging zu Bruch, Haustüre zerdeppert, Heimleiter verprügelt, Fenster im Speisesaal eingeworfen; dreimal sauste eine volle Bierflasche direkt an Waldemars Kopf vorbei.
„In Aurich“, sagt der Volksmund, „ist es traurig, in Norden ist es besser, in Emden gibt es Menschenfresser“, sangen wir als Kinder auf Ostfrieslands Straßen recht keck. Wir spürten schon zerrissene, grau belegte Zustände in dieser Gegend. Es waren Befindlichkeiten, Stimmungen der Erwachsenen, die sich auf uns übertragen hatten. Ja, es war schon die Wut nach innen, nein auch die verbitterte Ohnmacht nach außen. Die Gemüter schienen auf irgendeine Weise angerempelt.
Es waren sorgsam von Männern diktierte Tages- wie Freizeitabläufe. Sie bestimmten Gut wie Böse, Oben wie Unten – schreiben Laune und Lebensatmosphäre vor. Der Zeitgeist des fünfziger Jahrzehnts im vorherigen Jahrhundert quetschte sich allenfalls in kurzatmige Polizeiberichte. Mehr nicht, jedenfalls in Emden. Handgreiflichkeiten in Familien wurden totgeschwiegen. Hieß es doch beschwichtigend: „Ein richtiger Schlag zur rechten Zeit, schafft wieder Ruhe und Gemütlichkeit.“
Jeder hatte darauf zu achten, nicht zu den Zukurzgekommenen zu zählen. Eine Hab-Acht-Stellung, die so manche Familien ihrer Bitterkeit und Grobschlächtigkeit überließ. Nahezu die gesamte Stadt wachte über Lebensstandard und Lebensart ihrer Einwohner, von Nachbar zu Nachbar, von Eintopf zu Eintopf. Hier nistete sich ein Klima des lähmenden Misstrauens ein, in dem die Denunziationen unvermutet auflebten. Der Überwachungsstaat und seine Folgen.
Im Städtchen Aurich (40.000 Einwohner) sorgte die Neueinstellung eines „Sozialdetektivs“ (zu Deutsch Schnüffler) dazu, 717.768 Euro Hartz-IV-Gelder nicht ausgezahlt worden sind 22. Bei derlei Ansporn war es auch kaum verwunderlich, dass es den Behörden-Kollegen auch in Emden immer wieder gelang, bei den Ärmsten der Armen Hartz-IV-Missbräuche aufzuspüren. Allein in einem Jahr wurden 3.210 Personen überprüft – mit der Folge, dass gleichfalls in der Hafenstadt 320.000 Euro zu viel an Stütze gezahlt worden ist. 23
Gewalt gegenüber Frauen, Gewalt gegenüber Kindern – das war der Normalfall, ein Randthema, allenfalls eine Marginalie, fast eine familiäre Selbstverständlichkeit. Aber auch Gewalt unter Schülern. Dort, wo die Söhne mit stets wiederkehrenden Schlägereien ihren Vätern nacheiferten; in der zwischen Bunkern und Bombentrichtern gelegenen Emsschule etwa. Die Gründe: Nichtigkeiten. Tristesse. Stellvertreter-Kriege.
Keine große Pause ohne ein „blaues Auge“, aufgerissene Lippen auf dem Schulhof der Emsschule in den fünfziger Jahren. Steinschleudern nahezu in jeder Schulklasse. Lehrer als Protokollanten für Haftpflicht-Versicherungen oder als Ringrichter für
Polizeiberichte. Kein Fußballspiel an der Kesselschleuse an Wochenenden zwischen den Erzrivalen „Stern“ und „SuS Spiel und Sport“ Emden, wo nicht spätestens in der zweiten Halbzeit die Fäuste flogen; nicht auf dem Schlacke-Spielplatz unter den Akteuren, sondern auf den Rängen zwischen den Zuschauern. – Stellvertreter-Kriege zwischen den Bewohnern vom Conrebbersweg und dem Bezirk Transvaal – dort, wo die sich Arbeiter mit knappen Auskommen eingerichtet hatten. Erst wurde angefeuert, gebrüllt, dann wurde geschlagen, feste drauf geprügelt. Ging es doch um letztendlich um ungelöste Frage der Gegenwart: um Zugehörigkeit, um Identifikation in Zeitläuften der Zerrissenheit. Der sonntägliche Bolzplatz als Reflex dafür, wenn Menschen in Krisen schlittern. Nachkriegszeiten, das blieben nicht nur Wiederaufbau-Legenden – das waren Wirtschaftskrisen, Vertrauenskrisen, Wertekrisen. Verlassenheitsmomente von Menschen, die sich im Stich gelassen fühlen, sich ängstigen, die Übersicht über ihr Leben zu verlieren. Damals wie heute immerfort. Am 25. März 1957 wird die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge durch die Gründerstaaten Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland mit dem Ziel einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik in den Grenzen Europas konstituiert. Zukunftsvision.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Keine Zeit für Wut und Tränen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Keine Zeit für Wut und Tränen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Keine Zeit für Wut und Tränen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.