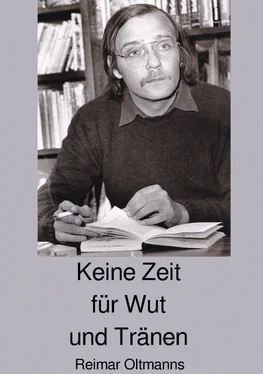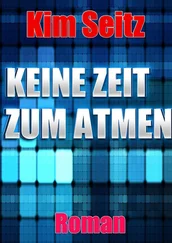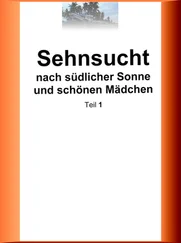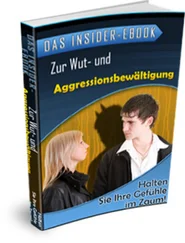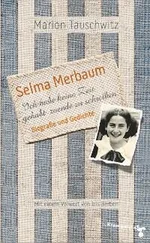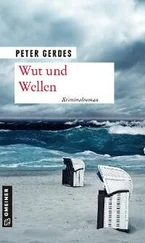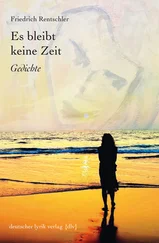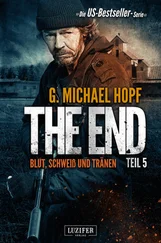Reimar Oltmanns - Keine Zeit für Wut und Tränen
Здесь есть возможность читать онлайн «Reimar Oltmanns - Keine Zeit für Wut und Tränen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Keine Zeit für Wut und Tränen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Keine Zeit für Wut und Tränen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Keine Zeit für Wut und Tränen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Keine Zeit für Wut und Tränen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Keine Zeit für Wut und Tränen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Charles Baudelaire (*1821+1867) Französischer Lyriker und Wegbereiter der europäischen literarischen Moderne
Scharfer Wind wird vom Westen über die Nordsee-Küste fegen. Es wird ein Freitag sein. Der Gestank von Fischmehl, vom Vollhering, weht von dem Trawler des Alten Heringshafens durch die Straßen, folgt den Menschen unablässig überall hin. Bei solchen Windverhältnissen heißt es ein- und auszuatmen – den „Emder Matjes“: tagein, tagaus immer derselbe Geruch. Emden in Ostfriesland, die Deiche der Nordsee, die mich sieben Jahre durch meine Kindheit begleiteten, wirken auf den Neuankömmling wie platt gedrückt unter der Vehemenz des Windes. Er ist mächtig, allgegenwärtig, ohrbetäubend. Er vergreift sich an allem, so will es scheinen, was übers Gras hinauswächst.
Der Leuchtturm Emden West Mole steht auf der im Jahre 1899 gebauten Einfahrt in den Emder Außenhafen. Der sechs Meter hohe Lichtmast signalisiert als Molen Feuer den Schiffen ihren Standort, um sicher ihren Landeplatz zu erreichen.
Samstag für Sonnabend, oft Sonntag für Sonntag verbrachte ich an diesem kleinen, achteckigen, roten Leuchtturm mit seiner spitzen, roten Kuppel. Er stand auf einem achteckigen, drei Meter hohen Sandsteinsockel. Hier auf dem Laufsteg der West Mole, ganz dicht an „meinem Leuchtturm“, habe ich in meinen frühen Jahren Stunde‘ um Stunde‘ – insgesamt vielleicht Monate – gesessen, beobachtet, gelesen, Selbstgesprächen geführt, zugehört. – Unvergessen.
Meine Blicke waren stets auf die aus- wie einlaufende Schiffe mit ihren schwergewichtigen Bruttoregistertonnen gerichtet. Ob es Fernweh war, kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Es faszinierte mich jedenfalls, solch ein Koloss zu Wasser auf die Meere hinaus tuckern zu sehen. Es hatte etwas Erhabenes, Beruhigendes – Anmut. Bedächtigkeit. Wenn mal gerade kein Frachter oder Tanker in Sicht war, richteten sich meine Augen auf das gegenüberliegende Holland. Es schien nah, sehr nah. Und doch waren die Niederlande fern, jedenfalls für mich.
Ernüchterung: In diesen Jahren kennt jedenfalls das kleine Leuchttürmchen kein Mensch mehr. Er fristet als Auslaufmodell auf dem zugesperrten Werksgelände der Volkswagen AG ein Schattendasein. Das ursprüngliche Laternenhaus wurde abmontiert. Es schmückt nunmehr die Emder Innenstadt – als Touristenattraktion versteht sich.
Erinnerungsbilder aus meiner Kindheit, die sich tief in mein Gedächtnis eingegraben haben, verlieren sich in der Gegenwart ins Unkenntliche. Trostlos verlassen – wie leblose Raumstationen – dümpeln die einst sagenumwobenen Sehnsuchtsplätze zwischen Land und Meer vor sich dahin – auch Leuchttürme genannt.
Auf meist um die 126 Stufen einer gusseisernen, knatschenden Wendeltreppe kletterte ich früher hinauf zur Aussichtsplattform. Dort verliefen sich meine Blicke in der unendlichen Weite des Meeres zwischen Ankommen und Abfahren, suchten immer und immer wieder nach einem Fix-Punkt. Das war vor Jahren, Jahrzehnten. Heute kauert kein einsamer Wärter mehr dort droben. Drei Sekunden an, drei Sekunden aus. Drei hell, drei dunkel. Eine Stunde vor Sonnenuntergang begann es, eine Stunde nach Sonnenaufgang endete es. Leuchtturmwärter sind nach 200 Jahren wieder Geschichte.
Der Mythos von diesen Kathedralen der Meere wich einer exakt berechenbaren High-Tech-Satelliten-Navigation. Wehmut. Nur Dünen und Meer, kleine windschiefe Häuser, schmucke Villen auf den ostfriesischen Inseln und prachtvolle Kur-Kliniken aus der Kaiserzeit (1871-1918) überlebten einstweilen – noch. Aus Kapitänen wurden in der Neuzeit Assistenten von Standesbeamten, wenn es um Eheschließungen 20 Meter über der Erde, kurz unter den Wolken ging. Hoffnung. Kitsch, Hochzeits-Zirkus im digitalen Zeitalter, der sich in der Vierfarb-Tiefdruck-Reklame „Romantik pur“ nennen darf.
Immerhin: einmal durfte ich auf meinen „alten Tagen“ noch auf einen Leuchtturm klettern, in die Ferne der Meere blinzeln. Meine weitaus jüngere Halb-Schwester Susanne Wegner , Mutter mit vier Kindern im Gepäck, riskierte vor dem pensionierten Kapitän Wilfried Eberhardt ihren zweiten Ehe-Versuch. Das Leben besteht halt aus Wiederholungen. Sie gab sich mit ihrem Maik, 40 Meter über der Erde auf dem rot-weiß geringelten Leuchtturm zu Pellworm das Ja-Wort. Nach der Trauung klirrten Schampus Gläser und raschelten mitgebrachte Fischstäbchen in aller Höhe. Wieder auf der Erde ging es unter am Strand barfuß ins Watt – und dann begleiteten Oldie-Lieder etwa vom britischen Popsänger James Blunt („rain and tears are the same, But in the sun you’ve got to play the same“ – Regen und Tränen sind dasselbe) die beiden in ein neues „Liebes-Zeitalter“; Krabbenbrötchen, ein Schluck Schnaps mit Treueschwur im sterilen Dorfkneipen-Milieu inbegriffen.
Ortswechsel, zurück in meine Kindheit: Das 1901 erbaute und im markanten norwegischen Stil gehaltene Empfangsgebäude der Hafenbahn Emden-Außenhafen wurde für anonyme Wellblechhütten mit seinen allgegenwärtigen Fritten-Buden niedergewalzt; dort wo Reisende, meist kinderreiche Familien zur Insel Borkum eine Verschnaufpause einlegen konnten, gibt’s keine kostenfreien Sitzbänke mehr. Wenn die Architektur der Jahre ein Ausdruck ihre Identität ist, dann hier – austauschbar, identitätslos, unnahbar. Hier singt keine Lolita mehr, „Seemann lass das Träumen“. Hier deprimieren ramponierte Sitzlandschaften und holzverkleidete Wände, auf dem der Hinweis steht: unverzüglich die Fahrausweise beim Bordkassierer lösen. Na denn mal los. Irgendwie klingt es nach Billigheimer, riecht es nach Ausverkauf.
In meinen jungen Jahren heulten jedenfalls die Werkssirene der Nordseewerke zum Pausenende – wie ehedem seit Jahrzehnten. Etwa 550 Schiffe wurden hier seit 1905 gebaut oder auch repariert. Damals galt ein 70 Meter hoher Bock Kran als unverkennbares Wahrzeichen dieser Stadt. Damals und heute? Dumpinglöhne aus Fernost sorgten dafür, dass im Hafen Werften dem Schrott überlassen wurden. Ausverkauf. Überall wie nirgends – ohne Antrieb und Fracht dümpeln Schiffe in den Häfen. Für Notbesatzungen bleiben nur Routine- oder Wachaufgaben zu bewältigen. Wenn Seeleute Abwechslung suchen, bevölkern sie naheliegende Bordelle und verkriechen sich hinterher in ihrer Seemannsmission. Rausch ausschlafen.
Adventszeit in der Seehafenstadt Emden. Das Rathaus am Delft, die große Kirche der Protestanten oder auch das Krankenhaus – bis auf die Grundmauern steht nichts mehr, mithin der Erde gleichgemacht. Emden lag im Zweiten Weltkrieg im Einflugkorridor der alliierten Luftstreitkräfte. 94 Luftangriffe, 1.500 Sprengbomben, 10.000 Brandbomben und 3.000 Phosphorbomben. Fünfhundert Jahre Baugeschichte der Stadt gingen in Flammen auf. Bei Kriegsende zählte die Stadt mit ihren etwa 50.000 Menschen zu den am meisten zerstörten Orten in ganz Europa. Trümmerlandschaften.
Aber schon wenige Jahre später wirkt alles erstaunlich sauber, penibel aufgeräumt. Akkurat flimmern winzige Glühbirnchen an Straßen-Girlanden, zum Verkauf anstehende Weihnachtsbäumen zieren so manchen Luftschutzbunker – in Schräglage. Auf den Fremden wirken die noch verbliebenen 31 Betonklötze in ihrer städtebaulichen Dominanz wie schnörkellose „Zukunftsattrappen“ einer neuen „Schöner-Wohnen-Kultur“. Galgenhumor lebt in einer Gegend, in der raue Böen und nasskaltes Wetter nahtlos in Sturmfluten übergehen. Ostfriesland.
Ein demolierter, vom Rost angefressener Möbeltransporter aus den letzten Kriegsjahren brachte mich am 14. Dezember 1956 mit wenigen Habseligkeiten von einer Grenze zur anderen; von der innerdeutschen Grenze des Zonenrandstädtchens Schöningen an die am Dollart gelegene deutsch-holländische Grenze des ostfriesischen Städtchens Emden. Mein winziger Kinder-Schreibtisch, Transistorradio, Schrank, Bett, Steinbaukasten und rote Schaffnermütze sollten mich begleiten, vorerst noch. Ich konnte nicht ahnen, dass mit diesem Umzug für mich als siebenjähriger Junge ein einschneidender, auch traumatischer Lebensabschnitt begann. Es waren wenige Jahre der Grenzüberschreitungen, der Grenzverluste, Schmerzgrenzen, Höllenängste.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Keine Zeit für Wut und Tränen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Keine Zeit für Wut und Tränen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Keine Zeit für Wut und Tränen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.