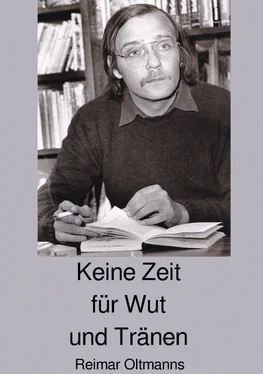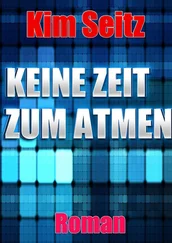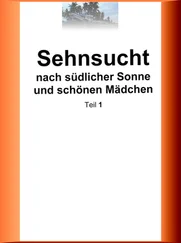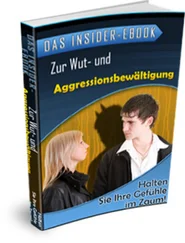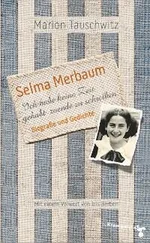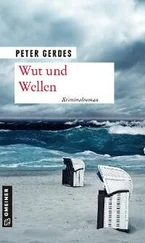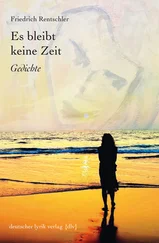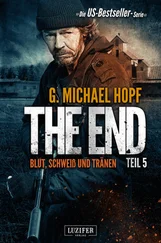Im Zweiten Weltkrieg zerstörten englische Bomberpiloten in 100 Luftangriffen, davon 16 Flieger-Großattacken, 60 Prozent der Wohnflächen – das alte Wilhelmshaven war ein Trümmerfeld. Überall waren grau getönte Luftschutzbunker in Windeseile erbaut worden. Sie boten den Menschen oft tagelang Schutz vor unaufhörlichen Flächen- Bombardements. Die Zahl der Luftkriegstoten belief sich folglich „nur“ auf 435 Opfer. Nach der Kapitulation Hitler-Deutschlands lag die Stadt am Jadebusen in der britischen Besatzungszone und damit unter englischer Befehlsgewalt. Werft- und Kaianlagen – das gesamte Inventar der Kriegsmarinewerft – wurden im Frühjahr 1950 nach England verschifft, Docks und Schleusen gesprengt, Wilhelmshaven praktisch leergeräumt.
Für Russland-Heimkehrer Conny war allein der Name seines Heimatstädtchens in späten Jahren ein Synonym für eine hoffnungsvolle Botschaft des Überlebens. In Jahren entsagungsreicher Kriegsgefangenschaft hatte sich ein Bild festgezurrt; eine Durchhalte-Fiktion; immer wieder gehofft, Tag und Nacht gebibbert – an nichts anders gedacht als an den Tag X – der Befreiung. Das schon im Jahre 1947 uraufgeführte, später verfilmte Schauspiel des amerikanischen Dramatikers Tennessee Williams (*1911+1983) „Endstation Sehnsucht“ entsprach dem auch sentimental überhöhten Lebensgefühl dieser entwurzelten Zeit. Es war einer der ersten Zelluloid-Streifen, die er sich im Roxy-Kino zu Wilhelmshaven zu Gemüte führte.
Nur – in Wilhelmshaven endlich angekommen, da klafften lang gehegte Wünsche, Überlebensträume aus den Gefangenenlagern Russlands mit der sperrigen Wirklichkeit jäh auseinander – nichts ging mehr. Im Juni 1952 lag die Arbeitslosenquote am Jadebusen bei 24,3 Prozent (im Vergleich zum Bund 7,6 Prozent). Es fehlte an allem; an Nahrung, Wohnung, Kleidung, Ärzten und nach der Zerschlagung der hafenwirtschaftlichen Infrastruktur insbesondere an mittelständischen Unternehmen – an Arbeitsplätzen. Es fehlte vor allem an einer neu auszurichtenden Lebensperspektive für jene jungen Männer, die ohne Berufsabschluss am Wegesrand lauerten: Stempeln gehen, auf Fluren ewig Schlange stehen; nur ein dürftiges Stempelgeld sicherte Atemzüge von einem auf den anderen Tag.
Dabei hatte der arbeitslose Conny noch viel Glück auf seiner Seite. Er heiratete die Nachbarin Ingeborg, ein gleichaltriges, gut genährtes Fräulein aus dem zweiten Stock in der Mitscherlich Straße 56 zu Wilhelmshaven. Er lebte, wie sollte es auch anders sein, bei seiner Schwiegermutter unter ihrem Kommando, als Pärchen zur Untermiete auf der Besucherritze allenthalben. Dafür musste Conny aber lediglich sein Köfferchen von der ersten in die zweite Etage tragen. Das tat er gern, liebend gern.
Die frische Schwiegermutter verfügte nämlich über gute diskrete Verbindungen zu Landwirten auf dem Marsch-Ackerland. Folglich herrschte an reichlicher Nahrung kein Mangel. Conny konnte sich stärken, fleißig mitessen. Er mochte fettige Speckschwarten oder die zähe Haut vom Aal – sein Leben lang. Naheliegend, dass Conny mit seiner Ingeborg nicht allein blieb. Sie bekamen zwei Kinder. Tochter Angelika (*1949+2015) und, Sohn Rainer 1953. Nur Ingeborg starb anno 1955 an Nierenversagen, ließ ihn als meist arbeitslosen Tagelöhner der Stadtverwaltung mit seinen beiden Kindern zurück. Ein Witwer mit 30 Jahren.
Dem allgemeinen gesellschaftlichen Klima der jungen Bundesrepublik Deutschland entsprach der CDU-Wahlslogan: „Keine Experimente“ zur Bundestagswahl 1957. Die CDU/CSU gewann mit ihrem Bundeskanzler Konrad Adenauer (*1876+1967) erstmals mit 50,2 Prozent die absolute Mehrheit der Stimmen. Kein Wagnis also, keinen Aufbruch, kein Neubeginn. „Wo ausgebaut und aufgebaut wurde“, schrieb der Frankfurter Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich in seinem 1968 veröffentlichten Buch „Die Unfähigkeit zu trauern“ 19, „geschah es fast buchstäblich auf den Fundamenten, aber kaum noch in einem durchdachten Zusammenhang mit der Tradition. Das trifft nicht nur für Häuser, sondern auch für den Lehrstoff unserer Schulen, für die Rechtsprechung, die Gemeindeverwaltung und vieles andere zu. Im Zusammenhang mit dieser wirtschaftlichen Restauration wächst ein charakteristisches neues Selbstwertgefühl. Auch die Millionenverluste des vergangenen Krieges, auch die Millionen getöteter Juden können nichts daran hindern, dass man es satthat, sich an diese Vergangenheit erinnern zu lassen …“.
Das Antlitz der Adenauer-Jahre wurde getragen von einer bisher einmaligen „Ich-Entleerung“ der Deutschen. Will heißen: unwahrhaftige Anpassung, Verdrängung, vorteilsbedachtes Verhalten, Ja-Sagerei belohnten im Alltag jene, die Hitler noch augenzwinkernd im Herzen trugen. Nur so lässt sich die allseits vorgetragene Theatralik, Verlogenheit mit ihrem unredlichen, degoutanten Beigeschmack nachempfinden. Restauration.
Ausdruck jener „Ich- und Sinn-Entleerung“ dieser dahin dümpelnden Zeit ist das deutsche Liedchen „Ich will ‘nen Cowboy als Mann“ aus dem Jahre 1963; vorgetragen von der dänischen Schlagersängerin Gitte Haenning. Die Schallplatte erreichte nach Veröffentlichung bis 1965 in der Hitparade den ersten Rang mit verkauften 1.050.000 Platten. Sie sang. „Mama sagt: „Nun wird es Zeit, du brauchst nen Mann und zwar noch heut‘! Nimm gleich den von nebenan, denn der ist bei der Bundesbahn! … Aber warum denn nicht Kind, da hast du doch deine Sicherheit, denk doch mal an die schöne Pension bei der Bundesbahn …“.
Dieser scheinbare Ulk- Schlager markierte bei näherer Betrachtung die längst schon vollzogene Entmachtung der Frauen, sogleich das Ende der Frauen-Regie im entsagungsreichen Zweiten Weltkrieg. Die Selbstständigkeit der Frauen in den Rüstungsbetrieben, die Frau als Alleinversorgerin der Familie, im Arbeitsdienst, in der Wehrmacht, in den Fabriken, die Trümmerfrauen, die ihre Hände in den Bombentrichtern verschlissen haben. Rückschritt: Ende der Frauen-Autonomie. Zurück an Heim und Herd. Ohne Murren – widerstandslos
Es wird ein Geheimnis der Trümmerjahre bleiben, warum sich derart viele Frauen in ihrem neu gewachsenen Selbstverständnis abermals umpolen ließen. Manche Gründe lagen in der geschlechtsspezifischen Erziehung der Mädchen bei Hitlers BDM. Hier und nur hier war meiner Mutter eingepflanzt worden, in der Ehe, im Haushalt, in der Mutterschaft der „Heranzüchtung kerngesunder Körper“ das „größte Glück“ zu empfinden, dem Staat als „Gebärmaschine“ zu dienen. Mutter-Freuden als alleiniger Lebensinhalt. Eben gar eine Frau, die keine Kinder hatte oder wollte, galt nun mal in der Gesellschaft als nicht richtig ernst zu nehmendes Weib.
Der Nationalsozialismus in Deutschland hatten tiefe Furchen gezogen, hinterlassen. Er war in seinem Sendungsbewusstsein eine gezielt anti-emanzipatorische Bewegung. Nur wenige Jahre sollten vergehen und meine Mutter gebar zwei Töchter Susanne (1963) und Katrin (1966). Nachvollziehbar, dass diese beiden Mädchen nicht etwa im Studium oder in einem auf Autonomie zielenden Beruf, sondern zuallererst als Hausfrauen mit Kindern ihren Lebensbereich, ihr Denkvermögen absteckten.
Seinerzeit, Mitte der fünfziger Jahre, folgte Conny jedenfalls nicht Gittes Bundesbahn-Aufruf, Schaffner mit Pensionsanspruch zu werden. Er heuerte dafür beim Zollgrenzschutz an. Das Arbeitsamt schickte ihn an die Grenze, weil er Russen und Gewehre kannte. Über 500 Planstellen galt es zu besetzen. Die Engländer hatten ihren „Frontier Control Service“ praktisch eingestellt. Für Conny signalisierte der Neubeginn alte Gesinnungsmuster: Wieder Uniform, wieder Waffen, wieder die Russen – diesmal auf der gegenüberliegenden DDR-Seite im Visier. Vier Wochen hatten er einen Schnelllehrgang absolviert. Dann trat Conny in voller Montur als Zollbeamter der Bundesrepublik Deutschland auf – nunmehr an den „Grünen Grenzen“ zwischen BRD und DDR. Karriere in Nachkriegsjahren.
Читать дальше