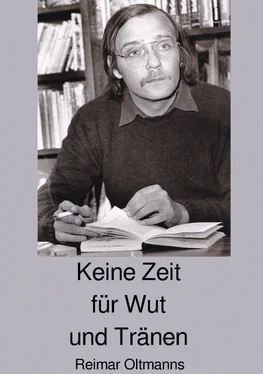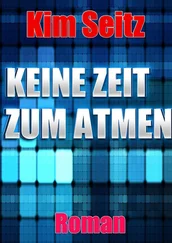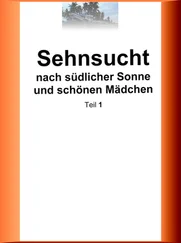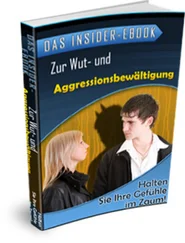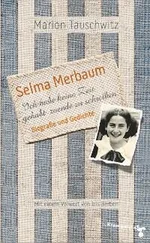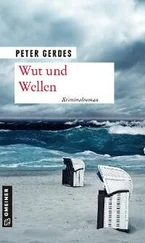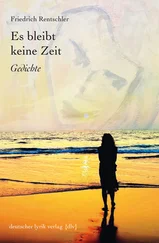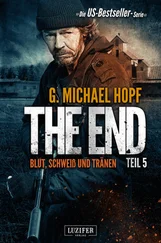Es blieb dem Gymnasiallehrer Burkhard Jäger vorbehalten, mit wissenschaftlicher Akribie in seinem Buch „Nationalsozialismus in Schöningen – Spuren, Ereignisse, Prozesse, 18Folter, Mord – die Judenverfolgung in der Provinz schlechthin – beispielgebend zu verifizieren, zu schildern.
Auszug aus Protokollen: „Zum Schluss der Vernehmung fragte mich …, ob ich Schläge bekommen hätte. Als ich ja sagte, bekam ich Schläge. Er fragte mich, ob ich es noch zu sagen wagte, antwortete ich mit nein. Jetzt bekam ich Schläge, weil ich fälschlicherweise nein gesagt hatte. Als er mich wieder fragte, wusste ich nicht mehr, was ich antworten sollte. Jetzt bekam ich Schläge, weil ich nicht geantwortet habe.“
Am 1. Mai 1933, einem Tage, als im Schwarzen Adler öffentlicher Tanz stattfand, wurde mein Bruder H, ich und ein gewisser K. … in den Tanzsaal geführt und von dem … aus Söllingen dem tanzenden Publikum vorgeführt mit den Worten: „Dies sind die größten Verbrecher aller Zeiten! Die Tanzenden machten sich über uns lustig.“
Erinnert sei hier an den Einzelhändler Abraham Lauterstein – an die Familie Kurt und Helene Heinemann , an den Lebensmittelhändler Kurt Gölsch oder an den Spediteur Hugo Kugelmann und vieler Namenloser dieser Stadt. Private Dramen, die die Seelen zerschmetterten, haben sich abgespielt, immer wieder plötzliche Gewaltausbrüche, schlimmste Misshandlungen, zerschundene Gesichter, bis endlich, ja endlich, ein Viehtransporter die Malträtierten abholte. Atempause, Verschnaufpause. – Bus ins KZ, in den Tod.
Spätestens im Frühjahr 1956 wurde mir mein Fensterplatz auf den Marktplatz zu Schöningen genommen. Ich war noch nicht einmal sieben Jahre alt, gerade erst eingeschult worden. Doch schon als Pennäler der 1. Klasse in der Wallschule schien das Ende meiner Kindheit unwiederbringlich nahe. Wenn ich mich des Morgens auf meinen Beobachtungsposten zubewegte, wurde mir der vertraute Blick auf das Rathaus zur Wasserträgerin, dem Wahrzeichen der Stadt, versperrt.
Irgendjemand muss des Nachts die kleinen quadratischen Butzenscheiben eingeschlagen, das Fenster notdürftig mit Pappe abgedichtet haben. Die ersten Weinflaschen flogen schon nach ein paar Wochen mitten in der Nacht durchs Fensterglas. Auf dem Trottoir lag ein Scherbenhaufen zersplitterter Flaschen, die im Saufgelage oder Partyzerwürfnis infolge erhöhten Alkoholrausches durch die berstenden Butzenscheiben gerasselt sind. – Die Herrschaften schliefen. Am späten Nachmittag sollte ich meine erste Bekanntschaft mit dem damals 31jährigen Conrad Oltmanns machen. Zunächst sagte ich „Onkel Conny“, später musste ich ihn „Vater“ nennen.
Und an Wochenenden krachte weiter Leergut durch die Fensterscheiben, ausgesoffene Bierflaschen auf Gehweg und Marktplatz …
Nächtlichen Männer-Besuch kannte meine Mutter ja schon. Ich musste dann raus aus ihrem Bett, runter von der “Besucherritze“. Mir gefielen besonders jene Herren, die ihre Stimmbänder leise bewegten, mir aber trotzdem etwas zu erzählen wussten und mich mit kleinen Geschenken, wie etwa einen Steinbaukasten, bedachten; der Apotheker „ Onkel Hans“ aus Leipzig, der Fuhrunternehmer „Onkel Erich “ aus Schöningen, der Hotelier „ Onkel Willigerd “ aus Bad Harzburg im Harz.
Nur einen ganz gravierenden Nachteil hatten die stattlichen Herren. Sie konnten ihr Handicap nicht verbergen und wurden deshalb recht bald wieder weggeschickt. Sie waren keine schmuckvollen Uniformträger staatlicher Allgegenwart. Ihnen fehlte ein gewisses, reizvolles Etwas aus Stoff, Farbe und Schnitt, dass bedeutungsvoll die herausragende Zugehörigkeit zur Staatsmacht symbolisierte. Die Uniform als Gradmesser für Glanz und Bedeutung, Parade- oder Gala-Uniformen, Männer-Erotik. Mentalität wie Sehnsüchte nach derlei Oberbekleidung lebte auch nach dem Kriege sinnstiftend fort.
Ob in Schöningen oder anderswo, das Uniformtragen hatte ja gerade unter dem NS-Regime von 1933 bis 1945 große Teile der Bevölkerung neu eingekleidet. Hunderttausende Parteimitglieder der NSDAP, Organisationen wie SA und SS, Wehrmacht, Reichsarbeitsdienst, Hitler-Jugend, Bund Deutscher Mädel. Ihnen allen wurde als Ausdruck ihrer politischen Gesinnung eine Einheitskleidung verpasst. Von dieser apostrophierten Pracht wollte Jutta ein wenig abhaben, sollte sie auch ein bisschen angestrahlt werden, wenigstens ein bisschen. So war sie erzogen worden, so und nicht anders hatte Mutter Jutta die „braune“ Sozialisation verinnerlicht.
Nein – dieser lebendige Bekannte Onkel Conny das war ein richtiger kräftiger Mann, der seinen Karabiner vom Zoll mit sechs Schuss Munition stets griffbereit bei sich trug. Er war praktisch eine Gestalt ohne Alternative, kein Mann der Bücher, keiner von zierlicher Gestalt mit introvertierten Eigenschaften. Jutta schwärmte seit ihrer ersten Begegnung im Café Menzel: „Wenn ich ihn umarme, dann weiß ich, was ich habe und wo ich bin. Einen richtigen Arier mit kräftigen Pranken, blauen Augen. Und eine stattliche Zöllner-Uniform trägt er auch.“
Neue Jutta- Ära schien angebrochen. Das Café Menzel war bekannt für schüchterne Liebesgeschichten, Schummerbeleuchtung am späten Nachmittag. Hier lebte eine Moonlight-Atmosphäre auf anheimelnden Teppichen, Samt wie Seide und natürlich sorgten eindringliche Schnulzen aus der Musik-Box für Nähe und Durchbruch.
Wie selbstverständlich erklang Stunde um Stunde der Hit des Jahres 1956 von Peter Alexander (*1926+2011) : „Ich weiß was, ich weiß was dir fehlt, ein Mann, der dir keine Märchen erzählt.“ Ein Ohrwurm, der kaum vergehen wollte. Das glaubte Mutter Jutta seinerzeit auch. Nach der vierten Café-Menzel- Nacht präsentierte sie mir ihren brandaktuellen Onkel; diesmal in Zoll-Uniform, mit Koppel, Reitbundhose und schwarzen Schaftstiefeln. Es war mein „vierter Onkel“ innerhalb eines guten Jahres. Torschluss-Panik, Hoffnungen und Männer-Verschleiß im Nachkriegs-Deutschland… Conny-Stunden.
Es blieben seltsame, verdichtete, lange anhaltende Augenblicke, in denen der rührselige Heimatfilm das Gemüt der Menschen traf. In der Kinosaison 1955/1956 bevölkerten rund 30 Millionen Bundesbürger die Leinwandsäle. Der „Förster vom Silberwald“, das „Weiße Rössl“. den „Kaiserwalzer“, „Grün ist die Heide“, weckten verstohlene Sehnsüchte – verschämte Wehmut nach Zärtlichkeit und Harmonie. Es war der Heißhunger nach vorgefühltem, halb versteckt erlebten Liebes-Leben auf der Leinwand.
Es ist einer jener lauwarmen, klebrigen Tage, an denen die Sonne dösend über die Wolken des Grenzlandes krabbelt. Im Grenzer-Kontrollhäuschen postiert sich mit seinem Feldstecher der frisch eingestellte Zöllner Conny Oltmanns (*1925+2002). Seit drei Stunden liegt er auf der Lauer gen Osten, seit drei Stunden trällert in regelmäßigen Abständen die Schnulze Freddy Quinns „Heimatlos – Keine Freunde, keine Liebe –, wie es früher einmal war …daran denke ich das ganze Jahr…“ aus seinem Transistorradio. Pathos bis zur Ermüdung. Ein junger Mann vor seinem Radio. Er schaut ins Niemandsland der „Grünen Grenze“ zwischen BRD und DDR. Er fühlt sich als ein Niemand.
Die zwischen den legalen Grenzübergangsstellen liegenden Sektoren bilden im dienstlichen Sprachgebrauch des Zollgrenzdienstes die „Grüne Grenze“. Diese gilt es besonders zu observieren, damit nicht illegale Waren oder unerwünschte Personen in den Westen hineingeschleust werden. Tag wie Nacht beobachten und laufen schwer bewaffnete Wachposten mit scharfen Wachhunden die Demarkationslinie ab. Kalter Krieg zwischen Ost und West.
Stacheldraht und Todesstreifen, das sind zehn Meter breite, akkurat geeggte Spuren. In den 50er Jahren konnte es viele Menschen, Familien mit Kinderwagen bis hin zu bewaffneten Volkspolizisten nicht abschrecken, in den Westen zu flüchten. Insbesondere Nachbarn aus grenznahen Orten fanden immer wieder einen Weg, Hindernisse zu überwinden. Das Dickicht des Waldes kannte viele Raubzüge, Überfälle, Morde. Viele Tragödien fanden hier ihr Ende, Menschen ihren Tod.
Читать дальше