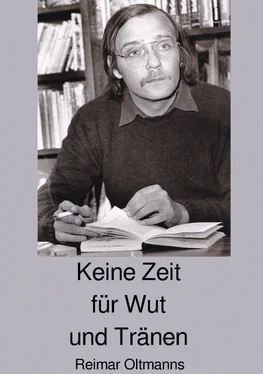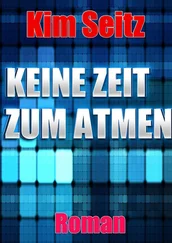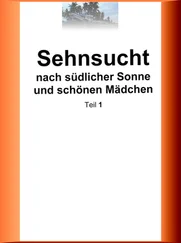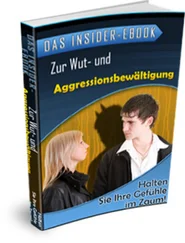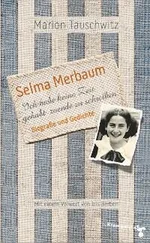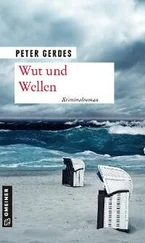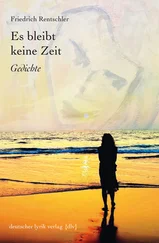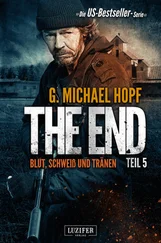Er hatte sich nachweislich wiedergefunden. Zumindest was die Uninformiertheit, männliche Vordergründigkeit, seine blecherne, lautstarke Kommandogewalt betraf. Im Innenleben dürfte ihm längst klargeworden sein, dass er ein Nichtswisser seiner Zeit war und blieb. Das war es ja, was ihn insgeheim so bitter machte, bis in den Jähzorn trieb.
Es blieb für mich ein prägendes, doch reichlich unstimmiges Schlüssel-Erlebnis aus der bis dato weitgehend verschlossenen Männer - Welt. Überraschenderweise stieg Conny vor dem Markt 6 aus einem Taxi aus, schleppte sich und sein Köfferchen nach oben zu meiner Mutter und mir. Dort weinte dieser scheinbar starke, omnipotent wirkende Mann. – Noch nie hatte ich einen Mann weinen sehen. Dort in der kleinen Teeküche betrank er sich hastig, schluckte die Biere als seien es Limonadensäfte. Er wolle sich verabschieden, wenigstens noch Adieu gesagt haben.
„Adios Amigos“ fluchte er und knallte seine Faust auf den Tisch. Meine Mutter zog ihn ins Bett. Adumbran zur Beruhigung. Ein Psychopharmakon, das ihn nunmehr über Jahrzehnte begleiten sollte; Niedergeschlagenheit, Konzentrationsstörungen. Artikulationsblockaden.
In einer Kaserne der Zollschule in Bad Gandersheim hatte Conny über mehrere Wochen versucht, die Eignungsmerkmale für den mittleren Dienst eines Zollbeamten (Zollsekretär bis Amtmann) zu bestehen. Er hatte die deutsche Schrift in der Volksschule gelernt. Nichts weiter. Die allgemein übliche lateinische Orthografie bleibt unberührt. Die Rechenkünste hörten beim einfachen Dreisatz auf. Ein freier Vortrag – etwa vor seiner Klasse – schien nicht möglich. Das Rezitieren von Rechtsverordnungen des Zolls – aussichtslos. Schweiß perlte beim Stottern auf den Boden. Im Lehrgang der Zollschule ging es etwa um Kenntnisse im Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Zolltarifrecht, Strafrecht, allgemeines Steuerrecht usw. etc. Das war nicht Connys Welt. Ungenügend lautete das Urteil, durchgefallen.
Damals, als er aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte, da heiratete er. Als er im Jahre 1957 in der Zollschule zu Bad Gandersheim durchgefallen war, da heiratete er zum zweiten Mal. Dieses Mal am 7. Dezember 1957 vor dem Standesbeamten in Schöningen. „Der eine trage des anderen Last“ hatte das frisch vermählte Ehepaar Jutta und Conrad Oltmanns zur Eheschließung per Zeitungsinserat kundgetan. Zumindest am Abend bei der Hochzeitsfeier mussten die apostrophierten Lasten schon überhandgenommen haben. Alkohollasten. Abermals flogen Flaschen durch die zersplitternden Butzenscheiben aus dem ersten Stock aufs Trottoir. „Aber das Eigene muss so gut gelernt sein wie das Fremde“, formulierte einst der Lyriker Friedrich Hölderlin (*1770+1843) . Nur was bleibt zu tun, wenn keines von beidem stattgefunden haben mag?
Dessen ungeachtet zeigte sich schon am Nachmittag die uniformierte Männer-Gesellschaft in ihrer ganzen Würde. Sie marschierte, nein defilierte in ihren pellfeinen Ausgeh-Uniformen eines Polizisten, Zollbeamten und Bundeswehr-Soldaten auf der pulsierenden Niedernstraße, dem Geschäftsboulevard des Städtchens. Sie gehen so andächtig, sendungs- und siegesgewiss, als sei die deutsche Niederlage im Zweiten Weltkrieg eine Fußnote, ein Versehen gewesen. Hochzeit zu Schöningen.
Am 15. Dezember 1957 war für mich meine Kindheit, die Ära des Reimar Köhler , zu Ende. Seither nenne ich mich Reimar Oltmanns – der Familien-Optik wegen. Ich hatte den neuen Namen anzunehmen. Basta.
Ich verabschiedete mich von meinem Freund Ulrich Wegener von der Lotto-Annahmestelle , mit dem ich so manche Roller-Fahrten an die Grenze und in den Elm riskiert hatte. Seine Familie wanderte mit Uli im Gepäck wenig später nach Kanada aus. Ich streichelte noch einmal den Dackel Menne . Er lag Tag für Tag genügsam vor dem Brunnen der Wasserträgerin – der symbolträchtigen Bronzefigur vor dem Rathaus. Obacht gab er. Menne war in all den Jahren irgendwie schon zu meinem Wegbegleiter geworden.
Ich schämte mich meiner Kindertränen, wollte im Grunde des Herzens nicht aus dem Heimatstädtchen Schöningen fortgerissen werden. Ich weinte viel an versteckten Plätzen „Im stillen Winkel auf der Bodentreppe, dem abgelegenen Zufluchtsort der Kleinen, klag ich heut stumm um mein zerbrochenes Leben, o hätte ich Tränen – könnt ich heut weinen“, dichtete um Jahrzehnte früher die Lyrikerin Leon Vandersee 20alias Helene Tiedemann. Mir schien es so, als habe sie diesen Vers für mich geschrieben.
Ein Möbelwagen brachte uns in die vielerorts gespenstisch anmutende, zu achtzig Prozent ausgebombte Seehafenstadt Emden mit ihren knapp 50.000 Menschen. Der Zweite Weltkrieg lag schon mehr als ein Jahrzehnt hinter uns. Nur in dem einst hoch gerüsteten Ostfriesen-Städtchen hatte der Atem gespreizter Kriegs-Ängste zu überleben vermocht. Eigenartigerweise roch es noch nach Kanonen, Panzer, Soldatenhelmen. Schmauchspuren. Es waren britische Tanks, die auf Eisenbahn-Waggons Zug um Zug zum Abtransport auf Schiffe gen England rollten.
Überall lauerten im Ortskern Erdlöcher, Bomben-Krater, Luftschutzbunker, Kleinbunker, überall Schutt, aufgerissene Straßen, zersprengte Ruinen, meterdicke Betonmauern. Friedhofsruhe. Fischgestank vom Heringshafen. Das war Emden.
Die Straßen in den Abendstunden fast menschenleer. Emden lag im Nebel. Nur hier wie dort zerborstenes Gemäuer, Stahl-Bunker nah, Beton-Bunker noch näher – Sirenen überall. Das Hauptzollamt, eine frisch erbaute Trutzburg des jungen Staates Bundesrepublik, wurde einstweilen mein Domizil. Die Behörde hatte einen neuen Zollwachtmeister des einfachen Dienstes eingestellt. Er war der Hausmeister und nannte sich Conny. Aber immerhin eine kleine Dachgaube ist mir in der Wachtmeister-Wohnung geblieben. Obacht – Beobachtungen. Nicht mehr auf den Marktplatz zu Schöningen; nunmehr auf Zöllner, Kirchen, Schulen, Klinkerbauten, Seeleute, Heimatvertriebene fern von zu Hause. Es sollten Jahre werden, in denen ich mich mehr als nur einmal um mein junges Leben zu fürchten hatte.
Wie formulierte der Leipziger Philosophie-Professor Christoph Tücke 21einprägsam: „Und Heimat wird erst, wo zuvor Schock, Trennung, Beschädigung waren. Heimat kann sie nie ganz rückgängig machen. Wohl aber bis an den Rand der Unkenntlichkeit mindern und lindern.“ Damals hätte ich allzu gern in Erfahrung bringen wollen, welche Gefühle das Wort Heimat in mir auslösen sollten. Ich fragte mich schon, wie stark der Geburtsort Schöningen mein Alltags-Empfinden besetzt hatte. Fremdheits-Augenblicke begleiteten mich ausgerechnet an jenen Ort, an dem mir ein neues Zuhause zugewiesen worden war. Wieder nach Schöningen?
Jedenfalls traf ich in meiner neuen „Heimat“ Emden keine Zugehörigkeit, keine Begegnungen, keine Spielkameraden, vermittelte Erlebnisse über dieses Land schlechthin, die Heimatgefühle der Verbundenheit entstehen ließen. Aus mir konnte jedenfalls kein deutscher Patriot werden. Seither ahnte ich es schon, irgendwie fühlte ich mich in keiner Erde verwurzelt, irgendwie schon heimatlos, durch Kontinente wie Städte ziehend, vielleicht auch immer wieder fliehend; nirgendwo auf Dauer ankommend, immer auf der Suche zu sein. Warum?
Erst Jahrzehnte später bekam ich auf meinen Stationen durch ferne Länder eine vage Vorahnung davon, dass eigentlich nur die Muttersprache – die deutsche Sprache – meine Heimat war und ist – eben ein Herkunftsland ohne Heimatgefühl. Für mich ist die mit Pathos hochgepriesene Heimat ein flüchtiger Zustand des Augenblicks, der Sehnsucht bedeutet.
Bei Hitlers am Küchentisch - Zu Hause im Hauptzollamt in Emden/Ostfriesland
Die schönste List Des Teufels ist es, Uns zu überzeugen, Dass es ihn nicht gibt.
Читать дальше