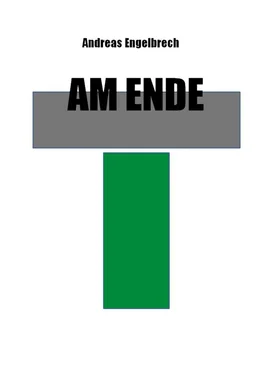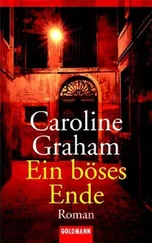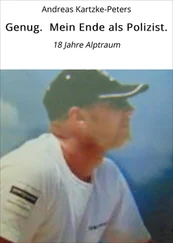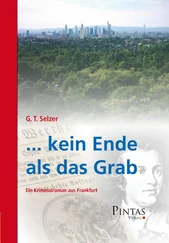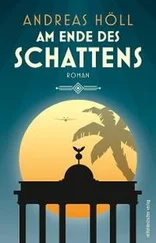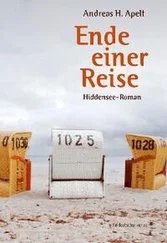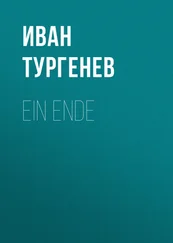Die ausstellenden Künstler selbst erfreuten sich einer Aufmerksamkeit, wie sie sonst nur Filmstars mit Rekordgagen und Königskinder bei Märchenhochzeiten erhielten.
„Herr Jensen-Mendez. Die Nachricht von Ihrer schweren Erkrankung hat nicht nur die Kunstwelt sehr betroffen gemacht. Weltweit wird Anteil an Ihrem Leid genommen. Gleichzeitig gibt es aber auch kritische Stimmen, die ihr angekündigtes Ende als einen sehr gelungenen Werbegag bezeichnen. Immerhin hat sich der Wert Ihrer Werke in kürzester Zeit vervielfacht. Und wenn die Meldungen stimmen, sind sämtliche Ihrer Skulpturen ausverkauft.“
„Ich kann Ihnen versichern, dass mein baldiges Ende kein Werbegag ist. Ich kann schon sehr lange nicht mehr lachen. Es ist wahr, dass meine Werke so teuer wie noch nie verkauft wurden. Von dem Geld werde ich aber nichts mehr haben.“ Der für die Kunstszene mäßig kritisierte Bildhauer nutzte die Gelegenheit, um sich ruhig und souverän zu verteidigen. Zu einer anderen Zeit wäre er gnadenlos von Kritikern und Kunstexperten in den Medien zerrissen worden. Derzeit lebte die Kunstwelt jedoch im Ausnahmezustand.
„Begründet werden die Vorwürfe damit, dass sie keine äußeren Anzeichen einer schweren Erkrankung aufweisen. Mediziner haben die neuesten Aufnahmen von Ihnen ausgewertet. Keiner hält Sie für todkrank. „Der Journalist ließ nicht locker und bohrte weiter: „Im Gegensatz zum 20. Jahrhundert sind alle Krebsleiden heilbar, Erbkrankheiten behandelbar. Woran leiden Sie?“
Der angesprochene Künstler ließ sich durch die Vorwürfe nicht aus der Ruhe bringen. Er atmete tief durch und sprach dann mit ruhiger, tiefer Stimme: „Morgen werden Sie es erfahren. Der heutige Abend ist etwas Besonderes. Ich kann mich nicht erinnern, dass eine Kunstausstellung schon einmal so viel Aufmerksamkeit erhalten hat.“ Er machte eine kleine Pause und signalisierte dem Journalisten, dass er noch weiterreden wollte.
„Es ist richtig, dass ich die vergangenen Tage sehr viel Geld verdient habe. Keines meiner Werke wurde für weniger als fünf Million Euro verkauft. Mit dem Erlös habe ich Rechnungen beglichen.“ Damit verabschiedete sich der im Mittelpunkt des nicht nur kulturellen Interesses Stehende, ohne zu erklären, welche Schulden er zu beglichen hatte. Unüblich war es nicht, dass erfolgreiche Künstler einem aufwendigen Lebensstil nachgingen.
Die Beamtin in der Kommunikationszentrale des Pariser Überwachungsdienstes hatte ihren ersten Arbeitstag. Sie hatte sich für den Innendienst beworben, nachdem sie im Frühjahr eine Fehlgeburt erlitten hatte und sich für den Streifendienst nicht mehr geeignet hielt. Sie war zuständig für die Entgegennahme und Verteilung von Nachrichten, die als vertraulich eingestuft waren.
Als Einstand für ihre neuen Arbeitskollegen hatte sie Obstkuchen mitgebracht. Während die Kaffeemaschine zischte und brodelte, schnitt sie den Kuchen auf. Gerade als sie das erste Stück auf einen der Teller legen wollte, begann das Faxgerät zu rattern und piepsen. Sekunden später wurde sie bleich. Das Kuchenstück viel zu Boden, gefolgt von zwei Tellern, die sie in ihrer Aufregung vom Tisch stieß. Sie hatte den Code auf dem Fax mit dem Code verglichen, der neben all den Empfangsgeräten in einer Folie eingeschweißt auf eine Schranktür geklebt war. Versehen mit dem Vermerk „Streng Vertraulich“, nur zugänglich für besonders ausgewähltes, vertrauenswürdiges Personal.
Zeitgleich mit einem Kollegen in Madrid las sie den Text: „Bilbao. Guggenheim-Museum. Gefährden Sie diesmal keine Menschenleben! Grosse Explosion um 23.30 Uhr Ortszeit. Bestätigungscode: OZSLJFU673X. Neuer Code: WSFEO)§“3746OLUW.“
Zeitgleich mit ihrem Kollegen in Madrid blickte sie auf die Uhr: 22.17 Uhr.
Die Meldung wurde unverzüglich durch den diensthabenden Direktor des Überwachungsdienstes an seinen Kollegen in Bilbao weitergegeben. Dieser hatte kurz zuvor die gleiche Warnung von seinem Vorgesetzten in Madrid erhalten und bereits den Notfallplan anlaufen lassen.
Als der Franzose den Hörer auflegte, fragte er den Beamten, der mit den Daten des Telefaxanschlusses in sein Büro stürmte: „Aus welcher gottverlassenen Gegend der Welt kam das Fax diesmal?“
Die Antwort war kurz und alles andere als erwartet: „Paris. Hier aus Paris.“
Fünfunddreißig Minuten später öffnete ein Sondereinsatzkommando einen blauen Lieferwagen in einer Tiefgarage im Zentrum. Das schnurlose Telefaxgerät wurde aufgrund seiner Mobilfunksignale in dem Mietwagen geortet. Die Spezialisten gingen äußerst vorsichtig vor, da Sprengstoffspürhunde das Vorhandensein von explosiven Stoffen anzeigten. Wie sich herausstellte, hatten die feinen Hundenasen winzige Spuren eines hochexplosiven Stoffes in dessen leerer Verpackung erschnüffelt.
Die Nachricht löste eine an Panik grenzende Hektik in Bilbao aus. „Das Museum und die Umgebung muss sofort und restlos evakuiert werden. Alle müssen das Gebäude räumen. Niemand darf zurückbleiben. Vermutlich ist eine halbe Tonne des fürchterlichsten nicht-nuklearen Sprengstoffes in dem Gebäude verteilt. Von den Tätern fehlt immer noch jede Spur.“
Der stellvertretende Direktor des Überwachungsdienstes lehnte sich in der Zentrale in seinen Sessel zurück, als er die Nachricht an seinen Vorgesetzten im Guggenheim-Museum übermittelt hatte. Er selbst war hier sicher und konnte derzeit nicht mehr tun als zu beobachten und bei Bedarf steuernd eingreifen. Und darauf zu warten, dass sein Team ihm die Nachrichten der eingesetzten Sicherheitskräfte zukommen ließen, die sie zuvor von Unwichtigkeiten gefiltert hatten.
Er konnte nicht mehr tun, als auf einer Vielzahl von Monitoren, die aufgrund der feierlichen Wiedereröffnung des Guggenheim in Bilbao eigens in seinem Büro aufgestellt wurden, die Räumung des Museums zu verfolgen. Die Sicherheitsleute gingen effizient und geschult vor, wirkten beruhigend auf die Menschen ein und unterbanden so von Anfang an Panik. Vor dem Gebäude wurden Schaulustige und Medienvertreter zum Verlassen der Umgebung des in bunten Lichts getauchten Metallkomplexes aufgefordert. Die Zeit drängte. Fieberhaft begannen Sprengstoffteams das Gebäude zu untersuchen. Immer in dem Bewusstsein, dass sie nicht mehr viel Zeit hatten.
Dabei wollte er nicht glauben, dass sich eine Bombe in dem Museum befand. Alles war genau untersucht worden. Jeder Besucher, jeder Lieferant, jeder Angestellte. Sprengstoffspürhunde suchten mehrmals jeden Winkel ab. Nichts. Er hätte es nicht für ernst genommen, nicht so ernst, wenn es nicht der Code gewesen wäre. Der Code! Der Code, welcher mit zwei bereits verübten spektakulären Attentaten warnte. Davor warnte, die Drohung nicht ernst zu nehmen.
„Ihr habt noch 19 Minuten. Um 23.20 Uhr muss jeder das Gebäude verlassen haben.“ Der stellvertretende Direktor sprach mit einem Zugführer, der ihm die Räumung der Sonderausstellung meldete. Als der Polizist schnellen Schrittes den Saal verließ und damit auch vom Monitor verschwand, zeigte die Kamera im Hintergrund das „Trojanische Pferd“.
Die Reaktion des Mannes vor dem Monitor war eine Mischung aus Schock und Entsetzen:„Oh, mein Gott!“
Die Dachterrasse der Königssuite bot einen herrlichen Blick auf das Guggenheim-Museum. Der silberne Gebäudekomplex mit seinen geschwungenen Flügeln und Ausläufern erstrahlte im Glanz zehntausender, teils farbiger Glühlampen und riesiger Scheinwerfer, die sich zum Teil überkreuzten und in grellen Säulen in den Himmel strahlten.
Thomas Jensen-Mendez zog die bereits geöffnete Champagnerflasche aus dem Eiskübel und goss die prickelnde Flüssigkeit in ein elegant geschwungenes Glas. Nach einem Blick auf seine Uhr, die 22.28 Uhr zeigte, trank er das Glas aus und füllte es erneut. Zwei blaue Tabletten, die neben dem Eiskübel auf dem Tisch lagen, nahm er auf und schob sie behutsam in seinen Mund. Dann spülte er die viereckigen Pillen mit einem kräftigen Schluck hinunter.
Читать дальше