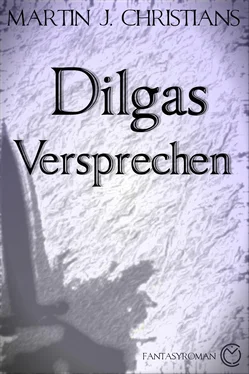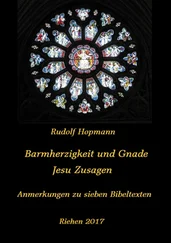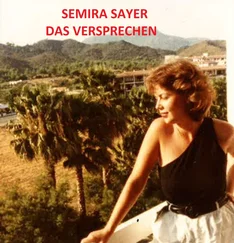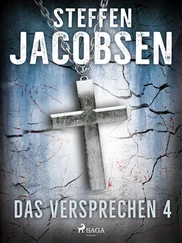Martin J. Christians
Dieses eBook wurde erstellt bei neobooks.com
Inhaltsverzeichnis
1.Kapitel
2.Kapitel
3.Kapitel
4.Kapitel
5.Kapitel
6.Kapitel
7.Kapitel
8.Kapitel
9.Kapitel
10.Kapitel
11.Kapitel
12.Kapitel
13.Kapitel
14.Kapitel
15.Kapitel
16.Kapitel
17.Kapitel
18.Kapitel
19.Kapitel
20.Kapitel
21.Kapitel
22.Kapitel
23.Kapitel
24.Kapitel
25.Kapitel
26.Kapitel
27.Kapitel
28.Kapitel
29.Kapitel
30.Kapitel
Wasser! Dilga stolperte vorwärts. Ein kleines Rinnsal sickerte aus der Felswand. Wie ein glänzendes Tuch rann das Wasser am grauen Stein herab und sammelte sich darunter in einem flachen Becken. Unsicher warf er einen Blick zurück.
Seine Verfolger waren zurückgeblieben. Aber warum? Seine Spur hatten sie unmöglich verlieren können. Er kannte diese Berge nicht und war von einer Sackgasse in die nächste gestolpert, nur um am Ende auf diesem Weg zu landen. Ein schmaler steiniger Pass, der sich immer weiter den Berg hinauf schlängelte.
Erschöpft sank er neben dem Bassin auf die Knie. Das Wasser war vollkommen klar, so dass er bis auf den Grund sehen konnte. Ein rissiger Boden, durch den das Nass wieder in den Berg zurück tröpfelte. Zögernd tunkte er eine Hand hinein. Es war kalt und versprach Frische. Wie Sandpapier fuhr seine Zunge über die spröden Lippen. Alles in ihm schrie danach sich auf den Bauch zu legen und zu trinken. Er roch an den Tropfen, die seine Finger hinab rannen, ohne einen Geruch feststellen zu können.
Dilga benetzte sich die Lippen. Unwillkürlich fuhr seine Zunge aus dem Mund und leckte einen Teil des Wassers ab. Sein ausgedörrter Körper verlangte nach mehr. Mit beiden Händen schöpfte er das kühle Nass. Am Ende war es gleich, ob ihn der Oligarch umbrachte oder vergiftetes Wasser.
Er beugte sich nach vorn über das Wasserloch und musste die Augen schließen. Ihm war schwindelig. Die gnadenlose Hetzjagd durch die winterlichen Berge forderte endgültig ihren Tribut. Seine Peiniger hatten ihn absichtlich das eine oder andere Mal entkommen lassen. Zu sehr genossen sie ihre Menschenjagd. Nicht auszudenken, welche neue Teufelei sie jetzt ausgeheckt hatten. Er zwang sich seine Augen wieder zu öffnen.
Ein riesiges funkelndes Auge starrte ihn aus dem Wasserloch heraus an. Entsetzt fuhr er zurück und prallte mit dem Rücken gegen ein Hindernis. Mit einem heiseren Schrei wirbelte er herum. In einem antrainierten Reflex fuhr seine Hand an die linke Seite. Vergeblich griff sie nach dem fehlenden Schwert.
Das Auge, das ihn aus dem Teich heraus angestarrt hatte, gehörte zu einem Monster. Einem Untier mit rotem Fell, das ihn um eine halbe Körperlänge überragte. Dazu kamen noch Schwingen, die es zusammengefaltet auf dem Rücken trug. Es stand aufrecht auf den Hinterbeinen, wie ein Mensch.
Die beiden Klauen, mit den messerscharfen Krallen, streckten sich nach ihm aus. Dilgas Blick blieb an den grausamen spitzen Zähnen hängen. Sein Verstand weigerte sich zu akzeptieren, was da vor ihm stand. Ein Satyr! Voller Panik kroch er aus der Reichweite der Pranken und stemmte sich auf die Füße.
Das Monster hielt den Kopf schräg und musterte ihn eine Weile, dann grapschte es nach ihm. Erschrocken schlug er die Klaue beiseite. Es zischte ärgerlich und griff erneut nach ihm.
Dilga wich aus. Verzweifelt hielt er Ausschau nach etwas, das ihm als Waffe dienen konnte. Aber es gab nichts.
Entschlossen trat er dem Satyr vors Schienbein und bereute es. Es fühlte sich an, als ob er gegen einen Baum getreten wäre. Aber wenigstens keuchte auch sein Gegner vor Schmerz.
Unvermittelt schlug der Satyr zu. Die Klaue traf ihn am Kinn. Seine Zähne schlugen aufeinander, dann schmeckte er Blut und ging zu Boden.
Das Untier beugte sich über ihn, packte seine Handgelenke und riss ihn hoch. Dilgas Herz raste vor Angst. Gleichzeitig blieb ein Teil von ihm ruhig, schätzte seine Möglichkeiten ab.
Der Satyr hatte sein Gewicht nach vorn verlagert. Mit aller Gewalt warf Dilga sich gegen sein Standbein. Der Satyr strauchelte, ließ aber nicht los.
Gemeinsam stürzten sie zu Boden. Das Monster war stark und unglaublich schnell. Einen Augenblick rangen sie miteinander, dann drückte der Satyr ihn mit seinem Gewicht zu Boden. Dilga rang nach Luft.
Der Satyr lachte. Verblüfft vergaß er seine Gegenwehr. Der Satyr lachte wie ein Mensch; nicht sehr laut und auch nicht bösartig. Es klang eher amüsiert.
»Genug gezappelt, Mensch?«
Es sprach! Das Monster hatte ihn angesprochen, mit einer angenehm dunklen Stimme und deutlich artikulierten Worten. Dass der Satyr keine hirnlose Bestie war, hatte er schon während des kurzen Kampfes gemerkt. Aber er war auch intelligent genug, um zu reden.
»Füge dich in dein Schicksal, Mensch. Du kannst mich nicht besiegen.«
Das rote Gesicht näherte sich Dilgas, bis der spitz vorstehende Bart ihn fast berührte. Heißer Atem streifte seine Wange. Er drehte den Kopf weg. Der Satyr hatte Recht. Ohne Waffen hatte er keine Chance gegen ihn.
Zum wiederholten Mal verfluchte er Oleg. Der verdammte Oligarch, der ihn gezwungen hatte, waffenlos und ohne Rüstung in die ihm fremden Berge zu fliehen. Er hatte nichts mehr, außer seiner dünnen Kleidung und den abgetragenen Stiefeln.
Der Satyr entfaltete seine schwarzen Flügel. Das ließ ihn noch riesiger erscheinen. Unwillkürlich zuckte Dilga zurück und stieß sich den Kopf am harten Felsen.
»Vorsicht, Mensch!«, lachte der Satyr.
Dieses Lachen zerrte schlimmer an seinen Nerven, als ein geiferndes Tier, das knurrend über ihm saß. Die Augen musterten ihn mit einer Mischung aus Spott und Neugier.
»Mensch?« Der Bart berührte seine Wange. Die Haare waren hart und kratzten auf seiner Haut, wie die Feile eines Schmiedes. »Du stirbst mir doch nicht vor Angst?« Der Satyr schnupperte. »Du hast Angst. Ich kann es riechen.«
Was wollte das Untier von ihm? Die Geschichten, die man sich über die Satyr erzählte, wirbelten in Dilgas Kopf durcheinander. Allen war gemein, dass sie als blutrünstige Bestien galten. In keiner wurde auch nur angedeutet, dass sie sprechen konnten. Er selbst hatte sie für eine Legende gehalten, mit der Eltern ihre unartigen Kinder erschreckten. Bis vor wenigen Minuten jedenfalls. Wenigstens wusste er jetzt, warum Oleg die Verfolgung eingestellt hatte.
»Rede mit mir, Mensch!«, forderte der Satyr ungeduldig. Eine der Klauen grub sich tief in seine ungeschützte Schulter und Dilga stöhnte. »Stumm bist du jedenfalls nicht«, stellte der Satyr zufrieden fest. »Soll ich dir wehtun oder sprichst du freiwillig mit mir?«
Das Herz schlug Dilga bis zum Hals. Dass er kaum atmen konnte, lag nicht nur am Gewicht seines Gegners. Sein leichenblasses Gesicht spiegelte sich in den Augen seines Kontrahenten und hatte im Augenblick wenig Ähnlichkeit mit dem eines kampferprobten Kriegers.
»Menschen reden doch sonst so gern. Ich höre sie, wenn sie durch meine Berge lärmen«, lachte er bösartig. »Sie schreien selbst dann noch, wenn sie ihre Luft lieber zum Rennen verwenden sollten.«
»Was willst du?«, fragte Dilga unsicher.
Genugtuung blitzte in den dunklen Augen auf. Der Satyr hatte einen weiteren Sieg über ihn errungen und er genoss es. »Reden.«
»Reden?«, hakte Dilga ungläubig nach.
»Dein Geruch ist interessant«, bemerkte der Satyr.
Interessant? Hoffentlich bedeutete das nicht lecker! Sein Inneres verkrampfte sich. Viele Geschichten erzählten, dass die Satyr Menschenfresser waren. Sie rissen einem bei lebendigem Leib die Knochen auseinander, hieß es. Dilga unterdrückte seine Angst. Er musste etwas sagen. Irgendetwas, um das Monster zufrieden zu stellen.
Читать дальше