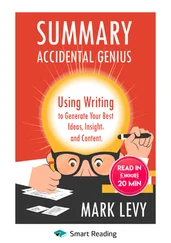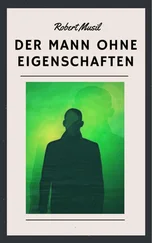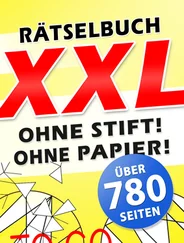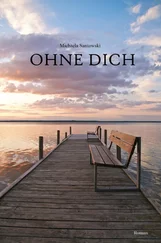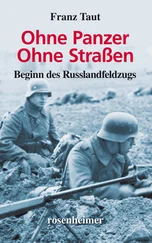Menschliche Arbeit (physische und geistige Leistungen) war und ist in den meisten Güterproduktionen die wichtigste Ressource. Konstitutiv für das Eigentumsrecht an produzierten Gütern ist jedoch nicht, welche Person die Arbeit leistet, sondern welche Person/en das Eigentumsrecht an der geleisteten Arbeit hat/haben. In der Mehrzahl der Güterproduktionen geben die Personen, welche die Arbeit ausführen, ihre (Erst-)Eigentumsrechte an ihrer Arbeitsleistung und damit auch ihr Eigentumsrecht an deren Ergebnis freiwillig oder zwangsweise an andere Personen ab. Diese Übereignung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Der Sklavenhalter hat per se die Eigentumsrechte an der von seinen Sklaven geleisteten Arbeit, weil er Eigentümer der Sklaven ist. Der kapitalistische Unternehmer kauft seinen Arbeitern, Angestellten oder freiberuflich Tätigen das Eigentumsrecht an ihren Arbeitsleistungen durch Geldzahlungen ab. Der Buchverleger erwirbt von seinen Autoren die ökonomischen Eigentumsrechte (Verwertungsrechte) an ihren Manuskripten durch Geldzahlungen (Pauschalbetrag und/oder Umsatzbeteiligung). Für die Herstellung der meisten Güter wird neben den Arbeitsleistungen eine Vielzahl weiterer Ressourcen (Grund und Boden, Produktionsräume, Werkzeuge, Materialien, Dienstleistungen etc.) benötigt. Auch die Eigentumsrechte an diesen Ressourcen muss der Eigentümer des Produktionsprozesses besitzen, er braucht allerdings nicht das ganze Bündel der Eigentumsrechte, sondern nur ein ganz bestimmtes Recht daraus – das sogenannte Fruchtziehungsrecht ( usus fructus ). Das ist das Recht, die ökonomischen Erträge, die mit der Nutzung der betreffenden Ressource generiert werden, zu behalten. Der Begriff Fruchtziehungsrecht wird in der deutschen Rechtssprache üblicherweise nur bei Pacht- und Mietverträgen verwendet. Diese Rechtsbeziehung gibt es jedoch bei allen am Produktionsprozess beteiligten Ressourcen. Ich werde für diese Komponente von Eigentumsrechten den Begriff Ertragsrecht verwenden. Dieser Begriff ist meines Wissens weder in der juristischen noch in der wirtschaftswissenschaftlichen Fachsprache fest besetzt. Im kapitalistischen Wirtschafts- und Rechtssystem kann man die Ertragsrechte an den einzelnen Ressourcen durch unterschiedliche Vertragsbeziehungen erwerben:
– Arbeitsleistungen (Festanstellung, Honorar-, Dienst- oder Werkvertrag),
– Grund und Boden (kaufen, pachten),
– Produktions- und Büroräume (kaufen, mieten),
– technische Geräte (kaufen, mieten, leasen),
– Arbeits- und Hilfsmaterialien (kaufen),
– Dienstleistungen (kaufen).
Für neu produzierte Güter lautet das dritte Grundgesetz des Eigentums also: Im Prozess der Produktion eines Guts erfolgt ein Rechtetransfer von den Produktionsressourcen an das Produkt. Die Ertragsrechte an den personellen, stofflichen und geistigen Ressourcen des Produktionsprozesses werden an das neu geschaffene Gut transferiert (= vererbt). Die Summe der Ertragsrechte an allen in der Produktion eingesetzten (wertschöpfenden) materiellen und personellen Ressourcen begründet das Eigentumsrecht an den neu geschaffenen Gütern. Ausschlaggebend sind immer die Ertragsrechte an den beiden wichtigsten Produktionsressourcen – Arbeitsleistungen und Produktionsmittel. Die Summe der Ertragsrechte an den Produktionsressourcen konstituiert die erste Eigentumsbeziehung neu geschaffener Güter. Je nach Art des neu produzierten Guts umfasst diese Eigentumsbeziehung unterschiedliche Teilrechte.
(Erst-)Eigentümer eines neu geschaffenen Guts ist/sind der/die Akteur/e, der/die die Ertragsrechte an allen wertschöpfenden Ressourcen des Produktionsprozesses hat/haben.
Dieser Wirkungszusammenhang des dritten Grundgesetzes besteht unabhängig davon, auf welche Weise der/die Gesamteigentümer des Produktionsprozesses die Ertragsrechte an den Produktionsressourcen, insbesondere an den beiden wichtigsten – Arbeitsleistungen und Produktionsmittel – erlangt hat/haben. In der Geschichte der Menschheit gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Handlungen, mittels derer der Gesamteigentümer der jeweiligen Güterproduktion diese Ertragsrechte erlangen kann, bspw. durch ökonomische Tauschhandlungen (s. o.), aber auch mittels politischer oder/und rechtlicher Machtakte verschiedenster Art.
Aufgrund des Vererbungsprinzips ist dem Eigentumsrecht an neu geschaffenen Gütern eine elementare soziale Gerechtigkeit ureigen. Das Erst-Eigentumsrecht schließt die Nichteigentümer nämlich von der Verfügungsgewalt über ein Gut aus, das es allein deshalb gibt, weil es der Eigentümer des Produktionsprozesses mit „seinen“ Ressourcen geschaffen hat. Den Nichteigentümern wird nichts weggenommen, das ihnen vorher gehörte, sondern sie werden von der Verfügungsgewalt über ein Gut ausgeschlossen, das allein deshalb existiert, weil es der Eigentümer des Produktionsprozesses mit seinen Ressourcen geschaffen hat. Die Nichteigentümer sind also nicht schlechter gestellt als vorher, als es dieses Gut noch nicht gab. Auf diese Weise erhalten Eigentumsbeziehungen bei ihrer Geburt die Weihe sozialer Gerechtigkeit. Diese ureigene soziale Gerechtigkeit ist einer der Gründe, warum Nichteigentümer in der stofflichen Welt ihr Ausgeschlossen-Sein von der Verfügungsgewalt über ein Gut im Regelfall als normal erachten und mit Verständnis akzeptieren und respektieren.
Das Vererbungsprinzip erklärt auch, warum die Eigentumsrechte an den Produktionsmitteln in der Offlinewelt so großes Herrschaftspotenzial für die gesamte Gesellschaftsorganisation haben. Die Produktionsmittel sind in der Offlinewelt nämlich im Regelfall die teuerste Ressource des Produktionsprozesses. Der Eigentümer dieser Ressource ist deshalb Eigentümer des gesamten Produktions- und Wertschöpfungsprozesses und damit Eigentümer der neu produzierten Güter. Mit den neu produzierten Gütern hat der Eigentümer der Produktionsmittel die Verfügungsgewalt über die essenzielle Lebensbasis der Reproduktion sozialer Systeme.
Es ist eine Binsenweisheit der Marktwirtschaft, dass nicht die Arbeitnehmer, die die Arbeit in der Produktion leisten, Eigentümer der neu geschaffenen Güter sind, sondern ihr Arbeitgeber. Gleichwohl ist die Maxime „Arbeit schafft Eigentum“ ein Gemeinplatz des Alltagsbewusstseins. Für die unerschütterliche Plausibilität dieser Fehlwahrnehmung gibt es meines Erachtens zwei Erklärungsgründe:
1) Für Güterproduktionen im Privat- und Freizeitbereich trifft diese Maxime zu. Freizeitproduzenten sind üblicherweise Eigentümer aller Ressourcen des Produktionsprozesses – sie sind Eigentümer sowohl ihrer eigenen Arbeitsleistung als auch der Arbeitsmaterialien und Arbeitsmittel. Deshalb sind sie zu Recht Eigentümer der von ihnen hergestellten Güter.
2) Die Maxime „Arbeit schafft Eigentum“ gilt auch für den Arbeitsmarkt. Die meisten Menschen arbeiten, um private Eigentumsgüter zu erwerben. Als Bezahlung für ihre Arbeitsleistungen oder für Produkte, die sie mit ihrer Arbeit geschaffen haben, erhalten sie monetäres Eigentum, mit dem sie Eigentumsgüter aller Art erwerben können.
Die Semantik der Begriffe Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertauscht die tatsächlichen Handlungen beider Akteure, denn der Arbeiter/Angestellte gibt dem Unternehmer seine Arbeitsleistung und der Unternehmer nimmt die Arbeitsleistung vom Arbeiter/Angestellten.
„Damit ihr Besitzer sie als Ware verkaufe, muß er über sie verfügen können, also freier Eigentümer seines Arbeitsvermögens, seiner Person sei. Er und der Geldbesitzer begegnen sich auf dem Markt und treten in Verhältnis zueinander als ebenbürtige Warenbesitzer, nur dadurch unterschieden, daß der eine Käufer, der andere Verkäufer, beide also juristisch gleiche Personen sind.“ (  MEW 23, S. 182)
MEW 23, S. 182)
Читать дальше
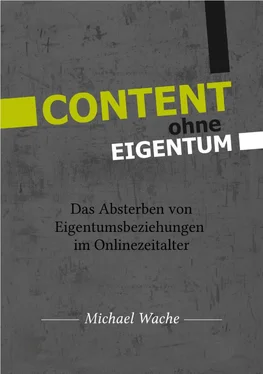
 MEW 23, S. 182)
MEW 23, S. 182)