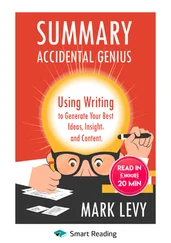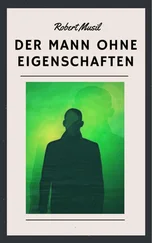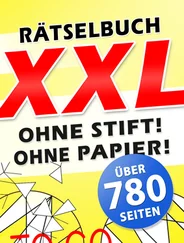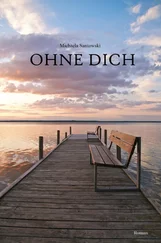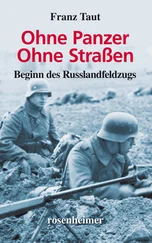In der Geschichte der Eigentumstheorien finden wir auf die Frage, wie Menschen Erst-Eigentumsrechte an Gütern erwerben, zwei Antworten: durch Okkupation (Besitznahme) oder durch Arbeit (vgl. dazu u. a.  Brocker 1992: Arbeit und Eigentum). Der Erklärungsanspruch beider Theorien fokussiert auf die Konstituierung privaten Sacheigentums. Wir hingegen suchen nach einer Antwort, die für alle Arten des Eigentums gültig ist – für Privateigentum und Gemeineigentum, für stoffliches und geistiges Eigentum, für Eigentum an Produktionsmitteln und für Eigentum an privaten Konsumtionsmitteln.
Brocker 1992: Arbeit und Eigentum). Der Erklärungsanspruch beider Theorien fokussiert auf die Konstituierung privaten Sacheigentums. Wir hingegen suchen nach einer Antwort, die für alle Arten des Eigentums gültig ist – für Privateigentum und Gemeineigentum, für stoffliches und geistiges Eigentum, für Eigentum an Produktionsmitteln und für Eigentum an privaten Konsumtionsmitteln.
Antwort 1: Okkupation konstituiert qua Konvention Eigentumsrecht. Eigentümer eines in der Natur vorhandenen Guts, das noch keinen Eigentümer hat, ist der Mensch, der als erster Anspruch auf das betreffende Gut erhebt. Diese von der Antike bis ins 17. Jahrhundert in verschiedenen Varianten vertretene „Okkupationstheorie“ gilt seit Langem als vollständig widerlegt. Prominentester Verfechter dieser Theorie war der englische Universalgelehrte Thomas Hobbes (1588–1679).
Antwort 2: Arbeit konstituiert von Natur aus Eigentumsrecht. Das Individuum, das mit seiner Arbeitsleistung ein neues Gut produziert hat, ist qua Naturrecht dessen Erst-Eigentümer. Dieser Eigentumsanspruch auf das Ergebnis eigener Arbeit wurde in der Geschichte der Eigentumstheorien erstmalig vom englischen Philosophen John Locke (1632–1704) behauptet und firmiert seither unter dem Label „Arbeitstheorie“. Obwohl auch dieser Ansatz klare Schwachpunkte hat, auf die in der wissenschaftlichen Literatur nachdrücklich aufmerksam gemacht wurde (vgl. dazu  Brocker 1992: Arbeit und Eigentum), ist die Arbeitstheorie noch immer der Eckpfeiler der rechtsphilosophischen Legitimation des Eigentumsverständnisses unseres heutigen Rechtssystems.
Brocker 1992: Arbeit und Eigentum), ist die Arbeitstheorie noch immer der Eckpfeiler der rechtsphilosophischen Legitimation des Eigentumsverständnisses unseres heutigen Rechtssystems.
„Die Übernahme seiner Begründung für den legitimen Erwerb und Besitz von Sachgütern durch das bundesdeutsche Verfassungsgericht zeigt, daß die Arbeitstheorie trotz ihrer Verwendung bei Sozialisten und Kommunisten bis heute auch für bürgerliche Denker und Juristen nichts von ihrer Plausibilität eingebüßt hat und noch immer aufgegriffen und in eigentumstheoretischen Diskussionen verwendet wird. Ein grundsätzlich neues Paradigma wurde auch von bürgerlichen Theoretikern bis heute nicht entwickelt.“ (  Brocker 1992: Arbeit und Eigentum, S. 341 f.)
Brocker 1992: Arbeit und Eigentum, S. 341 f.)
Auch in den USA ist die Locke’sche Arbeitstheorie noch immer ein sehr einflussreiches Konzept, namentlich für die Begründung von geistigem Eigentum (Intellectual Property) (vgl.  Goldhammer 2012: Geistiges Eigentum und Eigentumstheorie,
Goldhammer 2012: Geistiges Eigentum und Eigentumstheorie,  Mossoff 2005: Is Copyright Property?, S. 40 f.,
Mossoff 2005: Is Copyright Property?, S. 40 f.,  Epstein 2004: Liberty versus Property?).
Epstein 2004: Liberty versus Property?).
Evidenz und Plausibilität der Arbeitstheorie erwachsen daraus, dass ihre Grundannahme einem im Alltagsbewusstsein weit verbreiteten Gerechtigkeitsempfinden entspricht: Derjenige, der etwas leistet, hat auch Anspruch auf die „Früchte seiner Arbeit“. Jemand, der ein neues Gut mit seiner körperlichen und/oder geistigen Arbeit geschaffen hat, gilt als dessen rechtmäßiger Eigentümer. Im Privat- und Freizeitbereich findet man allerorts Bestätigung dieser Maxime.
Auch der selbstständige Töpfer und der selbstständige Schneider sind Eigentümer der Güter, die sie mit ihrer Hände Arbeit geschaffen haben. Doch schon für ihre Gesellen gilt das nicht mehr. Schon gar nicht für Arbeiter und Angestellte, deren Arbeitsleistungen Beiträge in komplexen Produktionsprozessen sind. Eigentümer der Güter, die in solchen arbeitsteiligen Produktionsprozessen geschaffen werden, sind nicht die Menschen, die die Arbeit als „Arbeitnehmer“ leisten, sondern deren Arbeitgeber. Der Arbeitgeber ist „automatisch“ für alle Beteiligten ganz selbstverständlich Eigentümer der neu geschaffenen Güter, weil er Eigentümer der Ressourcen ist, mittels derer sie produziert wurden. Das sind sowohl die Produktionsmittel als auch die Arbeitsleistungen, die der Arbeitgeber den Arbeitnehmern durch Zahlungen von Löhnen, Gehältern oder Honoraren abgekauft hat.
Diese Rechtslage wurde schon von den Nationalökonomen des 19. Jahrhunderts (Cherbliez, Mill) und dann ausführlich von Marx im „Kapital“ beschrieben.
„Das Produkt ist Eigentum des Kapitalisten, nicht des unmittelbaren Produzenten, des Arbeiters. Der Kapitalist zahlt z. B. den Tageswert der Arbeitskraft. Ihr Gebrauch, wie der jeder anderen Ware, z. B. eines Pferdes, das er für einen Tag mietet, gehört ihm also für den Tag. Dem Käufer der Ware gehört der Gebrauch der Ware, und der Besitzer der Arbeitskraft gibt in der Tat nur den von ihm verkauften Gebrauchswert, indem er seine Arbeit gibt. Von dem Augenblicke, wo er in die Werkstätte des Kapitalisten trat, gehörte der Gebrauchswert seiner Arbeitskraft, also ihr Gebrauch, dem Kapitalisten. Der Kapitalist hat durch den Kauf der Arbeitskraft die Arbeit selbst als lebendigen Gärungsstoff den toten ihm gleichfalls gehörigen Bildungselementen des Produkts einverleibt […]. Der Arbeitsprozeß ist ein Prozeß zwischen Dingen, die der Kapitalist gekauft hat, zwischen ihm gehörigen Dingen. Das Produkt dieses Prozesses gehört ihm daher ganz ebenso sehr als das Produkt des Gärungsprozesses in seinem Weinkeller.“ (

MEW 23, S. 200)
Marx gebührt das Verdienst der Erkenntnis, dass das Eigentum an Produktionsmitteln in allen historischen Produktionsweisen der Anker für die Eigentümerschaft des gesamten Produktionsprozesses und damit auch der Eigentumsrechte an den produzierten Gütern ist.
Eine allgemeingültige Antwort auf die Frage „Wer ist der (rechtmäßige) Eigentümer neu produzierter Güter?“ muss für alle historischen Entwicklungsstufen und alle strukturellen Varianten der Güterproduktion zutreffen, also gleichermaßen für alle Produktionsprozesse, in denen
– der Produzent das neue Gut allein mit seiner eigenen körperlichen und oder geistigen Arbeitskraft erschafft,
– die Akteure, die die Arbeit leisten, auch Eigentümer der Produktionsmittel sind,
– die Akteure, die die Arbeit leisten, nicht Eigentümer der Produktionsmittel sind,
– (fast) keine menschliche Arbeit beteiligt ist, wie bei Herstellungsprozessen in voll automatisierten Produktionsanlagen und bei Naturgütern, die Tiere und Pflanzen ohne Zutun des Menschen produzieren. Private Eigentümer von Tieren sind auch Eigentümer von deren Nachkommen. Private Eigentümer von Pflanzen sind auch Eigentümer der Früchte dieser Pflanzen.
Forschungsmethodisch handelt es sich hier um eine vergleichende Abstraktion. Um in den verschiedenen Entwicklungsstadien eines Gegenstands gemeinsame invariante Merkmale zu identifizieren, muss diese Abstraktion beim höchstentwickelten Stadium ansetzen. Erst im höchsten Entwicklungsstadium eines Gegenstands sind die Merkmale ausgeprägt, die allen Entwicklungsstufen gemeinsam sind. Aussagen, die für das komplexeste Entwicklungsstadium zutreffen, sind abwärtskompatibel auch für niedrigere Entwicklungsstufen gültig. Die richtige Antwort kann man deshalb nicht in dem von John Locke reflektierten einfachen Arbeitsprozess suchen und finden, sondern nur in dem von Marx analysierten komplexen kapitalistischen Produktionsprozess. Auf diese Weise gelangt man zu folgender Erkenntnis: Alle an der Produktion eines Guts beteiligten Ressourcen (Arbeitsleistungen, Arbeitsmaterialien, Werkzeuge, Hilfsmittel, Infrastruktur, Dienstleistungen u. a.) haben (1) einen bestimmten Gebrauchswert (Nutzen) in diesem Produktionsprozess, (2) einen in Geld messbaren ökonomischen Wert und (3) einen Eigentümer. Im Prozess (Vorbereitung und Durchführung) der Produktion werden diese drei Faktoren – der Nutzen, der ökonomische Wert und das Eigentumsrecht – von den einzelnen Ressourcen auf die nachfolgenden Produktionsressourcen und letztlich an das Endprodukt übertragen.
Читать дальше
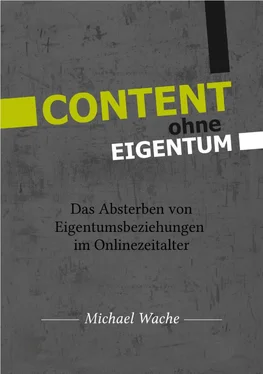
 Brocker 1992: Arbeit und Eigentum). Der Erklärungsanspruch beider Theorien fokussiert auf die Konstituierung privaten Sacheigentums. Wir hingegen suchen nach einer Antwort, die für alle Arten des Eigentums gültig ist – für Privateigentum und Gemeineigentum, für stoffliches und geistiges Eigentum, für Eigentum an Produktionsmitteln und für Eigentum an privaten Konsumtionsmitteln.
Brocker 1992: Arbeit und Eigentum). Der Erklärungsanspruch beider Theorien fokussiert auf die Konstituierung privaten Sacheigentums. Wir hingegen suchen nach einer Antwort, die für alle Arten des Eigentums gültig ist – für Privateigentum und Gemeineigentum, für stoffliches und geistiges Eigentum, für Eigentum an Produktionsmitteln und für Eigentum an privaten Konsumtionsmitteln. Goldhammer 2012: Geistiges Eigentum und Eigentumstheorie,
Goldhammer 2012: Geistiges Eigentum und Eigentumstheorie,  Mossoff 2005: Is Copyright Property?, S. 40 f.,
Mossoff 2005: Is Copyright Property?, S. 40 f.,