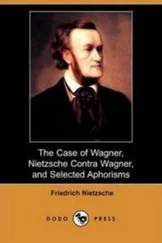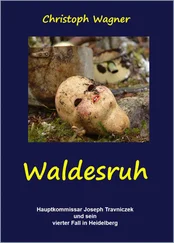„Stick to it” (1999)
Sobald irgendeiner den Mittelfinger übern Gitarrenhals rutschen lässt, schreit alles begeistert: „Ry Cooder!“. Bei Karl Ritter tut das sogar seine eigene Plattenfirma. Pech. Denn Ritter vermag zwar der Gitarre auch Stimmungen zu entlocken, die wie in der Sonne flirrende Riesenkakteen im Raum stehen, doch wurzelt sein Verständnis der Gitarre durchaus nicht komplett in US-amerikanischen Traditionen. Auch die europäische Avantgarde redet ein, zwei Wörtchen mit. Ritter schickt die Klänge Ton für Ton auf Reisen, und er sinniert ihnen oft lange hinterher. Auch uns gibt das Zeit, über musikalische Strukturen nachzudenken. Sofern wir uns dem Pawlow’schen inneren Schrei „Ry Cooder“ verkneifen können.
Kim Salmon & The Surrealists
„Ya gotta let me do my Thing” (1999)
Holpernd schleicht sich dieses Album in die Welt, ein grober Bass rollt an, verschmierte Bläser quietschen, und zu rußigen Kohlenkellerdrums kreischt der Urgrunger und Ex-Beast-Of-Bourbon Kim Salmon: „I won’t tell!“, und zwar etwa so, wie es David Byrne damals gemacht hätte, als er noch der Psychokiller war. Eine Mischung aus Neowave und Garage, aus Talking Heads und Who bietet Salmon auf, um neumodischer Gelecktheit die gute alte Schule des 80er-Jahre-Undergrounds entgegenzuhalten. Das ist nicht schön, aber heftig; das ist nicht eingängig, aber wirksam – wie ein Schlammbad im Abendkleid. Es geht also noch, roh zu sein und herumzustolpern vor lauter Ungestüm und sich einen Teufel zu scheren ums Feinsinnige. Gute, dreckige Musik, der es um Alkohol und Voyeurismus geht – und einmal auch darum, im Reißverschluss festzustecken.
King Crimson
„The ProjeKcts” (1999)
Zuletzt bekam Robert Fripp die legendäre Artrockcombo nur noch selten zusammen. Kurzerhand rief er daher die „Fraktalisierung“ aus: Wer immer aus der Band mit einem anderen Mitglied musiziert, tut das seither als King-Crimson-„ProjeKct“. Eine Viererbox fasst nun die Konzerte aller „ProjeKcts“ seit 1997 zusammen – zur erregenden, aber auch strapaziösen Reise an die Ränder der Populärmusik, wo Rock, Jazz, Noise und Avantgarde miteinander tanzen. Beim „ProjeKct One – Live at the Jazz Café“ (mit Levin, Gunn, Bruford, Fripp) etwa packt uns ein dichter, hektischer, oft majestätischer Strom aus Grooves und Gitarrenlärm, reißt uns hinab in dunkle Höhlen mit seltsamen Seitengängen. Erstaunlich, wie vital und innovativ die Experimente der Artrockhaudegen noch immer klingen. Seit 30 Jahren kreativ – keine andere Band der Welt hat das je geschafft.
Labradford
„E luxo so” (1999)
„Ich war eins jener Kids, die daran glaubten, dass wir alle bald zum Mond fliegen würden“, erinnert sich Mark Nelson. Dazu kam es nicht, doch die Musik, die er (g, voc, tapes) mit Carter Brown (synth) unterm Namen Labradford komponiert, eignete sich prächtig als Soundtrack zu einer solchen Reise. Ihre majestätische Ruhe erinnert an die (scheinbare) Statik von Raumschiffen in der Umlaufbahn, während unten die Erde still durchs All rollt. Es scheint, als sei Harold Budd, der Ambientelegiker des Pianos, in Amerika angekommen. Wenn man einschläft bei dieser Musik – was vorkommen kann, aber kein Nachteil ist –, dann sind wehmütige, schwerelose Träume garantiert.
Uups: Ausgerechnet aus Heidelberg kommt die erfrischendste Verquickung eingängiger 80er-Elektronik mit 90er-Rock. Liquido führten sie im Sommer mit ihrem naiv elektronifizierten „Narcotic“ sogar bis hoch in die Charts. Auf ihrem Debütalbum ist der Synthieanteil geringer, doch das Ohrwurmquantum halten sie lässig. Die Fülle heimlicher Singles wie „Wake me up“ oder „What you keep inside“ widerlegen die vorauseilende Vermutung, wir könnten hier einem One-Hit-Wonder live beim Werden und Vergehen zuschauen. Liquido wollen oben bleiben, und so, wie sie Monsterriffs abschießen, wie sie nach Herzenslust mit der Dynamik spielen und uns verschwenderisch mit Melodien beschenken, haben sie das Zeug dazu. Breitwandrock mit Stil. Nach 42 Minuten ist das Album aus; mehr kann man nicht verlangen von ein paar Jungs aus Heidelberg, die Tim Eiermann oder Wolle Maier heißen und trotzdem ausziehen, die Welt zu erobern.
Lyle Lovett
„Step inside this House” (1999)
Manko: Mit gerade mal gut 80 Minuten Musik hätte man nicht unbedingt ein Doppelalbum produzieren müssen. Lyle, reumütig aus Julia Roberts’ Glamourwelt zurückgekehrt zu seinen texanischen Buddys, erweist ihnen die gebührende Ehre. Obgleich selbst ein passabler Songwriter, ehrt er diesmal die Songs größerer Kollegen: Steven Fromholz, Guy Clark, Townes Van Zandt, Eric Taylor, Vince Bell und viele andere. Doch gerade die durchweg traditionellen, halbelektrischen Arrangements verwischen leider alle Unterschiede. Am Ende ist alles, was wie Hyatt oder Keen anfing, zu Lovett geworden. Also zu geleckt schimmerndem Mittelmaß. Aber Hauptsache, er ist wieder zurück aus Julia Roberts’ Glamourwelt.
Lynden David Hall
„Medicine 4 my Pain” (1999)
LDH scheint angeödet zu sein vom meterdicken Arrangementkleister, der den Mainstreamsoul gemeinhin zupampt. In seinen Sound aus Orgel, Beats und Bass sieht man darum hinein wie in einen Birkenwald im Spätherbst: Überall ist Raum zwischen den Stämmen. Dennoch ist dieser Ort ein heimeliger, einer, wo die Zeit langsam vergeht, und da die Soulzeit in Beats abläuft, lässt er diese klatschen und patschen wie einen halbaufgepumpten Fußball auf nassem Asphalt. Lynden, der alle Songs geschrieben und teils produziert hat, die meisten Instrumente spielt und sanft singt und aussieht wie ein junger Gott, müsste weltberühmt werden, ginge es gerecht zu. Mal sehen.
Mariah Carey
„Rainbow” (1999)
Mariah Careys Pop ist auf eine erstaunlich unbekümmerte Art eklig. Jedes Detail, jeder Backingchor, jedes pseudopassionierte Jubilieren im Refrain, jeder Synthiekleister, jeder geradezu Streisand’sche Pianoschwulst kommt exakt so, wie man es befürchtet hat. Warum schämt sie sich nicht dafür? Und warum schämen sich nicht Jay-Z, Missy Elliott oder Snoop Dogg (ja, genau: einst der böseste aller Nachwuchsgangsta!) dafür, der Carey street credibility zu verschaffen, von der sie allerdings selbst längst nur noch ein Fitzelchen haben – und spätestens hier einbüßen? Fragen über Fragen. Alle Antworten geben die Charts. Das Leben ist scheiße.
Marianne Faithfull
„Vagabond Ways” (1999)
Vor Eitelkeit sind anscheinend auch betagte Fregatten nicht geschützt – das Coverfoto macht die Faithfull ungefähr zwei Dekaden jünger, als sie ist. Mit ihrer Stimme ist so was freilich nicht mehr zu machen. Und das wäre auch fatal: Diese Stimme ist es, die den zwischen Kammer- und Orchesterpop schwankenden Balladen die Aura gibt. Als Brecht-Interpretin reüssierte sie letztes Jahr, diesmal covert sie auch mal Leonhard Cohen („Tower of Song“). Und die Gemütslage des kanadischen Poeten scheint über ihrem ganzen Album zu liegen – sänge er, es ginge glatt durch als sein jüngstes Werk. Wie wär’s mit einem Duett? Einen Song, der ihren Namen trägt, hat Cohen ja schon seit Ewigkeiten im Repertoire: „So long, Marianne“.
Martin Böttcher
„Kriminalfilmmusik Vol. 2” (1999)
Kinski ist der Mörder, nicht? Und Blacky wird ihm auf die Schliche kommen, aber nicht, bevor die Flickenschildt den letzten spöttischen Seufzer seufzt … Ja, wenn der deutsche Film Edgar Wallace nicht gehabt hätte, es gäbe einen Kult weniger. Für die Atmosphäre aus Geisterschloss und 60er-Muff war indes nicht nur das stimmungsvolle Licht (Expressionismus!) verantwortlich, auch Martin Böttcher tat sein Bestes. Seine Big-Band-Filmmusiken für Wallace- und andere Krimis illustrieren Schocks mit schneidigen Bläsern, offene Fragen erfordern gestopfte Trompeten, Spannung verlangt es nach Trippelbass oder todvorsichtigem Vibrafon, und das konspirative Treffen im Gasthaus an der Themse will Barpiano und Gerauntes über die Nacht von der Flickenschildt. Wer diesen Soundtrack hat, braucht die Filme nicht mehr. Die gibt es gratis dazu, im Kopf – und dort ist Kinski immer der Mörder, auch wenn er’s in den Filmen niemals war.
Читать дальше