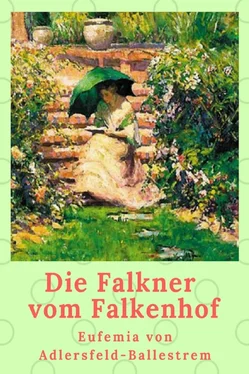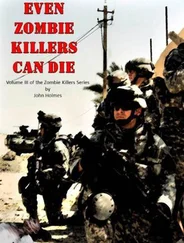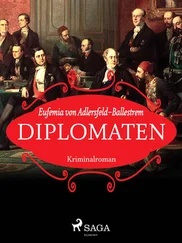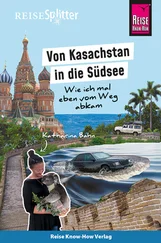1 ...6 7 8 10 11 12 ...25 „Echte Diamanten –“, sagte Falkner unwillkürlich, indem er den Reifen an die zerbrochene Zacke zu hängen suchte, „Diamanten von wunderbarem Feuer!“
„Glaubten Sie, dass ich unechte Steine trüge?“ Der Ton, in dem Donna Dolores es sagte, klang fast beleidigt.
„Sie sind wenigstens üblich für Theaterschmuck, Senora!“ erwiderte Falkner, „aber ich begreife Ihre Laune. Nur ist sie sehr kostspielig –“
„Oh, mein Vorrat reicht hin, um mich als ›Selica‹ in Feuergarben zu hüllen“, meinte sie mit natürlicher Freude, ohne eine Spur von Prahlerei.
„Dann erlauben Sie mir, Senora, Sie zu Ihrer ungewöhnlich guten Ernte zu beglückwünschen“, sagte der Freiherr mit verletzendem Spotte im Tonfall.
Dolores richtete sich hoch auf und sah ihm fest in die Augen. „Ich bedauere, Ihre Glückwünsche nicht annehmen zu können, denn ich singe weder um Geld noch um Diamanten.“
Falkner verbeugte sich leicht und reichte ihr den Diamantreifen. „Pardon, Senora! Mein Irrtum war wohl verzeihlich –“
„Sehr verzeihlich“, nickte sie, „denn Sie kennen mich ja nur im Nebelschleier Ihres Vorurteils.“
Noch ein leichtes Nicken, und Donna Dolores war verschwunden.
„Sesam, öffne dich“, rief Falkner, als der Wagen davonrollte und er selbst an der Schwelle des Ateliers zum Gehen bereitstand, „diese Theaterprinzessin gibt schwere Rätsel auf und verlangt starken Glauben. Klappern gehört zum Handwerk, Donna Rothaar, soviel wissen wir Laien auch.“
In seiner Wohnung fand Falkner ein Telegramm vor, in dem seine Mutter ihn unverzüglich wegen des nahe bevorstehenden Todes seines Oheims, des Lehnsherrn, nach dem Falkenhof berief.
Wo der rauschende Laubwald des deutschen Nordens kühlen, wonnigen Schatten gibt, wo noch keine Axt sich gerührt, um Eichen und Buchen zu fällen und an ihrer Stelle rasselnde, qualmende Fabriken zu errichten, wo weit und breit nichts zu sehen ist als Himmel, Wald und lauschige, glitzernde kleine Seen, da liegt der Falkenhof.
Der große vierflügelige graue Steinbau mit seinen vier runden, efeubewachsenen, hoch und steil bedachten Türmen lehnt sich dicht an den grünen Wald, der hier zum Park umgeschaffen ist, während vor seiner Front sich ein mächtiger Rasenplatz, von Monatsrosen umsäumt und mit Gruppen der edelsten Rosen bepflanzt, ausdehnt. Die Wirtschaftsgebäude verbergen sich hinter dichtem Strauchwerk und Baumgruppen, sodass der Falkenhof einsam im grünen Wald zu liegen scheint – ein grauer, Stein gewordener Traum aus längst vergangenen Tagen.
Der Bau selbst entstammte dem sechzehnten Jahrhundert und war ursprünglich für ein adeliges Damenstift bestimmt gewesen, das dort nur ein kurzes Dasein gefristet und sich dann aufgelöst hatte. Da die Stifterin und Erbauerin eine Falkner gewesen war, so fiel die Besitzung an die Falkners zurück als Lehen, und ein Zweig dieser Familie ließ sich dauernd darauf nieder. Im Laufe desselben Jahrhunderts starben die anderen Linien des alten Geschlechts aus und die des Falkenhofes führte den Namen weiter bis heute.
Es waren seitdem viele junge Falken flügge geworden. Viele hatten ein friedliches Nest gefunden, andere sich im Fluge zu hoch gewagt und ihr Leben mit versengten Schwingen und gebrochenem Sinn beschlossen. Wieder andere waren verschollen, verdorben und gestorben, während einzelne kühn emporflogen zu sonnigen Höhen – wie es das Leben in großen Familien so fügt im Laufe der Jahre, Jahrhunderte.
Jetzt war das stolze Falkennest nur schwach besetzt. Der alte Freiherr und sein Neffe, der Legationsrat, waren die letzten männlichen Glieder des alten Stamms, und da der Freiherr mit einem Fuße im Grabe stand und der Neffe noch unvermählt war, so stand die Fortexistenz der Falkner auf schwachen Füßen.
Daran dachte der Freiherr Alfred, als er der Heimat seiner Kindheit entgegenfuhr. Er hatte schon oft daran gedacht, sich aber nie zur Vermählung entschließen können, einfach aus dem Grunde, weil die ihm bekannten jungen Damen sein Herz noch nicht erweckt hatten. Wenigstens fesselte keine ihn so, dass er sie zur Gemahlin hätte wählen mögen. Nicht dass er blasiert gewesen wäre; vor dieser Krankheit des gepriesenen neunzehnten Jahrhunderts bewahrte ihn sein Verstand. Aber die Hohlheit des Kopfes und Herzens, die ihm aus all den hübschen und schönen Gesichtern entgegenlachte, hatte ihn immer wieder zurückgeschreckt. „Der Wahn ist kurz, die Reu' ist lang“, hatte ihm eine warnende Stimme oft zugeflüstert, wenn er das Rechte getroffen zu haben glaubte. Der furchtbare Gedanke, das ganze Leben neben einer unsympathischen Gefährtin dahinwandeln zu müssen, hatte ihn wieder befreit von der drohenden Fessel. Darüber war er achtunddreißig Jahre alt und obendrein Legationsrat geworden, denn dass nur sein Geist ihn so schnell befördert, das konnte niemand dem „schönen Falkner“ bestreiten, ihm, der die Wonne und Sehnsucht aller Mütter von reifen und überreifen Töchtern war.
Er hatte ernste, fast strenge Ansichten vom Leben und von seinen Pflichten. Die diplomatische Laufbahn, in die der Oheim, seine Mutter und sein Stiefvater ihn gedrängt hatten, war nicht nach seinem Geschmack. Ihn lockte mehr die Wissenschaft, und er war auch gewillt, sich ihr ganz zuzuwenden, sobald er frei war.
Jetzt fuhr er vielleicht dieser Freiheit entgegen, durch sonnige Felder, schattige Wälder und duftende Wiesen, aber er konnte die winkende Freiheit nicht froh begrüßen, denn erstens musste sie dem Oheim, der ihn an unzerreißbaren Fesseln hielt, den Tod bringen, und dann – – –
Den zweiten Gedanken dachte er nicht aus, vielleicht weil es nicht gut ist, jeden Gedanken auszudenken, vielleicht, weil der Wagen eben in den breiten Kiesweg einbog, der, von hohen Buchen beschattet, dem südlichen Seitenportal des Falkenhofes zuführte.
Als der Wagen unter der gedeckten Einfahrt hielt, trat Alfred Falkner dem Stiefvater entgegen, eine hochgewachsene Männergestalt mit klugen, ausdrucksvollen Zügen. Das schlichte, halb ergraute Haar war glatt nach rückwärts gekämmt, sodass die eigentümlich runde, katzenkopfartige Bildung des Hauptes hervortrat. Seine Augen bedeckte eine Brille, der starke Bart auf der Oberlippe war tief dunkel, wie die dichten Brauen, die die Augen beschatteten. Das war der Doktor Ruß, der „Magister“, wie die Leute vom Falkenhof ihn nannten, eine unleugbar bedeutende Erscheinung, deren peinlichste Ordnungsliebe auch in seiner Kleidung angenehm hervortrat. Er schien zu jeder Stunde bereit zu sein, das Parkett eines Fürstensaals zu betreten, so sorgfältig und tadellos war seine Toilette.
„Willkommen, geliebter Sohn“, rief er mit leiser, sympathischer Stimme und streckte dem Freiherrn die Hände entgegen, „wir haben deiner lieben Gegenwart mit Ungeduld entgegengeharrt!“
Falkner legte seine Rechte flüchtig in eine der sich ihm entgegenstreckenden Hände – er hatte den Mann nicht leiden können, als dieser noch sein Lehrer war. Und als sich Doktor Ruß mit seiner Mutter vermählte, wurde das Gefühl gegen ihn noch bitterer, denn halb erwachsene Söhne pflegen Stiefvätern Misstrauen entgegenzubringen, und weder er noch Doktor Ruß selbst schienen die leidenschaftlichen Ausbrüche vergessen zu haben, mit denen damals der Jüngling die Nachricht begrüßte, die Mutter habe seinen Lehrer, der obendrein jünger war als sie selbst, als Gatten erwählt. Das damals feindliche Verhältnis hatte im Laufe der Zeit einem ruhigen Begegnen Platz gemacht, das die Welt freundschaftlich nennt, aber Falkners Abneigung gegen den Mann seiner Mutter war nie ganz gewichen. In seinem Inneren bäumte sich immer wieder ein unbezähmbares Gefühl auf, wenn Doktor Ruß ihn Sohn nannte.
„Steht es schon so schlimm mit dem Oheim?“, fragte er als Antwort auf die Begrüßung des Stiefvaters.
Читать дальше