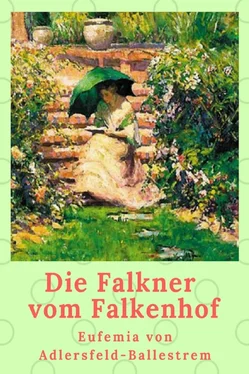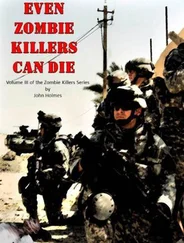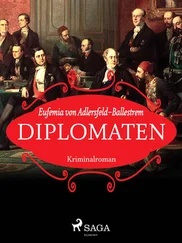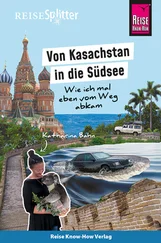Sie hob den Arm und warf den Kranz so sicher, dass er richtig über die Krone fiel und ihre sieben perlengezierten Zacken wie mit Purpur umsäumte.
„Wie schön“ – rief die Elfe triumphierend, aber im selben Moment glitt ihr Fuß auf dem schlüpfrigen Gestein aus – ein Schrei aus dem Dunkel des Hauses, und die weiße Gestalt verschwand in dem hoch aufspritzenden Wasser des Bassins.
Mit einem Sprunge war Alfred im Hof und am Brunnen – seine kräftigen Arme zogen die leichte Gestalt aus dem Wasser und setzten sie vorsichtig auf den trockenen Boden. Sie war nicht bewusstlos, kaum erschrocken, und ihre Augen, die ihm im Mondlicht seltsam dunkel erschienen, sahen ihn fragend an.
„Bist du – sind Sie verletzt?“, fragte er stockend.
Da lachte sie schon wieder.
„O nein“, sagte sie, „der Oheim drinnen hat mir's hundertmal gesagt, ich sei eine herzlose Person – und denen geschieht nichts, wenn sie ins Wasser fallen, sie können nicht untergehen. Nur Menschen, die ein Herz haben, zieht's auf den Grund.“
„So? Und was klopft denn da bei dir an der Stelle, wo bei anderen Menschen das Herz sitzt?“ fragte Alfred belustigt.
„Da?“ Sie legte die Hand auf die Stelle. „Oh, da liegt bei mir ein hohler Muskel.“
„Wirklich? Und fühlt der Muskel nichts?“
Sie sah ihn groß an.
„Nein –“, sagte sie langsam, „es muss wohl nicht sein, denn der Oheim sagt, ich sei herz- und gefühllos – ein Satanskind.“
Und nun lachte sie wieder auf, dass es wie der Ruf der Spottdrossel durch den Garten und die Kreuzgänge klang, raffte ihr triefend nasses Kleid zusammen und floh ins Haus.
Am nächsten Morgen, als er ins Freie hinaustrat, waren die Wagen verschwunden. Die „Fremden“ waren abgereist, und „es krähte kein Hahn nach ihnen“, wie Mamsell Köhler, die Beschließerin, sagte, als sie an das Inordnungbringen des verlassenen Flügels ging.
Nein, es krähte kein Hahn nach ihnen, denn nicht mit einer Silbe wurden sie erwähnt von dem Oheim, der Mutter und deren Gatten.
Nur einer vermisste das Satanskind – das war der Verwalter des Gutes, ein mittelalterlicher Hagestolz, dem es tausend und aber tausend lustige kleine Streiche gespielt hatte, wie allen im Hause, nur dass es drinnen Empörung und sittliche Entrüstung über den „schlechten Charakter“ gab, während er lachte. Dafür sang sie ihm abends, auf dem Fensterbrett seines Häuschens hockend, Lieder zur Mandoline vor.
Alfred von Falkner seufzte tief auf – er war mit seinen Erinnerungen zu Ende. Es war nicht viel und nur sehr Unklares, da man ja auf dem Falkenhofe das niederdrückende System des „Totschweigens“ übte und unliebsamen Personen keine Silbe gönnte. Aber er war dennoch zufrieden, nun wusste er doch, wo er das Lied gehört hatte, das die „Komödiantin“ gesungen.
Bei dieser Erkenntnis fuhr ihm ein jäher Schreck wie ein glühender Strom durch das Herz – ihm war, als gliche die Satanella des heutigen Abends der kleinen zarten Elfe von damals, als sie im Mondlicht am Brunnen ganz ernsthaft ihre Herzlosigkeit behauptete.
Im nächsten Augenblick aber musste er sein Erschrecken belächeln.
„Unsinn“, sagte er vor sich hin, „meine Nerven sind erregt von der Satansmusik der im Grunde geschmacklosen Oper. Es war das Lied, das mir den hirnverbrannten Gedanken eingab – denn das kleine Mädchen, das es vor vierzehn Jahren sang, war am Ende doch eine Freiin von Falkner.“
Mit diesem beruhigenden Gedanken suchte er sein Lager auf, aber die schlichte Weise tönte noch in seinen Träumen fort:
Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit
Tönt ein Lied mir immerdar.
Die Zeit verging. Abend für Abend wurde die „Satanella“ aufgeführt, und Abend für Abend zog die Oper eine Menge von Schaulustigen und Musikfreunden in die strahlenden Räume des Opernhauses.
Natürlich wurde das Geheimnis der Autorschaft bald gelüftet, und so geschah es, dass diejenigen, die sich eigentlich nur für die Sängerin begeistert hatten, diese Teilnahme nun auch der Oper zuwandten und umgekehrt.
Donna Dolores konnte natürlich nicht Abend für Abend die anstrengende Partie der Satanella singen und wechselte deshalb in dieser Rolle mit der Primadonna der Oper ab. Sie war eine geheimnisvolle Persönlichkeit, über die viel gesprochen wurde, man befragte den Intendanten, in dessen Hause sie wie eine Tochter verkehrte, aber er verriet ihre Herkunft nicht. Niemand hatte gehört, dass sie schon anderswo aufgetreten war, sie war gekommen und hatte gesiegt – ein Mädchen aus der Fremde im Reiche der Kunst. Man brannte förmlich darauf, mehr von ihr zu wissen, zu erfahren – vergebens. Denn die schwarze Tereza, ihre Kammerfrau, war unbestechlich, und Senor Ramo Granza, ihr Kammerdiener und Sekretär in einer Person, ein kleiner, nussbrauner, geschmeidiger Brasilianer, war noch unzugänglicher, sowohl Geld als guten Worten. Er war zugeknöpft von der weißen Krawatte bis zu den Lackstiefeln.
An den Abenden, an welchen Donna Dolores die Satanella sang, saß regelmäßig auch Alfred von Falkner in seiner Loge. Er wollte die Musik studieren, hatte aber keinen Blick für die Bühne, solange Donna Dolores auf ihr stand.
„Man sollte meinen, Sie fürchteten sich vor den faszinierenden Augen der Satanella“, sagte Richard Keppler eines Abends zu ihm. Denn auch der Maler fand sich regelmäßig ein und war immer wieder aufs Neue entzückt von der plastischen Darstellungsweise der Fremden.
Alfred zuckte die Achseln.
„Sie hat eine wunderbar schöne Stimme, und ich komme, sie zu hören“, erwiderte er kühl, „aber das verpflichtet mich nicht, die Sängerin anzusehen. Ihre Erscheinung ist mir unsympathisch.“
Dagegen ließ sich natürlich nichts einwenden.
Es war etwa einen Monat nach jenem Abend beim Professor Balthasar, als Donna Dolores bei dem Atelier Richard Kupplers vorfuhr.
Senor Ramo sprang vom Bock und öffnete seiner Dame die Wagentür. Die Sängerin, wie gewöhnlich in Schwarz gekleidet, verließ den Wagen und betrat das Vorzimmer des Ateliers, das sich Keppler hier, mitten im grünen Stadtpark, selbst erbaut hatte und zu dem die reisende Welt von überall herbeiströmte. Man bewunderte sogar die Frühstücksreste des Meisters und brach vor dem halb vollendeten Bilde eines Schülers in Entzücken aus, in der Meinung, vor einer Schöpfung des Genies zu stehen.
Donna Dolores durchschritt die wohldurchwärmte, komfortabel und künstlerisch ausgestattete Vorhalle und öffnete die Tür, ohne anzuklopfen. In dem mit Oberlicht versehenen Raume stand Keppler, Pinsel und Palette in der Hand. Aber das gewaltige Historienbild, an dem er sonst arbeitete, hatte er zurückschieben lassen – eine andere Staffelei war herbeigerollt, und darauf stand im prächtigen goldenen Renaissancerahmen das halbvollendete lebensgroße Porträt der Satanella.
Der Meister war so versunken in den Anblick des Bildes, dass er nicht einmal hörte, wie das Original hinter ihm erschien, und so bot Dolores ihm auch keinen guten Tag, sondern huschte lautlos durch den purpursamtnen Vorhang ins Nebenzimmer, dem Buen Retiro des Meisters, wo in einem Korbe verpackt das Satanellakostüm lag.
Lautlos und schnell warf sie ihr schwarzes Kleid von sich und das andere über, dann löste sie das Haar und trat mit einem Mal neben das Bild. Keppler erschrak beinahe, dann glitt sein Auge von der Leinwand auf die Sängerin, er verglich die Wirklichkeit mit der Kunst. Fast ängstlich prüfte er die Wirkung des farbensatten Bildes – dieses feuerfarbenen Kleides von starrer Seide im Schnitt der Renaissance, über einem Rock von Goldbrokat gerafft. Und über die rauschenden roten Falten wogte das üppige goldrote Haar in jenen wunderbaren Reflexen, wie sie eben nur dieses Haar hatte. Das zweizackige Brillantdiadem raffte die schweren Wellen zurück in den Nacken und funkelte über der weißen Stirn mit teuflischem Leuchten, denn die beiden rückwärts gebogenen Zacken flammten wie kleine Hörner, das Wahrzeichen Satanellas.
Читать дальше