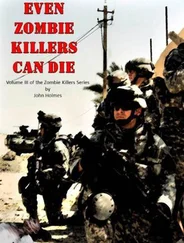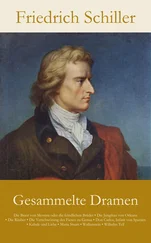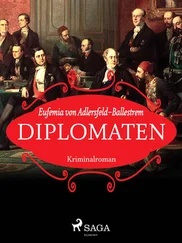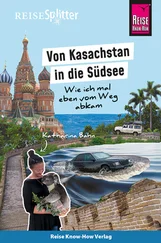„Halt, rechnen Sie diese kleine Teufelei der Senora nicht zu hoch an“, sagte Keppler lachend, „Sie haben sie gereizt.“
„Wie konnte ich ahnen, dass sie lauschte? Überdies – es konnte ihr nicht schaden, die Wahrheit zu hören.“
„Das heißt: ihre Ansicht, Baron“, erwiderte Keppler mit Betonung. „Oder wollen Sie an Ihrer Behauptung, Donna Dolores habe kein Herz, auch jetzt noch festhalten, nachdem wir sie so ergreifend singen hörten?“
Ein beinahe feindseliger Blick aus Falkners Augen streifte den Maler.
„Sie sind selbst Künstler, Herr Keppler“, sagte er kalt, „Sie sollten doch am Ende wissen, wie man Effekt macht. Ich bedauere, wenn meine Zweifel nicht zu Ihren Ansichten stimmen, aber es ist mir unmöglich, an die Wahrheit der so schön vorgetragenen Gefühle einer Berufssängerin zu glauben.“
„Das also ist Ihr Schlagwort?“ Eine feine Röte flog über das geistreiche Gesicht des Malers. „Eine Berufssängerin. Sie denken sich darunter natürlich ein Wesen, das möglichst viel Kapital aus ihrer Stimme schlägt und, wie der Schuster seinen Pechdraht, allabendlich ihre Gesangspartie abarbeitet? Ich beneide Sie nicht um diese gewonnene Erkenntnis, Baron Falkner; ich freue mich, dass ich naiv genug geblieben bin, um an die Heiligkeit eines wahren Künstlertums zu glauben.“
„Chacun á son goût“, erwiderte Falkner leichthin, „ich bekenne, dass mir ein so starker Glaube fehlt, wenn ich auch zugestehen will, dass es in früheren Zeiten solche nur um der Kunst willen wirkende Künstler gegeben hat.“
„In jedem Fall ist die Grundidee der ›Satanella‹ tief durchdacht“, mischte sich der Professor ins Gespräch.
„Meinem Geschmack nach zu tief durchdacht für eine so junge Dame wie diese deutsche Brasilianerin“, unterbrach ihn Falkner nicht ohne Hohn.
„Nun, nun – einmal hat sie nur die Musik gemacht und nicht die Worte, und dann sehe ich von der Person völlig ab und zolle gern dem Werk die gebührende Anerkennung“, rief Balthasar, lebhafter werdend.
„Und ich vermag die Person von dem Werk nicht zu trennen, da sie mit diesem durch ihren Individualismus verbunden ist.“
„O Sie Barbar!“, rief Frau Balthasar, lachend zwischen die Herren tretend, deren Gespräch sie allzu scharf zugespitzt fand, „wie können Sie so hart sein? Aber wir wollen Ihnen verzeihen, wenn Sie das Zugeständnis machen, dass Senora Falconieros eine ungewöhnlich begabte, hervorragende Frau ist.“
Falkner verbeugte sich.
„Ich gebe das zu“, sagte er, „aber mir fehlen Verständnis und Geschmack für dergleichen ›ungewöhnliche und hervorragende Frauen‹, die in unseren Kreisen gottlob nicht üblich sind.“
Abermals eine Verbeugung, und Falkner verließ den kleinen Kreis.
„Das sind empörende Ansichten“, brach nun Frau Balthasar los. „Ich begreife nicht, wie ein Mann von der geistigen Bedeutung des Barons so engherzig sein kann.“
„Liebe Marianne, es mag sehr schwer sein, sich aus den fest geschnürten Wickelkissen gewisser Vorurteile herauszuarbeiten“, entgegnete der Professor kaltblütig. „Auch wir haben unsere Vorurteile, ohne dass wir es wissen, und auch wir gehen bei der Verteidigung unserer Ansichten aus Eigensinn und angeborener Rechthaberei weiter, als wir zunächst beabsichtigten. Überdies kann kein Mensch gegen seine Antipathien.“
„Falkners Äußerungen gegen Dolores deuten auf mehr als bloße Antipathie.“
„Das ist noch kein Grund, weshalb die beiden sich nicht noch einmal fabelhaft lieben sollten“, sagte Balthasar humoristisch.
„Unsinn.“
„Was willst du? Wie sagte Julia, als sie sehr rasch die Bekanntschaft ihres Romeo gemacht hatte?
So große Lieb' aus großem Hass entbrannt!
Ich sah zu früh, den ich zu spät erkannt.
O Wunderwerk! ich fühle mich getrieben,
Den ärgsten Feind aufs Zärtlichste zu lieben.“
Frau Marianne lachte.
„Du vergisst, lieber Mann, dass weder Baron Falkner das Zeug zu einem Romeo hat, noch Donna Dolores, unsere Satanella, sich in eine schmachtende Julia verwandeln wird.“
„Weshalb nicht?“, meinte Keppler, indem er dem Paar gute Nacht bot, „die Natur spielt wunderbar, und am Ende hat jede Frau soviel von einer Julia in sich wie jeder Mann von einem Romeo.“
Inzwischen hatte Falkner seine Wohnung erreicht, aber er konnte noch keine Ruhe finden. Er trat ans Fenster, öffnete es und ließ die kalte Nachtluft ins Zimmer strömen. Obwohl der Winter sich dem Ende zuneigte und man auf den Straßen schon die ersten Frühlingsboten in Gestalt winziger Veilchen- und Schneeglöckchensträuße verkaufte, war seine Herrschaft noch nicht gebrochen, noch zeigte er manchmal empfindlich seine Macht.
Falkner war erregt, und dass er's war, ärgerte ihn um der Ursache willen.
„Um eine Sängerin“, murmelte er verächtlich, und doch konnte er das Bild dieser Sängerin nicht loswerden – es gaukelte ihm vor den Augen und blendete ihn.
„Ich hasse rote Haare“ – sagte er sich, indem seine Fantasie die goldenen Haarmassen der Satanella in jene fuchsige Farbe tauchte, die im Verein mit wässerigen Augen und fleckigem Teint so abstoßend wirkt.
„Sie werden bei Tageslicht so aussehen“, sagte er sich, „und die dunklen Brauen und Wimpern werden die Spuren der Farbe zeigen –“
Aber die Augen! Nein, die zu färben war ja ein Ding der Unmöglichkeit.
„Hüte dich vor allen, deren Haarfarbe von der der Augen absticht“, sagte er vor sich hin und musste gleichzeitig lächeln über die ausgekramte Kinderfrauenweisheit. Und am Ende, was ging ihn die „Brasilianerin“ an, die vielleicht in ihrem Privatleben den seltenen Namen Jette Müller oder Gustel Schulze führte. Der Gedanke daran zwang ihn zum Lachen.
„Donna Dolores Falconieros“, sagte er mit pathetischem Spott, „ich werde Ihnen aus dem Wege gehen. Zum Glück habe ich gar nichts mit Ihnen zu schaffen, voraussichtlich auch nicht in späterer Zeit. Unsere Wege führen sehr weit auseinander.“
Mit diesem Entschlusse glaubte Alfred von Falkner die Sache erledigt zu haben. Aber da fiel ihm das Lied ein:
Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit
Tönt ein Lied mir immerdar – –
Er kannte das Lied, aber wer hatte es gesungen, wann war es gesungen worden und von wem? Er sammelte seine Erinnerungen und dachte an die längstvergangenen Kinderjahre. Wen hatte damals der Falkenhof beherbergt? Er erinnerte sich nur eines prächtigen grünen Papageien, der ihm den Mittelfinger der rechten Hand durch und durch gebissen hatte, sodass man die Narbe heute noch sah. Damals hatte ihn jemand verlacht mit hellem, lustigem Lachen und ihm gesagt: „Es geschieht dir schon recht, denn wer hieß dich den armen Rio zu reizen!“
Er hörte plötzlich ganz deutlich die Worte wieder. Ganz richtig, Rio war der Name des klugen Vogels, der, wie er sich deutlich erinnerte, in drei verschiedenen Sprachen zu schimpfen verstand und dabei boshaft genug aussah. Nach jenem Biss und dem unbarmherzigen Lachen war er, Alfred Falkner, zum Oheim und Lehnsherrn gelaufen, um sich bitter zu beklagen, und seine Mutter, damals noch Witwe seines Vaters, hatte ihm tröstend den blutenden Finger verbunden und dazu finsteren Angesichts über das „herzlose fremde Ding“ gemurrt, das an den Schmerzen anderer seine Freude habe.
Aber wer war die Gescholtene?
Der Lehnsherr vom Falkenhof hatte zwei Brüder, eigenwillige, unbeugsame Naturen, wie sie das Falkengeschlecht nur jemals aufzuweisen hatte. Der jüngere der beiden, Alfreds Vater, hatte, während er des Königs Rock trug, sein und seiner Gattin Vermögen völlig vergeudet und starb kurz vor dem drohenden Ruin. Der Freiherr von Falkner nahm nun die Witwe mit dem Knaben zu sich und hielt diesem einen Erzieher, der seine Stellung so zu befestigen und sich so unentbehrlich zu machen verstand, dass ihm schließlich die immer noch stattliche Witwe die Hand reichte. Da sie nun auf dem Falkenhofe seit mehreren Jahren die Pflichten einer Hausfrau versah, weil der Lehnsherr unvermählt geblieben war, so wollte der Freiherr die Schwägerin, die seine Interessen vortrefflich zu wahren verstand, nicht mehr entbehren, und so geschah es, dass sie mit ihrem Gatten einen Flügel des Falkenhofes zu dauerndem Aufenthalt bezog.
Читать дальше