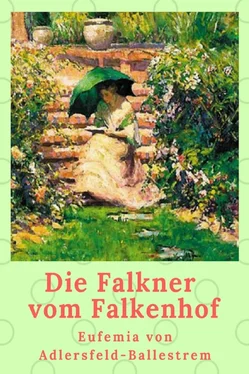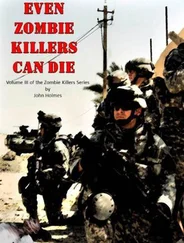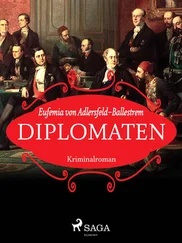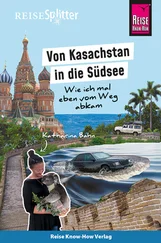Der ältere Bruder des Lehnsherrn war ein unruhiger Kopf gewesen, dessen erinnerte sich Alfred Falkner genau. Aber da er ihm im fünfzehnten Lebensjahre bereits aus den Augen entschwunden war und auch kein Mensch mehr seinen Namen genannt hatte, so wusste er nichts mehr von ihm. Zwanzig Jahre sind eine Zeit, in der man vergessen kann, besonders wenn der Gegenstand des Vergessens totgeschwiegen wird. Je mehr indessen Alfred Falkner der entschwundenen Erinnerung nachsann, desto mehr gewann er davon zurück, und nun trat auch die hohe, blonde Erscheinung des Oheims wieder vor sein geistiges Auge. Er erinnerte sich dunkel, dass der seltsamerweise nie mehr Erwähnte gleich ihm Diplomat war und jahrelang einer Gesandtschaft angehörte, die jedenfalls im Süden zu suchen war. Undeutlich zwar, aber doch mit Bestimmtheit entsann er sich, ein Gespräch zwischen seiner Mutter und dem Lehnsherrn belauscht zu haben, in dem sich dieser bitter darüber beklagte, dass der Bruder in einer zornigen Aufwallung den Dienst quittiert und obendrein sein Vermögen beim Zusammenbruch eines Bankhauses verloren hat.
Der Zusammenbruch eines Bankhauses! Diese Redefigur hatte damals auf Alfred tiefen Eindruck gemacht, denn er konnte sich gar nicht vorstellen, wie ein Bankhaus zusammenbrechen konnte.
Nun erinnerte er sich ganz deutlich, wie der Oheim mit Kind und Kegel, mit Sack und Pack auf dem Falkenhof seinen Einzug hielt; er hatte von einem Mansardenfenster aus mit atemloser Neugier zugesehen, denn es war ihm zu Ohren gekommen, der Herr des Hauses habe von einer Mulatten- und Negerwirtschaft gesprochen, die nun die altdeutschen Räume des Falkenhofes entweihen werde.
Das hatte in seiner jungen, unternehmungslustigen Knabenseele gezündet, und glühend vor Erregung hatte er die Mutter gefragt, ob denn der Oheim ein Fürst aus dem Morgenlande sei, dass er mit Mulatten und Negern komme. Frau von Falkner hatte ihm lachend geantwortet, der Onkel sei höchstens ein Bettlerfürst, aber seine Frau, die Tante, wäre vielleicht eine Mulattin oder etwas Ähnliches, jedenfalls eine „Fremde“.
Und nun kam der Onkel Bettlerfürst an, aber nur eine einzige große Negerin mit ihm, vor der sich Alfred natürlich entsetzlich fürchtete, wie vor dem leibhaftigen Teufel. Die Tante war jedenfalls nicht schwarz von Angesicht, das war schon ein Trost. Sie brachten auch ein kleines Mädchen mit, hell und licht wie eine Elfe, mit einem prächtigen Papagei, namens Rio, auf der Schulter, der den Hausherrn sofort mit einem kräftig schnarrenden „Filou! Filou!“ begrüßte. Jedenfalls war das im Lande der Mulatten eine Höflichkeitsform, wie Alfred meinte; er wunderte sich aber sehr, dass der also Begrüßte vor Zorn blass wurde und gleich in der Stunde der Ankunft seine bissigsten Redensarten hervorkramte.
Damals hatte er zum ersten Mal jenes helle, seltsame Lachen gehört, dessen er sich so genau zu erinnern wusste; er hatte gesehen, wie das kleine Mädchen den vorlauten Vogel gestreichelt hatte, worauf er, ermuntert und angefeuert durch den gespendeten Beifall, seiner ersten Äußerung noch ein lebhaftes „Caracho“ folgen ließ.
Nach dieser wichtigen Begebenheit wurden seine Erinnerungen wieder dunkler. Er entsann sich nur, dass das kleine Mädchen, das damals halb so alt wie er selbst gewesen sein mochte, sein Spielkamerad wurde und unaufhörlich an seiner Seite blieb, bis jener Biss des Papageien einen unheilbaren Riss in seinen Mittelfinger und das Lachen seiner kleinen Cousine einen ebensolchen in die Freundschaft brachte. Er kümmerte sich nach Knabenart nicht mehr um sie und um die fremden Bewohner des Falkenhofes, von denen er sich nicht besinnen konnte, sie überhaupt oft gesehen zu haben. Nur zuweilen hörte er die helle Stimme der Kleinen durch die Kreuzgänge hallen.
Mit seinem fünfzehnten Jahre, als sein Erzieher seine Mutter heiratete, kam er auf ein Gymnasium, um dort sein Abitur zu machen. Zwei Jahre lang, während der er den Falkenhof nicht wiedersah, dauerte sein Studium, dann legte er eine Prüfung ab und trat sofort seine Reise nach der Universität an. Nach den ersten zwei Semestern seines Studentenlebens besuchte er zum ersten Mal wieder die Heimat. Dort fand er alles in hastender Tätigkeit – die „Fremden“ sollten den Falkenhof verlassen. Es war ein schrecklicher Streit unter den beiden Brüdern ausgebrochen, der sofort das Verhältnis trennte; was eigentlich vorgefallen war, darüber erfuhr er keine Silbe. Man war nicht sehr mitteilsam auf dem Falkenhof.
Der Oheim hatte schon einige Tage vorher das Haus seines Bruders verlassen, jetzt folgte ihm seine Familie nach, und Alfred entsann sich genau der hochgepackten Wagen, die bei seiner Ankunft vorläufig noch unbespannt vor dem großen Tor ihrer Insassen harrten.
Als Alfred am selben Abend allein durch die Kreuzgänge des inneren Hofes schritt, die Zigarre im Munde und das Mondlicht beobachtend, wie es durch die doppelten Säulenreihen der mit Efeu und Kletterrosen umsponnenen gotischen Bogen huschte und sich in breiten, fahlgrünlichen, glänzenden Streifen auf die Steinfliesen legte, da hörte er plötzlich eine wunderschöne, wenn auch noch kindlich klingende Stimme ein einfaches Volkslied singen:
„Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit
Tönt ein Lied mir immerdar – –“
Er hatte das Lied hundertmal gehört und wohl auch selbst gesummt, dennoch aber veranlasste es ihn diesmal stillzustehen und den süßen Tönen zu lauschen. Sein nächster Gedanke galt der Sängerin – wer und wo war sie? Er brauchte nicht lange zu suchen. Die Gebäude umschlossen ein viereckiges Stück Land, auf dem von jeher ein herrlicher Blumenflor grünte und blühte. Inmitten des Gartens befand sich das Bassin eines großen Brunnens, und vier kräftige kristallhelle Wasserstrahlen ergossen sich aus ebenso vielen dräuenden Delfinköpfen in das graue steinerne Becken, das außen üppig mit grünem Farnkraut und Huflattich umsäumt war. Die vier mächtigen Schweife der Delfine vereinigten sich in der Mitte des Brunnens zu einem säulenartigen Gewinde, das sich nach oben vasenförmig öffnete und eine ehemals vergoldet gewesene, mächtige siebenzackige Freiherrnkrone trug.
Auf dem Rande des Bassins saß oder schwebte die Sängerin des ergreifenden Liedes – eine weiß gekleidete Mädchengestalt, ein Kind, mit lang herabwallenden Haaren, die im Mondlicht glänzten wie flüssiges, mit Kupfer gemischtes Gold.
Alfred meinte an jenem Abend eine jener Lichtelfen zu sehen, wie das Märchen sie beschreibt, so duftig und zart wie aus Mondschein gewoben. Er wagte nicht, sich zu rühren, aus Furcht, die Elfengestalt am Brunnenrand könnte in Nebel zerfließen, wie es die Art dieser holden Geister ist.
„Und die Schwalbe singt, und die Schwalbe singt
Im Dorf wie einst – –“
verklang das Lied. Die Sängerin aber erhob sich und stand im nächsten Augenblick auf dem Rande des Bassins, einen Kranz von Rosen und dunklem Blattwerk in den Händen – sie hatte ihn während des Singens gewunden.
Mit sicheren schnellen Schritten ging sie rings auf dem schmalen Rand des Bassins herum, als sei sie an solche handbreiten Pfade gewöhnt.
Da tönte eine erschrockene Stimme aus dem im Schatten liegenden Flügel des Falkenhofes hervor: „Bei allen Heiligen, Kind, halt ein, du fällst!“
Und nun lacht die Elfe als Antwort. Ein lustiges, helles Lachen, das einen Anflug von Spott hatte.
„Lass mich nur machen“, rief sie zurück, „ich habe hier einen schönen Kranz gewunden, meinen Abschiedsgruß dem Falkenhof! Den will ich der Steinkrone da droben überwerfen, damit sie auch einmal etwas von Rosenduft spürt – –“
„Kindereien – komm ins Haus, es ist spät“, kam die strenge Stimme zurück.
„Ich komme schon – aber erst den Kranz“, antwortete die Elfe im Mondlicht, „er kann der alten verwitterten Krone nicht schaden, der frische Schmuck, wenn er auch morgen früh schon welk ist. Vielleicht blüht er noch einmal auf.“
Читать дальше