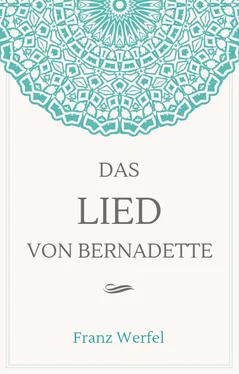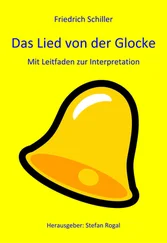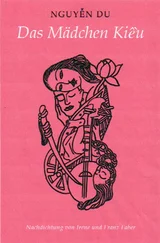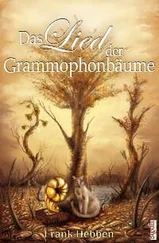Zur Stunde ist noch keiner dieser Herren erschienen. Am runden Tisch in der Ecke sitzt Monsieur Hyacinthe de Lafite allein. Monsieur de Lafite ist nicht Monsieur de Lafite in Person, sondern ein unbegüterter Vetter des reichen Mannes. Ihm ist ein Turmzimmer im Château eingeräumt, das zu beziehen ihm freisteht. Die Familie de Lafite ist sehr oft auf Reisen. Umso mehr macht in letzter Zeit Herr Hyacinthe von seiner Zuflucht Gebrauch. Dieses Lourdes ist für einen leeren Beutel die reinste Klinik, und Paris, das nicht unterscheiden kann zwischen echt und unecht, möge der Teufel holen! Wer kann in Paris arbeiten? Journalisten, Huren und Seelenverkäufer.
Man sieht Hyacinthe de Lafite auf den ersten Blick an, dass etwas Besonderes in ihm steckt. Er trägt sich mit einem Stich ins Altväterische. Die üppig geschlungene Plastronkrawatte zum Beispiel erinnert an Alfred de Musset. Das aus der abgeeckten Stirn zurückgestrichene Haar erinnert an Victor Hugo. Obwohl de Lafite das vierzigste Jahr noch lange nicht erreicht hat, ist dieses Haar schon grau meliert. Man war einmal fast befreundet mit Victor Hugo, das heißt, dieser Gigant hat sich vor langen Jahren einmal zu einer angenehmen Bemerkung über de Lafite herabgelassen. Man hat damals mitgewirkt in der Hernani-Schlacht der Comédie Française. Man hat zu jenen Auserwählten gehört, die rote Westen trugen. Man kennt übrigens außer Hugo, der längst im Exil ist, auch noch den alten Lamartine und den jungen Théophile Gautier und viele andere und will nichts mehr wissen von dieser ganzen überheblichen Gesellschaft.
Lourdes scheint der rechte Ort zu sein, um an den Busen einer etwas gewalttätigen Natur zu flüchten und, unbekümmert um die verletzenden Wertungen der Pariser Salons und Cafés, ein langatmiges Werk zu frönen. Hyacinthe de Lafite wälzt in seinem Haupte den tollkühnen Plan, die romantische Schule, der er sich selbst zugehörig fühlt, mit dem Klassizismus zu versöhnen. Unbegrenzte Phantasie in strenger Form, das ist seine Parole. Er arbeitet an einer Tragödie »Die Gründung von Tarbes«. Den Stoff verdankt er seinem Freunde, dem Schuldirektor Clarens, der ein emsiger Sagenforscher ist und im »Lavedan« die Rubrik »Loredanische Altertümer« redigiert. Es handelt sich in den genannten Werken um eine äthiopische Königin namens Tarbis, die zu einem biblischen Helden in Liebe erglüht, von diesem abgewiesen wird und nach Westen in die Länder der Pyrenäen flüchtet, um ihren Schmerz zu vergessen. Hier kommt sie, befreit von den düsteren Göttern des Orients, in Berührung mit den heiteren Gottheiten des Abendlands, die ihr die Qual vom Herzen zaubern. Als ihre Priesterin erbaut sie Tarbes.
Kein schlechter Stoff, wie man sieht, und voll von sinnbildlichen Anspielungen. Der Dichter schreibt ihn in puren Alexandrinern, eine verwegene Kampfansage gegen den Shakespearismus Victor Hugos. Auch ist er eisern entschlossen, als Nachfahre Racines, an der dramatischen Einheit von Ort und Zeit festzuhalten. Bedauernswert ist es nur, dass er nach mehr als zweijähriger Arbeit über das vierzigste Alexandrinerpaar noch nicht hinausgekommen ist. Hingegen bringt der heutige »Lavedan« einen Artikel von ihm, in dem er seine literarischen Stilprinzipien darlegt. Die Redaktion hatte sich lange gewehrt, diesen Artikel zu veröffentlichen, indem sie ins Treffen führte: »Das ist nichts für unsere Analphabeten.«
Der »Lavedan« liegt vor Lafite auf dem Tisch. Er ist heute Morgen pünktlich erschienen. Das geschieht nicht allzu häufig. Meist erscheint dieses fortschrittliche Wochenblatt zwei und drei Tage nach dem festgesetzten Termin. Abbé Pomian pflegt deshalb zu sagen: »Ein merkwürdiger Fortschritt das, der immer zu spät kommt.«
Der befreundete Gegner Victor Hugos brennt darauf, dass sein Artikel gelesen werde. Insbesondere ist ihm daran gelegen, dass der Philolog und Humanist Clarens sich ehemöglichst in ihn vertiefe. Es stehen drei Sätze über Racine darin, die man auf der Zunge zergehen lassen muss. Clarens aber, der soeben auftaucht, ist so tief in seine eigene fixe Idee verfangen, dass er dem neuen »Lavedan« und dem Autor Lafite keine Aufmerksamkeit zollt. Es ist die alte Tragik solcher schöngeistigen Beziehungen. Der Gelehrte hat einen tellergroßen, abgeplatteten Stein mitgeschleppt, den er jetzt vorsichtig aus einem Tuch knüpft. Eigensüchtig schiebt er ihn dem Schriftsteller unter die Augen und drängt ihm eine Lupe auf:
»Da sehen Sie nur, mein Freund, was ich für einen Fund gemacht habe. Raten Sie, wo? Ah, Sie werden es nicht erraten. Auf dem Spelunkenberg, in einer der Grotten, mitten unter dem Geröll lag dieser Stein und hat mich geradezu angerufen. Betrachten Sie ihn gut! Mit der Lupe! Sie erkennen das Stadtwappen von Lourdes, nicht wahr! Es unterscheidet sich im Stil wesentlich von der heutigen Form. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es auf das frühe sechzehnte Jahrhundert zurückgeht. Über den Türmen der Burg schwebt der Adler mit dem Fisch im Schnabel. Die Türme aber zeigen, anders wie im gegenwärtigen Wappen, die reinste maurische Architektur. Mirambelle – ich brauche Sie nicht zu belehren – war der mittelalterliche Name unsrer Stadt. Miriam-Bell. Miriam ist die maurische Form von Maria. Die Forelle, die der Adler im Schnabel trägt, ist nichts andres als Ichthys, das Christuszeichen, das über die frisch für Maria eroberte Burg abgeworfen wird. Sie sehen wie überall im Lande das marianische Prinzip ...«
Lafite unterbricht ihn, weil er sich ärgert, aus blankem Widerspruchsgeist:
»Ich bin durchaus nicht Ihrer Ansicht, mein Freund. Meines Dafürhaltens gehen alle diese heraldischen Tiersymbole auf vorchristliche Zeiten zurück.«
»Aber Sie werden doch nicht leugnen, mein Freund«, wendet der alte Clarens ein, »dass selbst der Gave in seinem Namen ein Ave umschließt.«
Der Dichter leugnet es rundweg. Wie alle Geister seiner Art lässt er sich von der Improvisation auf einen ihn selbst überraschenden Weg verlocken, nur um recht bald an das Ziel zu gelangen, das einzig ihn beschäftigt:
»Als Philologe wissen Sie besser als ich, mein Freund, dass der Buchstabe Gamma in manchen Sprachen zum Jota hinüber metastasiert und umgekehrt. Warum soll der Gave nicht nach dem biblischen Jahwe benannt sein, den meine Königin Tarbis nach ihrer unglücklichen Erfahrung mit dem Hebräer ins Land gebracht hat? Wenn Sie mein Werk lesen oder zumindest den heutigen Aufsatz ...«
Weiter kommt er nicht. Das feinsinnige Gespräch muss abgebrochen werden. Es hat elf geschlagen. Die Stunde des Apéritifs ist da. Nacheinander erscheinen sie alle, die zur Intelligenz und Notabilität von Lourdes gehören. Unterhaltungen freilich wie die soeben stattgehabte kann man mit all diesen Anwälten, Offizieren, Beamten, Ärzten nicht führen. Ihr Sinn ist dem nutzfreien Humanismus nicht gerade hold. Zuerst kommt Doktor Dozous, der Stadtarzt, eine vielbeschäftigte Seele. Immer auf dem Sprung, immer zwischen zwei ›Fällen‹, die seiner bedürfen, lässt er sich's zu dieser Stunde nicht nehmen, unter anderen angesehenen Männern ein Glas Portwein oder Malvasier zu leeren. Es gibt Ärzte genug in Lourdes. Da ist der Doktor Peyrus, der Doktor Vergez, der Doktor Lacrampe, der Doktor Balencie. Dennoch ist der Stadtarzt Dozous überzeugt davon, dass die ganze Last der hiesigen medizinischen Wissenschaft auf seinen etwas zu hohen Schultern liegt. Noch nicht ist erloschen in seiner Seele die leidenschaftliche Neugier des Naturforschers. Deshalb unterhält er neben seinem vollgemessenen Tagespensum eine rege ärztliche Korrespondenz, um in der Provinz nicht wissenschaftlich zu verbauern. Wie mag der große Charcot, wie der berühmte Voisin, Leiter der Salpêtrière in Paris, erschrecken, wenn er einen der langen Briefe des Stadtarztes von Lourdes unter seiner Post findet, diese wissbegierigen Fragebogen, die zu beantworten eine gute Stunde fordert.
Читать дальше