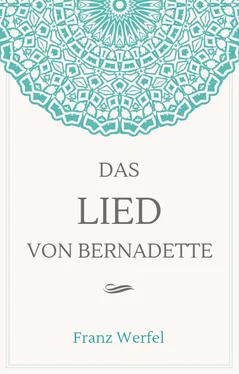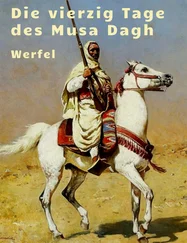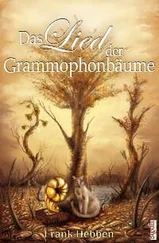Merkwürdig aber ist es, daß auch Antoinette Peyret ihrerseits im Laufe des Montags denselben Gedanken faßt. Um die Vesperzeit eilt sie fliegenden Fußes zu ihrer Gönnerin und Kundin. Die Peyret ist noch jung, aber ein häßliches und windschiefes Ding. Aus ihrem länglichen Gesicht kundschaften unermüdlich blinzelnde Augen hervor. Als Tochter eines Gerichtsvollziehers kennt sie die armseligen Blößen des Lebens und der Menschen. Ihrer flinken Art gemäß hat sie den Gedanken, der auch die Madame Millet überfiel, schärfer ausgedacht. Worauf weisen die nackten Füße der Erscheinung hin? Sonnenklar auf den Zustand der Buße, in dem sich auch die reine Seele des Marienkindes Elise befindet, wie alles Sterbliche, das gestorben ist. Büßer gehen bloßfüßig. Im Fegefeuer gibt's keine Schuhe und Pantinen vermutlich. Die Nichte der reichen Millet ist eine arme Seele, die besondrer Gebetsbemühungen ihrer Angehörigen und Freunde bedarf, um ihren trauervollen Aufenthalt abzukürzen. Das ist der Grund, warum sie der kleinen Soubirous erschienen ist, und zwar tatsächlich an einem Ort, der gut zum Eingang des Fegefeuers taugen könnte. Wer aber kann wissen, ob Elise Latapie ihrer gütigen Tante und in weitem Abstand auch ihrer bescheidenen Freundin nicht auch einige persönliche Wünsche oder Kundmachungen zu übermitteln habe. Madame Millet und Mademoiselle Peyret sperren sich ins Zimmer der Toten ein, um sowohl diese Theorie durchzuberaten als auch die Praxis, die zu ergreifen sei. Der Diener Philippe, der sich schon seit einem Jahrzehnt den majestätischen Plural angewöhnt hat, ist höchst erstaunt über diese Geheimkonferenz.
Mittwoch gegen vier Uhr – das Glück will es, daß nur die Soubirous und Bernadette zu Hause sind – betritt vornehmer Besuch den Cachot. Als erster erscheint Philippe, der einen Korb auf den Tisch stellt, in dem zwei gebratene Hühner und zwei Flaschen Dessertwein auf das appetitlichste verpackt sind. Er macht vor Louise, anders als sonst, eine Herrschaftsverbeugung und kündigt Madame an, die ihm auf dem Fuße folgt. Louise starrt recht erschrocken das Präsent an und den Diener. Zwei Minuten später rauscht die hochbusige Rentierswitwe in den Raum, der für sie ein allzu enges Gefängnis wäre, und hinter ihr die huschige Peyret mit der schiefen Schulter. Die Millet ist peinlich betroffen von dem finsteren Elend, das sie sieht.
»Meine liebe Frau«, beginnt sie, »ich wollte mich einmal umsehn nach Euch. Ihr müßt mir für diese Kleinigkeiten nicht danken ... Ich habe sogar die Absicht, Euch zu bitten, jeden Mittwoch und Samstag bei uns mitzuhelfen, ganz abgesehen von der Wäsche. Mein Haus ist so groß, leider ...«
Die Soubirous weiß durchaus nicht, was sie von dieser verschwenderischen Gunst zu halten hat. Madame Millet ist zwar sonst nicht engherzig, aber sehr genau, und was für Arbeit sollte es, du gütiger Himmel, in dem Haus geben, das durch Überzüge und Schutzdecken gegen jedes Stäubchen abgedichtet ist? Eine Tagesbedienung, zweimal in der Woche, das macht zusammen vielleicht vier Francs aus, sind sechzehn Francs im Monat, ein ganzes Vermögen. Und das wird einem gleich bei der Begrüßung hingestreut. Was mag dahinter stecken? Unterwürfig mißtrauisch wischt Louise zwei Holzstühle ab und schiebt sie stumm dem Besuch hin. Bernadette steht vor dem kleineren Fenster. Ihr Gesicht ist ganz im Schatten, aber ihr schwarzes Haar leuchtet rötlich golden, denn die Wintersonne ist vor dem Untergang aus den Wolken getreten und dringt jetzt sogar in den Hof des Cachots.
»Ihr habt ein sehr liebes Kind, meine Gute«, seufzt die Millet, »und ein ganz besondres Kind ... Ihr müßt glücklich sein ...«
»Begrüß doch die Herrschaften, Bernadette«, winkt die Soubirous. Bernadette reicht einer nach der andern wortlos die Hand und zieht sich sofort wieder auf ihren Beobachtungsplatz beim Fenster zurück. Madame Millet holt ein Spitzentuch hervor, mit dem sie ihre Augen abtupft:
»Auch ich hab ein Kind gehabt, kein eigenes, das heißt mehr als ein eigenes, Ihr wißt es ja ... Und Elise ist einen heiligmäßigen Tod gestorben, eine mutige Dulderin, und der Dechant Peyramale hat eigens einen Brief an Seine Gnaden den Herrn Bischof nach Tarbes geschrieben über diesen Tod, daß man sich an ihm ein Beispiel nehmen soll ...«
»Und gerade deshalb kommen wir hierher, Madame Soubirous«, unterbricht die sachliche Peyret die weinende Kundin.
»Ja, reden Sie, liebe Peyret«, nickt die Kurzatmige. »Reden Sie! Ich könnt's gar nicht ...«
Die Tochter des Gerichtsvollziehers entwickelt nun mit der ihr eigenen Geschäftsmäßigkeit ihre Theorie über Bernadettens Dame. Sie läßt keinen Zweifel zu. Die nackten Füße und die Identität des Kleides, das sie selbst geschneidert hat, beweisen, daß die Dame niemand anders sein kann als die jüngst abgeschiedene Elise Latapie im peinvollen Zustand einer Fegefeuerseele. Elise habe das Kind Bernadette Soubirous dazu ausersehen, gewissermaßen ihre Postbotin zu sein zwischen Diesseits und Jenseits, um der liebenden Tante und Ziehmutter wichtige Meldungen und Wünsche zukommen zu lassen. Das sei der offensichtliche Sinn der Erscheinungen, die Bernadette gehabt hat. Madame Soubirous möge daher gestatten, daß die Tochter ihre Sendung zu Ende führe und das Anliegen der Elise getreulich verdolmetsche, damit das arme Seelchen seine Ruhe finden kann.
Die Soubirous sitzt niedergedonnert da und wagt es nicht, den Kopf zu heben:
»Aber das ist doch alles ... beinah verrückt«, stammelt sie.
»Man könnt auch wirklich verrückt werden darüber«, schluchzt die Millet laut.
Zwischen Mutter und Tochter sind, ehe der Besuch kam, sonderbare Dinge vorgegangen, ohne daß ein Wort gewechselt wurde. Maman, der die schweigsame Depression Bernadettens die Kehle zuschnürte, war schon nahe daran, dem Kinde anzubieten, es möge am Sonntag heimlich zur Grotte gehn. Und Bernadette war nahe daran, sich vor Maman hinzuwerfen und laut aufzuschrein: »Laß mich hin, o laß mich doch hin!« Jetzt aber wächst im Herzen der Mutter wieder die Furcht und das Entsetzen.
»Es müßte natürlich sehr bald geschehen«, mahnt die Schneiderin.
Louise denkt an die sechzehn Francs im Monat. Sie denkt an die Lebensgefahr, in der sie ihre Tochter vermutet, wenn sich diese neuerdings einem solchen Zustand der Entrückung aussetzt.
»Vor kommendem Sonntag ist es unmöglich ...«
»Ich nehme das bereits als eine Zusage«, fällt ihr Madame Millet rasch ins Wort.
»Nein, nein, mein Mann wird das nie erlauben ...«
»Das ist keine Mannsgeschichte. Männer verstehen diese Dinge nicht«, sagt die Rentierswitwe aus alter Erfahrung.
»Wer wird seinem Mann gleich alles erzählen«, lacht die Peyret.
»Mesdames, ich kann es wirklich nicht zulassen, Sie müssen das einsehn von einer Mutter ... Wollen Sie die Bernadette krank machen und zum Gespött der Leute? ... Ich kann's nicht erlauben, als Mutter ...«
Die dicke Millet erhebt sich stolz:
»Auch ich bin eine Mutter, meine Beste, das heißt, mehr als eine Mutter. Auch ich habe ein Kind meines Herzens, das sehr leidet. Wenn ich an die Mühe denke, die dieses Kind gehabt haben mag, den weiten Weg hierher zu finden, dann wird es mir kalt bis in die Knochen ... Ich zwinge Euch zu nichts, Frau Soubirous. Wenn ich aber die Tür hinter mir geschlossen haben werde, dann tragt Ihr die ganze Verantwortung ...«
»Mein Kopf ... Das ist zuviel für meinen Kopf«, stöhnt die Soubirous.
»Und was meint unsere liebe Bernadette dazu«, beginnt die Schneiderin zu locken.
Bernadette steht noch immer gegen das rötliche Abendlicht, das um ihr Haar flammt. Sie steht gespannt da, als wippe sie auf den Zehenspitzen. Sie gleicht einem Springer im Augenblick, da er sich abstößt. Was kümmert sie die dicke Millet dort, was die häßliche Peyret, was die dumme arme Fegefeuerseele und dieser ganze Unsinn? Sie weiß nur eines: ihre herrliche Dame will sie sehn. Ihre herrliche Dame kann auch listig sein, um ihr eine neue Begegnung zu ermöglichen. Zu keinem anderen Zweck hat sie diese Frauen hierher gesandt. Mit einer leichten, klingenden und siegessicheren Stimme antwortet Bernadette:
Читать дальше