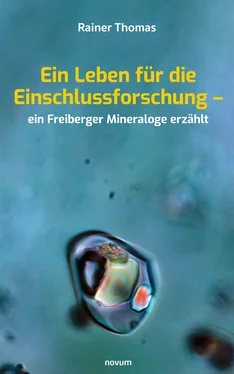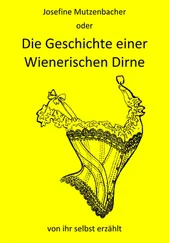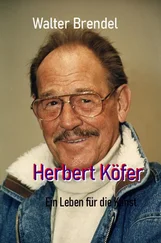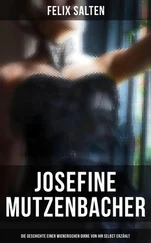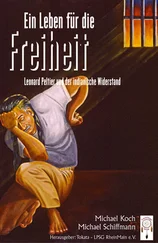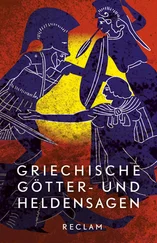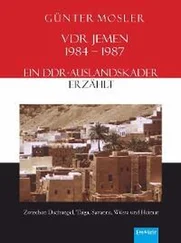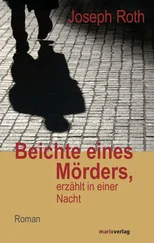Seine Prüfungen waren auch etwas gefürchtet. Sie begannen mit ganz überraschenden Fragen der Art: Stellen sie sich vor – Bitterfeld – großer brauner Haufen – was ist das? Wenn man da keinen einigermaßen brauchbaren Vorschlag gemacht hat, war man bei ihm schnell durch. Man konnte sehr freizügig eine Auswahl treffen – es musste sich nur eine interessante chemische Geschichte ableiten lassen.
Analytische Chemie wurde von Professor Gerhard Ackermann (geb. 1922 in Dresden) gelesen. Seine obligatorische Fliege ist aus der Erinnerung nicht wegzudenken. Er war Spezialist für die Spektralphotometrie. Unter seiner Leitung wurde eine Vielzahl von organischen Reagenzien als Komplexbildner für die Metallbestimmung untersucht und analytisch bewertet. Hier bin ich indirekt wieder auf das Dithizon gestoßen (s. Jahresarbeit zum Abitur). Auch Dr. Werner Schrön hat sich 1960 in einer kleinen Arbeit der Anwendung der Dithizonchemie bei der geochemischen Prospektion gewidmet.
Aus dem analytischen chemischen Praktikum ist mir, gleich am Anfang, meine fehlerhafte Arsenanalyse in guter Erinnerung geblieben. Ich hatte ein schwarzes Pulver auf Arsen zu untersuchen. Als Methode war die Destillation vorgeschrieben. Ich war schnell fertig und hab das Ergebnis abgegeben. Resultat: falsch! Wiederholungsuntersuchungen, ich glaube es waren 15 an der Zahl, immer wieder falsch! Letztlich war die Probe fast aufgebraucht und kein vernünftiges Ergebnis war zustande gekommen. Was war passiert? Bei der Probe handelte es sich um eine übereinander geschüttete schwarze Mischung, die ich vor der Analyse nicht homogenisiert hatte. Jede weitere Analyse musste also falsch werden. Möglicherweise hätte hier der Mittelwert aller falschen Analysen ein richtiges Ergebnis gebracht. Trotz des negativen Ergebnisses war das für mich eine wichtige Lehre. Man lernt eben auch aus Fehlern! Die anderen Bestimmungen, wie die komplexometrische Titration, haben mich wieder mit der analytischen Chemie versöhnt.
Organische Chemie war nicht Bestandteil des Studienplanes für Mineralogen. Ich habe die didaktisch gut aufgebaute Vorlesung bei Professor Günter Henseke (1917–1991) dennoch, zusammen mit Uli Recknagel, besucht. Diese Vorlesung war für mich ein großer Gewinn.
Von der physikalischen Chemie bei Professor Walter Mannchen (1905) ist nicht viel in Erinnerung geblieben. Auf dem Weg zum Institut hat er häufig Studenten in seinem Auto, einem P70, mitgenommen. Seine Prüfungen waren berühmt. Er fragte die Prüflinge in einem sehr ungezwungenen Gespräch nach ihrer Herkunft oder nach bestimmten Städten. Landete man zum Beispiel in Zittau, kam das Gespräch ganz sicher auf die dortige Blumenuhr und dann direkt auf die Osmose. Die Aussage: „nicht viel in Erinnerung geblieben“ ist nicht als fachliche Wertung zu verstehen. Die Vorlesung war solide, hat uns die notwendigen Grundlagen vermittelt, aber spektakuläre Versuche, wichtige Aussagen, eben der letzte Pfiff fehlten.
Vertiefende physikochemische Kenntnisse und insbesondere die Anwendung der Thermodynamik in den Geowissenschaften wurden uns im vorletzten Studienjahr 1968 durch Dr. Dieter Harzer (Jahrgang 1937), damals Mitarbeiter von Dr. Joachim Pilot (1928-2020) im Isotopenlabor in der Brennhausgasse 14, vermittelt.
Wenn ich aber heute auf diese Zeit zurückschaue, muss ich klar feststellen, dass die vermittelten Grundlagen als völlig unzureichend eingeschätzt werden müssen. Im Laufe der Jahre habe ich immer wieder feststellen müssen, dass die im Studium gelegte wissenschaftliche Basis sehr schwach war, wodurch ich oft bedauert habe, dass die erforderliche Tiefe nur schwer zu erreichen war und durch einen immensen Mehraufwand kompensiert werden musste. Der Grund dafür ist in dem generellen Ziel des Studiums zu sehen. Das Studium war nicht vordergründig für eine akademische Laufbahn (Hochschule, Forschungsinstitute) gedacht, sondern hat doch vor allem Praktiker ausgebildet. Zumindestens bei der Geologie war ein Hauptziel der Einsatz im Bergbau, aber auch bei den Behörden und Ämtern.
Mein Interesse an Chemie ebbte eigentlich nie ab. Beeindruckt und beeinflusst haben mich neben dem Trzebiatowski (Lehrbuch der anorganischen Chemie) die beiden Bücher von Linus Pauling „Grundlagen der Chemie“ und insbesondere „Die Natur der chemischen Bindung“, beide im Verlag Chemie in Weinheim 1964 erschienen. Diese beiden Bücher habe ich intensiv durchgearbeitet und habe dabei den eigentlichen Lernstoff etwas vernachlässigt. Ein anderes Buch hatte ich aus der Bibliothek oft ausgeliehen: Fritz Feigels „Quantitative Analyse mit Hilfe von Tüpfelreaktionen“. Auf dieses Buch bin ich bei meiner Chemie-Jahresarbeit in der ABF gestoßen und habe daraus viele Anregungen für die Mineral-Mikroanalyse erhalten, später (1980) habe ich z. B. den Nachweis von Bor in Flüssigkeitseinschlüssen in Mineralien vom Schneckenstein diesem Buch entlehnt.
Experimentalphysik hatten wir bei Professor Dr.-Ing. Rudolf Liebold (1903–1990). Diese Vorlesung hat erstaunlicherweise, außer einer schlechten Note, überhaupt keine Spuren hinterlassen. Nicht einmal eine Anekdote ist geblieben. Im physikalischen Praktikum wurden wir jeweils in Zweiergruppen betreut, zuletzt von Dr. Beckmann. Mein Partner war Uli Recknagel. Mit ihm habe ich viele Praktika gemeinsam absolviert. Beckmanns seltsame Einstellung zu uns Studenten ist in Erinnerung geblieben. Er sagte einmal: Die „Eins“ ist für mich, die „Zwei“ für die Assistenten und für euch bleibt die „Drei“, wenn ihr gut seid. Anfang 1967 hat er eine Professur an der Ingenieurschule in Zittau angenommen. Die armen Studenten dort!
Erwähnenswert ist noch die Röntgenstrukturanalyse im Studienjahr 1966/1967 bei Dr. Peter Klimanek (1935–2010). Klimanek war Physiker am Institut für Metallkunde und Materialprüfung an der Bergakademie. Er war an der Entwicklung und Anwendung von Methoden zur Beugung von Röntgenstrahlen an gestörten Kristallen interessiert. In den 70er-Jahren haben wir für ein Semester seine Vorlesung zur Feinstrukturanalyse zusammen mit Dr. Beyrich, Karl-Heiz Zeun und Hans Markus besucht. Die oft komplizierten mathematischen Gleichungen hat er stets aus dem Kopf an der Tafel entwickelt. Seine einzige Hilfe war ein kleiner, vielleicht 9 x 6 cm großer Zettel. Es kam vor, dass am Ende ein falsches Ergebnis an der Tafel stand. Darüber erschrak er und brach die Übung mit dem Hinweis ab, genau hier setzen wir in der nächsten Woche fort. Sein und mein Sohn Steffen besuchten gemeinsam die Körnerschule in Freiberg und waren lange befreundet.
Von den geologischen Fächern hat uns insbesondere die Vorlesung „Regionale Geologie“ bei Professor Adolf Watznauer (1907–1990) stark beeindruckt. Insbesondere vor der Prüfung in diesem lernintensiven Fach hatten wir Respekt. Die Prüfung fand in seinem Zimmer im Humboldt-Bau in gemütlicher Atmosphäre statt. Er kam in Filzlatschen ins Zimmer geschlurft. Als erstes fragte er uns, ob wir genau so doof sind wie die Vorgänger. Wider Erwarten haben alle in unserer Dreiergruppe eine „Eins“ erhalten.
Während des Studiums haben wir nichts von der neuen Theorie der Plattentektonik gehört. Auch Alfred Wegener wurde noch verlacht und bestenfalls als Kuriosum genannt. Die Gebirgsbildung wurde u. a. durch Isostasiestörung und Unterströmungstheorien erklärt. Begriffe wie Geosynklinalstadium, Tektogenese und Morphogenese standen im Mittelpunkt bei der Entstehung von Orogenen.
Am Ende des Studiums, es war wohl im Frühjahr 1969, wurden die Freiberger Geologen und Mineralogen im großen Hörsaal in der Brennhausgasse auf einen neuen Kurs der Regierung eingeschworen: Erkundung von Erdöl und Erdgas auf dem Territorium der DDR – eine Forderung der Sowjetunion. Alle Vortragenden waren euphorisch – nur Professor Adolf Watznauer wagte Widerspruch und meinte, auf dem geologisch und tektonisch stark gegliederten Terrain ist mit ergiebigen Lagerstätten prinzipiell nicht zu rechnen – er sollte Recht behalten. Natürlich wurden kleine Lagerstätten gefunden und auch ausgebeutet. Auch viele neue Erkenntnisse zur Geologie im Norden der DDR wurden gewonnen. Aber letztlich war das Unternehmen ein Milliardengrab und schwächte empfindlich die Wirtschaft der DDR. Es war wohl ein Ansinnen der damaligen Sowjetunion, einen möglichen und zu großen wirtschaftlichen Aufschwung auszubremsen. Man könnte auch fragen: Wo geht‘s denn hier zum Fortschritt? Antwort: Immer den Bach runter.
Читать дальше