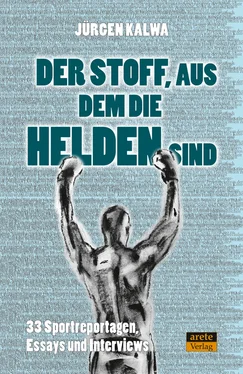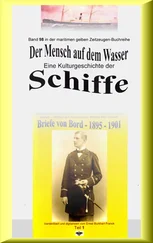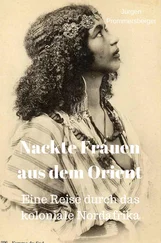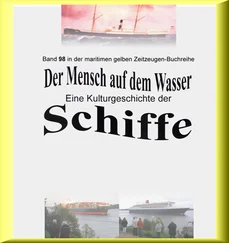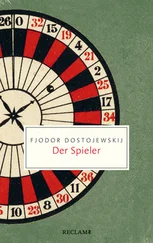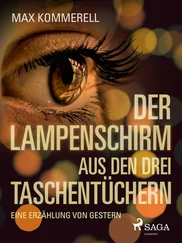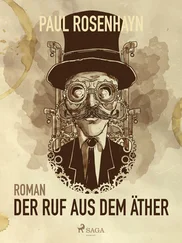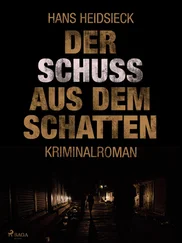Was den Charakter der Texte anbetrifft: Sie nutzen den Formenreichtum, den wir in der alltäglichen journalistischen Arbeit kennen. Es handelt sich hierbei um Reportagen und Stimmungsbilder, um essayistische Betrachtungen sowie um Protokolle von ausführlichen Interviews mit profilierten Gesprächspartnern, die pointiert und substanziell zum jeweiligen Thema Auskunft geben.
Niemanden sollte überraschen, dass man als Journalist im Laufe der Zeit einiges aus dieser Stoff-Sammlung bereits publiziert hat: in meinem Fall in Medien wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung , den drei Programmen von Deutschlandradio , den nicht mehr existierenden Zeitschriften Sports und No Sports (nicht verwandt und nicht verschwägert miteinander), dem Sportmagazin der Schweizer Illustrierten sowie mehreren Büchern.
Um der zeitlichen Einordnung Rechnung zu tragen, erschien es angebracht, die Texte mit Angaben zu dem Jahr zu versehen, in dem sie entstanden sind oder in wesentlichen Passagen entwickelt wurden. Was aus den zentralen Figuren in der Zeit danach geworden ist, wird dort, wo es angebracht schien, in einem kurzen Anhang hinzugefügt.
Das Buch enthält daneben aber auch Texte, die bislang nicht erschienen sind. Und solche, die eigens für dieses Buch geschrieben wurden.
Natürlich reist stets eine Hoffnung mit: dass eine solche Anthologie auf mehr neugierig machen könnte. Deshalb an dieser Stelle noch ein Hinweis auf drei Bücher. Aus zweien habe ich für dieses Projekt jeweils eine längere Passage übernommen: Sowohl Tiger Woods. Charisma für Millionen 29als auch Nichts als die Wahrheit. Der Fall Lance Armstrong und die Aufarbeitung eines der größten Betrugsskandale in der Geschichte des Sports 30und Dirk Nowitzki. So weit, so gut – von Würzburg zum Weltstar. Eine etwas andere Biographie“ 31möchte ich an dieser Stelle gerne als weiterführende Lektüre empfehlen.
In jedem Fall wünsche ich viel Vergnügen auf dieser Tour d’Horizon , und bedanke mich bei allen Weggefährten, die durch ihre Ermunterung, ihre Aufträge, ihr Wohlwollen und ihre Kritik im Laufe der Jahre mein Schaffen ermöglicht haben.
Jürgen Kalwa West Cornwall, Februar 2022
1 Gerhard Roth: Erkenntnis und Realität – das reale Gehirn und seine Wirklichkeit in: Siegfried J. Schmidt (Herausgeber): Der Diskurs des radikalen Konstruktivismus , Frankfurt, 1987
2 Das Gehirn weiß wenig von der Wirklichkeit , Interview, Bild der Wissenschaft , Oktober 1998
3 Paul Gallico: Farewell to Sport , New York. Die Anthologie veröffentlichte Gallico, als er aus dem Sportjournalismus ausstieg und sich dem Schreiben anderer Stoffe widmete. So erfand er die Figur des Journalisten Hiram Holliday, der kuriose Abenteuer erlebt, die in den fünfziger-Jahren fürs Fernsehen verfilmt wurden. Viele seiner Romane und Drehbücher wurden zu kommerziellen Erfolgen. Eine seiner Hinterlassenschaften ist der Amateurbox-Wettbewerb Golden Gloves , Durchgangsstation für viele namhafte amerikanische Profis.
4 Turn of the Century Fights, Inc.: Jack Dempsey vs. Luis Firpo for Heavyweight Championship, New York, September 14, 1923 , veröffentlicht 1964
5 Der Kampf, der am 14. September 1923 im New Yorker Madison Square Garden stattfand, galt unabhängig von der Vorgeschichte aus dem Trainingslager jahrzehntelang als einer der denkwürdigsten in der Geschichte des Profiboxens. Eine Anspielung auf ihn ( „I’m telling ya if this guy sat ringside at the Dempsey-Firpo fight, he‘d be tryin‘ to tell us Firpo won!” ) in der 1957 veröffentlichten Hollywoodfassung des Fernsehdramas und Theaterstücks Die zwölf Geschworenen demonstrierte seinen besonderen Stellenwert im kulturellen Gedächtnis der USA.
6 Paul Gallico: Farewell to Sport , Seiten 289-290
7 George Plimpton: Paper Lion – Confessions of a Last String Quarterback , New York, 1966. Sein Bericht über seine Zeit im Kader eines NFL-Teams gilt als „das beste Buch, das je über Profi-Football geschrieben wurde” ( Saturday Review ), weil es den Blickwinkel eines durchschnittlichen Football-Fans repräsentiert. Plimpton führte das gleiche Experiment mehrfach durch und schilderte seine Erfahrungen – darunter im Profi-Eishockey, in der NBA, in Major League Baseball, auf der PGA-Tour der Golfer und im Box-Ring – in insgesamt sieben Büchern. Seine Vorgehensweise nannte er konsequenterweise „participatory journalism“. Aus Teilnahme wird Teilhabe.
8 Steven Fatsis: A Few Seconds of Panic: A Sportswriter Plays in the NFL , New York, 2008
9 Rick Reilly: Who’s Your Caddy? Looping for the Great, Near Great, and Reprobates of Golf , New York, 2004
10 Rick Reilly: Der Mann, der nicht verlieren kann: Warum man Trump erst dann versteht, wenn man mit ihm Golfen geht, Hamburg, 2020
11 Das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung machte im Januar 2020 bekannt, weshalb die Zeitung ein Interview mit dem ehemaligen Fußball-Profi Bastian Schweinsteiger und dem Schriftsteller Martin Suter abgelehnt hatte: Die Gegenseite hatte verlangt – „über die übliche Autorisierung des Wortlauts hinaus“ – sowohl Titel, Vorspann und Bildunterschriften vorab gegenzulesen. ( Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung , 16. Januar 2022, Seite 39). Eine Anmerkung zum Stichwort: „Autorisierung”. Keines der Interviews in diesem Buch (und nur ein einziges im Laufe meiner journalistischen Karriere) wurde einem solchen Prozess unterzogen. Dieses Entgegenkommen der Medien ist zwar in Deutschland „üblich”, aber nicht im Rest der Welt. Selbst ein so stark beachteter Rechtsstreit wie der zwischen Janet Malcolm vom New Yorker und einem namhaften Psychoanalytiker (David Margolick: Psychoanalyst Loses Libel Suit Against a New Yorker Reporter, New York Times , 3. November 1994) hat an der Praxis nichts geändert. Ebenso wenig mehrere prominente Fälle junger Journalisten, die frei erfundene Artikel veröffentlichen konnten wie Stephen Glass, dessen Aufdeckung im Hollywood-Film Shattered Glass nachgezeichnet wurde. Währenddessen kommt es in Deutschland schon lange auch und gerade im Sportjournalismus zu Konflikten (siehe auch: David Bernreuther: Zwischen Maulkorb und Meinungsfreiheit: Kritische Interviews von Fußballprofis und ihr Medienecho. Eine Inhaltsanalyse Berlin 2012, Seite 45
12 Norman Mailer: The Fight , New York, 1975
13 Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit: Die Verlagswerbung für die Box-Anthologie von Wolf Wondratschek ( Im Dickicht der Fäuste , Berlin 2021) wirft ein Licht darauf, wie weit die Identifikation gehen kann. Die Texte handeln demnach unter anderem „vom Schriftsteller als ‚einzigem Bruder des Boxers, dem Verbündeten seiner Einsamkeit‘”. Der Rezensent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung empfand bei der Bewertung der Erstausgabe des Buchs, das 2005 erschien, solchen Pathos als „dick aufgetragen” und kanzelte die Pose als „Vitalismus” ab.
14 Karl-Heinrich Bette: Sporthelden. Spitzensport in postheroischen Zeiten , Bielefeld 2019, Seite 34
15 Susanne Marschall/Bodo Witzke: „Wir sind alle Menschenfresser“: Georg Stefan Troller und die Liebe zum Dokumentarischen , Norderstedt, 2012)
16 Bertram Job: Schwer gezeichnet. Geschichten vom Boxen . Göttingen, 2006
17 Bertram Job: Der Held rettet die Welt nicht, Taz , 22. November 1996
18 In seinem Artikel Sportjournalismus in der Krise: Lieber irgendwas über Ronaldo (Taz , 10. Dezember 2021) beschreibt der Journalist Martin Krauß die Entwicklung in einem erheblichen Teil der deutschen Medien als dramatisch. Ein Zitat von Tobias Schächter, Sportredakteur der Badischen Neuesten Nachrichten , vermittelt dabei, wie bestimmte Mechanismen wirken: „Immer mehr Redaktionen setzen auf Instrumente wie Readerscan , schauen also ganz genau, was am meisten gelesen, am meisten geklickt wird. Heraus kommt, dass Geschichten über Cristiano Ronaldo im Blatt stehen müssen.“
Читать дальше