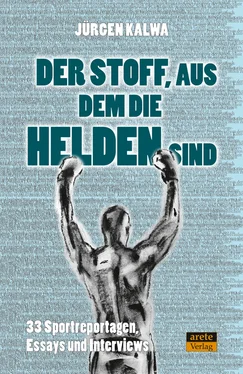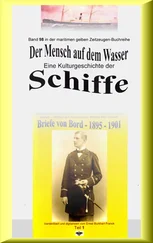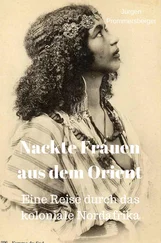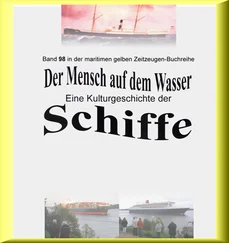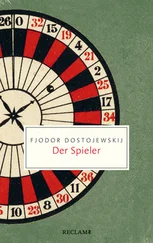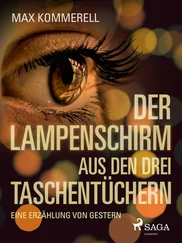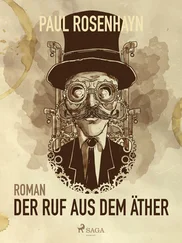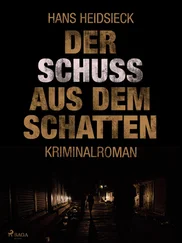Die unterscheiden sich in einem wichtigen Punkt von ihren Kollegen in den Profiligen: Amerikas Studenten waren bis vor kurzem echte Amateure. 34Egal ob sie gewannen oder verloren – solange sie die Farben der Hochschule trugen, bekamen sie nichts außer einem Stipendium. Sie wurden streng abgeschirmt von Schuh-Deals, Prämien, Sachgeschenken, Vorverträgen und sogar von Essenseinladungen. Selbst jemand wie Tiger Woods hatte als Student keinen Spielraum. Als er mit seinem namhaften Golferkollegen Arnold Palmer eines Tages ein Restaurant besuchte, bezahlte der zwar die Rechnung. Woods jedoch musste ihm hinterher einen Scheck schicken. Hätte er Palmer nicht seinen Anteil erstattet, hätte er sein Stipendium einbüßen können und wäre gezwungen gewesen, die teuren Studiengebühren der Stanford University selbst zu bezahlen. Und dieses Geld hatte der Mann damals nicht, der später als allererster Sportler die Milliardengrenze an Bruttoeinnahmen überschreiten sollte.
Das vermeintliche Idyll produziert nicht nur Absurditäten. Es fabriziert Risse. Denn der Universitätssport kommt nicht mehr mit seiner selbstgewählten Rolle als Ausbildungslager für den Profibereich zurecht. Die Verzahnung mit den Medien hat an den Hochschulen zu einem Starsystem eigener Prägung geführt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Mythos vom erfolgreichen Amateurathleten und dem unbefleckten Helden- und Leistungskult endgültig seinen Glanz verliert.
Nicht alle Nachwuchstalente drängen in den Profibereich. Es gibt jene, die das, was sie an der Universität und auf dem Spielfeld erreicht haben, in andere Karrieren ummünzen. Einige fühlen sich sogar berufen, in die Politik zu gehen. Wie der Princeton-Absolvent und Basketball-Olympiasieger Bill Bradley, der nach einer Karriere bei den New York Knicks Senator in Washington wurde. Oder wie der Football-Quarterback Jack Kemp, der in den achtziger-Jahren unter den Präsidenten Ronald Reagan und George Bush das Wohnungsbauministerium leitete.
Sport und Politik stehen sich in den USA nicht weltfremd gegenüber. Die Morgenjogger Bill Clinton und George W. Bush waren nicht die letzten Golfer in einer Reihe sportaktiver Präsidenten, die mit Dwight D. Eisenhower begann. Nach dem Golfer (und College-Basketballer) Barack Obama demonstrierte Donald Trump, dass sich so etwas noch steigern lässt. Er spielte fast nur auf Golfplätzen, die ihm selbst gehören und die er penetrant mit seinem Namen plakatiert hat.
Auch amerikanische Intellektuelle und Schriftsteller haben sich mit Sport beschäftigt. Von Scott F. Fitzgerald (Football) und William Faulkner (Kentucky Derby) bis Norman Mailer (Boxen), Stephen King (Baseball) und John Irving (Ringen) spannt sich ein beeindruckender Bogen von literarischen oder essayistischen Annäherungen, die bemerkenswerten Lesestoff hervorgebracht haben. Wie etwa den Roman Der Sportreporter von Richard Ford, der eine vielschichtige, nachdenkliche Kunstfigur aus dem Typenspektrum der gleichnamigen journalistischen Subspezies herausgeschnitzte und in drei weiteren Romanen weiterentwickelte 35.
Hollywood spielte mit einer Handvoll guter Filme ebenfalls einen Part. Und das auch, weil Schauspieler wie Robert Redford ( The Natural ) oder Paul Newman ( Slapshot ) keine Berührungsängste hatten, obwohl ihnen sicher die Schwierigkeit bewusst war, Sport fürs Kino zu inszenieren. Manche Filme sind so gut, dass sie einem das Milieu auf eine erotische und zugleich humorvolle Weise nahebringen. Unübertroffen: Susan Sarandon und Kevin Costner in dem Südstaaten-Baseball-Film Bull Durham .
Wenn man der Frage, worin die Dynamik der amerikanischen Sportkultur besteht, noch ein wenig weiter nachgeht, stößt man auf zusätzliche Elemente. Eines ist der Kalender mit einer beachtlichen Palette von Sportarten, die das ganze Jahr über für Höhepunkte und Abwechslung sorgen. Ein anderes ist ein spürbarer Eskapismus unter Männern, die mehrere Jahrzehnte nach dem Aufbruch der Frauenbewegung den Sport als Reservat für Männerkult und Sexismus pflegen. Hier können sie sich von der Emanzipationsrealität in eine Vorstellungswelt zurückziehen, die woanders in der Gesellschaft nicht mehr existiert, wie Mariah Burton Nelson schon vor einiger Zeit in ihrem provokativen Buch The Stronger Women Get, the More Men Love Football 36herausgearbeitet hat.
Es passt in die Landschaft, dass sich die USA seit der Bürgerrechtsbewegung und dem Krieg in Vietnam in einer anhaltenden gesellschaftspolitischen Sinnkrise befinden. Mögen Politiker, Professoren und Pastoren so viel reden wie sie wollen, immer weniger Amerikaner hören ihnen zu. Die konsumverwöhnte Mittelklasse hängt lieber den Siegertypen aus den Riesen-Arenen an den Lippen. Neue Helden und geheime Verführer, die mit Hip-Hop-Musik und über Social-Media-Kanäle Schuhe, Kappen, Trikots und Bälle verkaufen. Immer mit dabei: die prickelnde uramerikanische Ideologie des „Gewinnen ist alles“. Den Siegern gehört die Welt.
Viele dieser Sieger sind schwarz – nicht nur im Basketball, wo 80 Prozent der NBA-Profis eine dunkle Hautfarbe haben, oder im Football, wo mehr als 60 Prozent der NFL-Spieler Afro-Amerikaner sind. Eine erstaunliche Entwicklung nur ein halbes Jahrhundert nach der Abschaffung der Rassentrennung im Süden der USA. Schwarze Athleten haben einen Anteil daran, die Phobien von Weißen gegenüber großen und starken dunkelhäutigen Männern zu beschwichtigen. Aber das reicht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Sobald afro-amerikanische Athleten Probleme mit der Polizei bekommen oder auf dem Platz ausflippen, hagelt es von Vorurteilen geprägte Kritik.
Mit anderen Worten: Selbst durch den Sport als Erfolgsmenschen ausgewiesene und bestens bezahlte Schwarze müssen im weißen Amerika mit seinen Mikroaggressionen und Herabsetzungen unablässig um Anerkennung und Respekt kämpfen. Dieser Kampf, der ihre Persönlichkeit formt und sich als unverstellte, authentische Erfahrung vermittelt, ist der Hauptgrund dafür, weshalb die erfolgreichen schwarzen Sportler in den USA mehr sind als Sprechpuppen der Sportartikelindustrie.
Wenn man tiefer schaut ins feine Gewebe eines Spieles wie Basketball, sieht man übrigens, wie schwarze Spielkultur die Wechselbeziehung von Mitspielern und Gegnern beim Kampf um Spielfläche und Dribbel-Wege modifiziert hat. Was früher ein Mannschaftsspiel war, in das sich der einzelne einordnet, ist heute ein Varieté von One-Man -Shows, ruppigen Rivalitäten, bei dem das Bedürfnis nach dem Übertrumpfen, nach sogenannter One-upmanship stärker ist als das Gefühl für Kameradschaft.
Obwohl der Bedarf an Stars angesichts der unübersehbaren Medienlandschaft mit ihren Live-Übertragungen, der angeflanschten Bierreklame und den wachsenden Erwartungen der Zuschauer groß ist, produziert die Heldenfabrik keine Fließbandfabrikate. Wer allzu früh hochgelobt wird und zu viel verdient, dem droht, frühzeitig zu scheitern. Schon besser, einer fängt ganz unten an. Erst dann entsteht der Stoff, aus dem der Glamour ist.
Als Michael Jordan 1984 nach dem Studium und nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen Profi wurde und zu den Chicago Bulls kam, waren sie eine der schlechtesten Mannschaften in der NBA. Er fand schnell heraus, was das heißt: „In den ersten paar Minuten des ersten Spiels wurde ich umgehauen und landete auf dem Boden.“ Es dauerte dreieinhalb Jahre, in denen er ackerte und artistischer und unberechenbarer wurde, bis die Bulls zum ersten Mal die Playoffs der besten 16 NBA-Mannschaften erreichten. In jener Saison spürte man, dass Jordan vielleicht eines Tages seine Sportart dominieren könnte. Er war bester Defensivspieler, erfolgreichster Korbschütze, Slam-Dunk -Champion und wurde als Most Valuable Player ausgezeichnet.
In den Jahren danach zeigte er, dass man als Sportler noch weiter gehen kann, als Titel und Meisterschaftsringe zu sammeln und Millionen von Dollar aufeinanderzuschichten. Kein anderer Athlet hat die Grenzen zwischen Privatheit und öffentlicher Person derartig subtil aufgelöst und aus der eigenen Person ein Mediengesamtkunstwerk à la Joseph Beuys oder Andy Warhol geschaffen. Nicht mal Muhammad Ali, der nach seinem Übertritt zum Islam den Wehrdienst verweigerte und dafür vom Boxverband gesperrt wurde. Das jüngste Resultat für diesen gesellschaftlichen Prozess: Der im Frühjahr 2021 veröffentlichte zehnteilige Dokumentarfilm, Titel The Last Dance , den der Fernsehsender ESPN produzierte und der den Kunstgriff benutzt, auf Jordans allerletzte Saison in Chicago 1997–98 zurückzublenden, während er gleichzeitig das Panorama der Charakter- und Persönlichkeitsmerkmale des Basketballers und seinen Einfluss auf seine Mitspieler beleuchtet. Die Wirkung ließ sich an den Einschaltquoten ablesen: Die zehn Episoden erreichten im Schnitt live mehr als fünf Millionen Zuschauer und fast 13 Millionen pro Folge, die sie sich die Doku nachträglich on demand anschauten.
Читать дальше