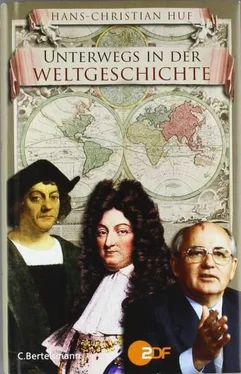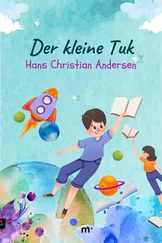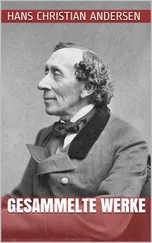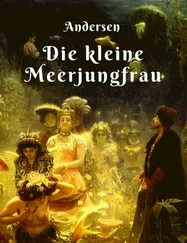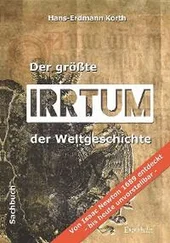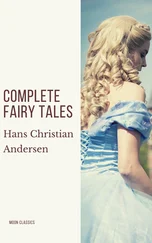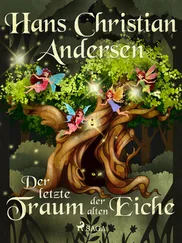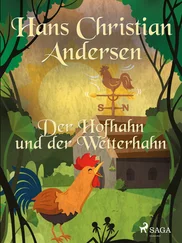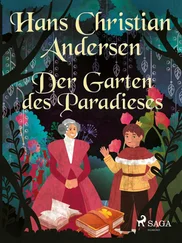Die Bewohner Mesopotamiens, insbesondere die Menschen im unteren Drittel des Flusspaares, das - analog zum Nildelta - den Hauptgewinn bei der Schmelzwasserverteilung erzielte, waren nicht nur Ingenieure, sondern wahre Künstler bei der Nutzung der nassen Fracht aus den Schneegebirgen. Dämme, Bewässerungs- und Berieselungsanlagen, Stauseen, Kanalsysteme, die sich wie Adern verzweigten, Abflussgräben, die die sumpfigen Niederungen anzapften, Schöpfräder, die das Wasser in die höher gelegenen Felder füllten: Mesopotamien und speziell das zum Mündungsgebiet sich erstreckende Babylonien hatten sich in eine riesige Oase, eine fruchtbare Getreide- und Gartenlandschaft verwandelt.
Und auch ein dem segenstiftenden Element angemessenes Fahrzeug wurde erfolgreich konstruiert. Die Guffa, ein korbähnliches Fortbewegungsmittel, aus den Stielen von Palmblättern geflochten und mit Erdpech abgedichtet, kam dann zum Einsatz, wenn das Land sich auf dem Höhepunkt der Schneeschmelze in eine riesige Wasserfläche verwandelt hatte. Aber auch auf dem Rücken schwimmender Pferde konnte man sich erfolgreich durch das Wasserlabyrinth navigieren. Als drittes mobiles Hilfsmittel wurden nach alter Tradition aufgeblasene Schläuche aus Hammelhäuten verwendet. Wie ein Alabasterrelief aus dem neunten vorchristlichen Jahrhundert zeigt, wurde diese Technik auch militärisch genutzt, um bei Flussüberquerungen Mannschaft und Ausrüstung auf die andere Seite zu bringen; nur die Kriegswagen wurden auf Boote verfrachtet.
Wenn es einen Preis für Völker gäbe, die sich zeitweise in Amphibien verwandeln können - die Menschen im unteren Zweistromland hätten ihn verdient.
Begonnen hatte alles, fast alles mit den Sumerern. Glaubt man ihren Priestern, die sich gern auch als Geschichtsforscher gerierten und das Leben ihrer Könige in ausufernden Listen festhielten, so reicht die sumerische Kultur 432 000 Jahre zurück. Bei realistischer Einschätzung entstand sie gegen Ende des vierten Jahrtausends v. Chr. im südöstlichen Teil Mesopotamiens, also jener historischen Region im heutigen Irak, die von den mächtigen Unterarmen der Zwillingsflüsse umgrenzt wird und im Anklang an die um 1800 v. Chr. erbaute, von den Griechen »Babylon« getaufte Hauptstadt seither als Babylonien bezeichnet wird.
Die Sumerer, das älteste Kulturvolk des Orients, erhielten ihren Namen von ihren Nachfolgern, den Akkadern. Diese tauften sie sumeru.
Schon die frühen Zentren der Sumerer - Städte wie Ur, Uruk, Nippur oder Lagasch in der Nähe des Persischen Golfs - fassten bis zu 50 000 Einwohner. Die hoch aufragenden Stufentempel, die sie ihren Göttern widmeten und die als Zikkurate (akkad. = Götterberge) bekannt wurden, dürften die späteren Fantasien um den Turmbau zu Babel und die entsprechende Passage im Alten Testament angeregt haben. Vor allem aber dienten sie der Beobachtung der Himmelskörper.
Die sumerische Metropole Eridu am Persischen Golf gilt als eine der ersten Städte der Weltgeschichte. Ihre Vorstufen reichen bis ins sechste Jahrtausend v. Chr. zurück. Nach 2000 v. Chr. wurde die Hafenstadt wegen Versandung der Lagune aufgegeben.
Ab 3500 v. Chr. entwickelte sich Uruk, Hauptkultort der sumerischen Himmelsgöttin Inanna und Sitz des sagenhaften Herrschers Gilgamesch, zur ersten Großstadt der Welt. In der Bibel kommt sie als Erech vor. Im Laufe des dritten Jahrtausends gewinnt Ur an Bedeutung und wird mehrfach Hauptstadt Babyloniens. Nach biblischer Überlieferung war Ur die Heimat Abrahams. Die Königsgräber von Ur mit kostbaren Beigaben an Metall- und Edelsteinarbeiten sind in den 1920er- und 30er-Jahren freigelegt worden.
Die berühmteste Hinterlassenschaft der Sumerer ist aber ihre Schrift. Die sumerische Keilschrift, deren keilförmige Striche mit einem Rohrgriffel in weiche Tontafeln eingedrückt wurden, entwickelte sich genau wie die Hieroglyphen und wie das moderne Alphabet aus der Abstrahierung von Bildzeichen. Bilder mit einfacher Bedeutung standen am Anfang, später wurden komplexere Begriffe mithilfe von Zeichenkombinationen dargestellt, und der Lautwert wurde allmählich wichtiger, analog der Entwicklung des Alphabets.
Die sumerische Schrift entstand zwischen 3400 und 3200 v. Chr. und wurde bald auch von anderen vorderasiatischen Völkern übernommen. Zeitlich synchron trat auch Ägypten in den Stand der Schriftlichkeit. Erst ein gutes Jahrtausend später entstand die Bilderschrift der ersten europäischen Hochkultur auf Kreta.
In jedem Fall ist die sumerische Schrift eine kaufmännische Erfindung, keine Schöpfung von Dichtern oder Priestern. Ob es nun um Rinder, Getreide, Wein oder Öl ging - es galt Lieferungen zu registrieren und Warenmengen festzuhalten. Während sich die sumerische Schrift, wie die Archäologen feststellen konnten, über Jahrhunderte entwickelte, scheint das System der ägyptischen Hieroglyphen - auch wenn es noch zahlreiche Ergänzungen und Veränderungen gab - von Anfang an fast »fertig« gewesen zu sein. Aber was die Priorität, also das »Erstgeburtsrecht«, und die konkrete Schriftpraxis angeht, könnte jeder neue Fund in Ägypten oder in Mesopotamien das Bild wieder verändern.
Auch das Heldengedicht über den König Gilgamesch, das um 1850 v. Chr. entstand, ist uns in der charakteristischen Keilschrift überliefert. Um den königlichen Halbgott Gilgamesch rankt sich ein Kranz mythischer Erzählungen, in denen er nach gewaltigen Heldentaten den Versuch unternimmt, das ewige Leben zu gewinnen.
Das älteste Großepos der Menschheit ist zugleich die früheste schriftliche Quelle für das Auftreten einer alles vernichtenden Flut -den Mythos der Sintflut, der selbst wiederum eine Sintflut an Mythen in Gang gesetzt und sich tief in das kollektive Gedächtnis eingegraben hat. Wie in der Bibel spielt auch im Gilgamesch-Epos die rettende Arche eine Rolle.
Den Sumerern verdanken wir auch die Einteilung des Kreises in 360 Grad und die der Stunde in sechzig Minuten. Nach diesem Sechziger-System richtete sich auch die sumerische Währung. Mit der »Erfindung« der Sieben-Tage-Woche, die auch die Schöpfungsgeschichte der Bibel geprägt hat, mit den Tierkreiszeichen und der Benennung zahlreicher Sternbilder ragt das altbabylonische Kulturerbe bis tief in den heutigen Alltag hinein.
Lange Zeit galten die semitischen Akkader, deren König und Reichsgründer Sargon sich um 2235 v. Chr. zum »Herrn der vier Weltteile« ausrief, als das älteste Volk des Orients. Sie übernahmen die Kernelemente der sumerischen Kultur, darunter die Keilschrift, und beteten zu den Göttern ihrer Vorgänger. Mit ihrer Hauptstadt Akkad aber entfernten sie sich von den sumerischen Zentren am Persischen Golf und konzentrierten sich dort, wo Tigris und Euphrat erstmals einander nahekommen. Die Gegend um das spätere Babylon gewann an Bedeutung.
Und Babylon selbst? Noch gibt es sie gar nicht, oder sagen wir, sie kommt in der Geschichte noch nicht vor: die Stadt, die stärker als Jerusalem und Rom die Fantasie der Menschen beschäftigt hat, die zum Nabel der Welt und zum Inbegriff eines Schmelztiegels der Zivilisationen geworden ist. Zwar wird das »Tor Gottes«, wie das babylonische Wort babilu zu übersetzen ist, erstmals Ende des dritten Jahrtausends v. Chr. erwähnt, aber erst im Verlauf des zweiten Jahrtausends gewinnt es an Bedeutung, und bis zur neubabylonischen Glanzzeit unter dem Chaldäer Nebukadnezar, der das Ischtar-Tor baut, wird noch ein weiteres Jahrtausend vergehen.
Es gehört zu den historischen Merkwürdigkeiten, an denen der Alte Orient so reich ist, dass die eigentliche Gründung Babylons einem - aus sumerisch-akkadischer Sicht - primitiven Kriegervolk zuzuschreiben ist. Der ersten semitischen Einwanderung ins Zweistromland im dritten Jahrtausend v. Chr. folgte um 2000 v. Chr. eine neue aus der syrischen Wüste. Es sind die Nomadenstämme der Amoriter, die um 1800 v. Chr. die Vorherrschaft im mittleren Mesopotamien gewinnen und eine Reihe von Dynastien gründen, die erste davon in Babylon. Sechster Herrscher der babylonischen Dynastie wird König Hammurabi.
Читать дальше