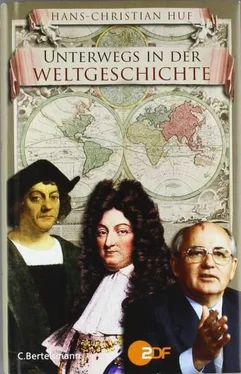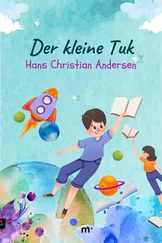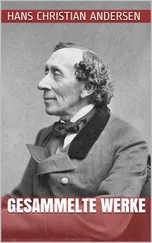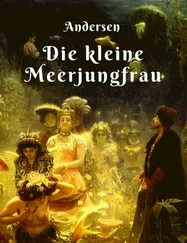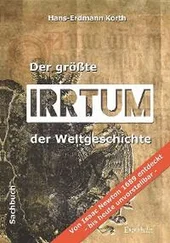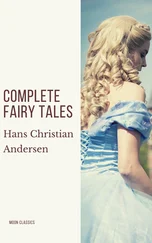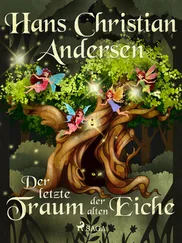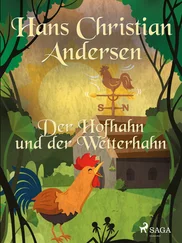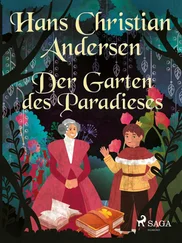2. Die Eroberung des Planeten
Können Sie sich eine Stadt ohne Straßen vorstellen? Wahrscheinlich nicht. Aber auch die Straße musste erst erfunden werden. Zuvor stellten Flachdächer und Leitern die Verbindung zwischen Häusern und Menschen her - wie hier in Çatal Hüyük in Anatolien, einer Siedlung aus dem siebten Jahrtausend v. Chr. Doch schon diese zivilisatorische Etappe bedeutet eine Revolution und stellt alles in den Schatten, was danach kam.
Homo ergaster, den »arbeitsamen« Menschen, haben Sie eben schon kennengelernt. Mit ihm beginnt das Reiseprogramm der Gattung Homo. Sie können gern daran teilnehmen, aber Sie sollten wissen, dass es Expeditionen ins Ungewisse sind. Wenn die Formel »Der Weg ist das Ziel« irgendwo zutrifft, dann hier. Und es ist ein weiter Weg aus der afrikanischen Savanne zu den Siedlungen von Çatal Hüyük oder Jericho.
Training und Vorbereitung sind bei Homo ergaster in guten Händen. Sie können sich den Clans anschließen, die er, mit stetig wachsendem Aktionsradius, durch die Graslandschaften seiner afrikanischen Heimat führt. Nach dem Exodus wandert er über Generationen nordwärts, erreicht den Kaukasus, und seine Nachfahren dringen vor rund 800 000 Jahren bis nach Zentralasien vor. Aber 40 000 Jahre vor unserer Zeit wird er wieder von der Erde verschwinden.
Falls Sie vorsichtig gewesen und zu Hause, das heißt in Afrika, geblieben sind, haben Sie jetzt zweimal die Chance, Europa zu entdecken - vor rund 1,2 Millionen Jahren mit dem etwas lieblos als »Vorläufer« benannten Homo antecessor oder 600 000 Jahre später mit dem Homo heidelbergensis, dessen Name auf die frühesten Fundorte seiner Knochen verweist. Homo heidelbergensis verfügt bereits über ein Hirnvolumen von 1300 Kubikzentimetern und gilt als der erste Großwildjäger. Er beherrscht das Feuer und konstruiert hölzerne Wurfspeere mit vorzüglichen Flugeigenschaften. Als erster Zweibeiner lässt er ein Fünkchen Kultur aufblitzen, indem er Schmuckgegenstände herstellt und Steinwerkzeuge als Totenbeigaben verwendet.
Berühmt geworden aber ist Homo heidelbergensis als der letzte gemeinsame Vorfahr des Homo sapiens, der sich in Afrika entwickelt, und des Neandertalers, der aus europäischen Populationen des »Heidelbergers« hervorgeht. Das Verhältnis der beiden ungleichen Verwandten beschäftigt die Wissenschaft bis heute. Die Verteilung der Sympathiewerte hat dabei bisweilen an die Geschichte von Kain und Abel erinnert.
Falls Sie auf den Homo sapiens, den »weisen« Menschen, gesetzt haben, müssen Sie vor seinem Siegeszug allerdings einen relativ erfolglosen Aufbruch aus Afrika vor etwa 100 000 bis 95 000 Jahren in Kauf nehmen, der an der Kälte scheitert und ihn in seine Heimat zurückwirft. Immerhin hat ihn der Vorstoß bis in den Nahen Osten und dort zu einem ersten Rendezvous mit den Neandertalern geführt, die aus dem Norden in diese Gegend kamen.
Erst in der letzten - entscheidenden - Auswanderungswelle vor rund 60 000 Jahren kann Homo sapiens außerhalb seiner Urheimat Fuß fassen. Noch in Afrika hat er eine immer komplexere Sprache entwickelt und gelernt, symbolisch zu denken. Zudem hat er neue, hocheffektive Distanzwaffen erfunden. Mit ihnen kann er nun Beute aus sicherer Entfernung erlegen und immer mehr Urmenschen um sich herum mit Nahrung versorgen.
Wenn Sie abenteuerlustig genug und bis jetzt dabeigeblieben sind, können Sie sich nun auf einiges gefasst machen. Die Auswanderer überqueren das Rote Meer, erreichen die Arabische Halbinsel und hinterlassen bereits wenige Jahrtausende später ihre Spuren am äußersten Zipfel Südostasiens. Vor 55 000 Jahren überwinden einige Vertreter der Reisegruppe Sapiens mit Kanus und Flößen fast hundert Kilometer offenen Ozeans und erreichen erstmals einen noch unbesiedelten Kontinent: Australien. Mit kontrollierten Flächenbränden - so haben Wissenschaftler herausgefunden - locken sie Beutetiere wie Kängurus oder Riesenechsen aus ihren Verstecken und verändern so allmählich Fauna und Flora.
Wie Sie längst gemerkt haben, gibt es keinen vorprogrammierten Reiseablauf. Die Kolonisierung der Erde ist kein planvolles Projekt. Die Migranten folgen einfach den Wildwechseln, suchen jagend und sammelnd neue Tiere und Pflanzen. Mit seiner Anpassungsfähigkeit kann Sapiens, der »moderne« Mensch, mittlerweile auch ungünstigen Umweltbedingungen trotzen. Also haben Sie sich für die richtige Reisegruppe entschieden, Homo sapiens wird überleben, alle anderen werden aussterben.
Aber zwei Erdteile fehlen noch. In etwas fernerer Zukunft - vermutlich 20 000 bis 15 000 Jahre vor unserer Zeit - werden »moderne« Menschen auch den amerikanischen Doppelkontinent erobern, wahrscheinlich von Sibirien aus. Doch jetzt, vor 45 000 Jahren, ist erst einmal Europa dran.
Hier hat sich inzwischen der Neandertaler einquartiert und mehr als 100 000 Jahre allein auf dem Kontinent existiert. Dank seiner kompakten Anatomie hat er sich immer besser an die Unbilden des Eiszeitalters angepasst und kann selbst Temperaturen von minus dreißig Grad Celsius ertragen. Seine Knochen sind kräftig, die Muskeln gewaltig, der Körperbau ist gedrungen - vermutlich, um möglichst wenig Wärme zu verlieren. Der Neandertaler ist ein Großwildjäger, der sich fast ausschließlich vom Fleisch der erbeuteten Tiere ernährt. Sein Gehirn ist größer als das des Neuankömmlings, aber seine flache Stirn und sein tonnenförmiger Körper haben ihn zum Primitivling gestempelt. Er gilt nicht als Urmensch, sondern eher als Unmensch. Erst in jüngster Zeit sind seine kulturellen, musischen und spirituellen Neigungen entdeckt worden.
Der neue Konkurrent, den er schon früher im Nahen Osten kennengelernt hat und der dann über die rumänischen Karpaten und die Schwäbische Alb nach Mittel- und Südeuropa gezogen ist, bedrängt ihn nun auf Schritt und Tritt. Eigentlich hätte der Neandertaler ein massives Symptom des Verfolgungswahns, eine handfeste Paranoia ausbilden müssen. Dem Homo sapiens wiederum musste es vorkommen wie in dem Märchen von Hase und Igel: Überall, wo er eintrifft, hat sich der Neandertaler bereits etabliert.
Wenig märchenhaft geht die Geschichte weiter. Im Unterschied zu den stagnierenden Alt-Europäern entwickelt Homo sapiens in den folgenden Jahrtausenden immer neue Fähigkeiten und »Begabungen«, stellt schlagkräftige Waffen her, produziert Wandbilder und Schnitzereien. Im Lauf der Zeit drängt er den Neandertaler aus der Evolution, der vor 27 000 Jahren ausstirbt.
An dieser Lesart der Forschung ist wohl nicht mehr zu rütteln, auch wenn einzelne Wissenschaftler die These vertreten, Homo sapiens habe Europa erst erreicht, als der Neandertaler bereits ausgestorben war, weil er sich zu langsam vermehrte und weil extreme Trockenheit seine Rückzugsgebiete zerstörte.
Jener einfältige »grobe Klotz«, auf den er lange Zeit reduziert wurde, war der Neandertaler jedenfalls nicht. Aber er war eben auch kein direkter Vorfahr des modernen Menschen. Dafür liefert seine DNA zu viele Unterschiede, vor allem in jenen kognitiven Bereichen, die das abstrakte und schöpferische Denken, aber auch die soziale Intelligenz und die Realitätskontrolle betreffen. Diese Faktoren waren die genetischen Schubkräfte, die dem Homo sapiens den unkündbaren Spitzenplatz in der Entwicklungsgeschichte des Menschen sicherten. Sie waren, sozusagen, seine evolutionäre Extrawurst.
Und dennoch bekommt das alte (Feind-)Bild des Neandertalers Risse.
Von einem ausschließlichen Verdrängungswettbewerb, auch von einem reinen Nebeneinander zwischen Neandertaler und Homo sapiens kann offenbar nicht mehr die Rede sein. Selbst eine friedlich-konstruktive Koexistenz, die auch den Austausch von Werkzeugen und Know-how einschloss, trifft die Sache noch nicht. Da war mehr. Mehr als ein Flirt. Mehr auch als ein Techtelmechtel. Neandertaler und Sapiens hatten Sex miteinander. Und es gab Nachkommen.
Читать дальше