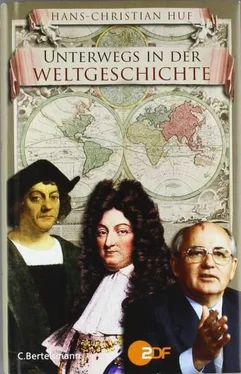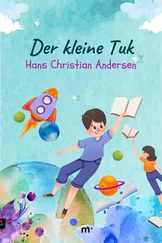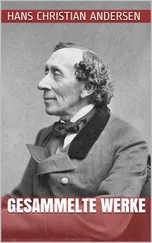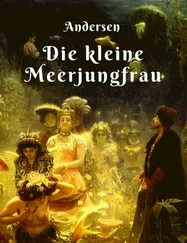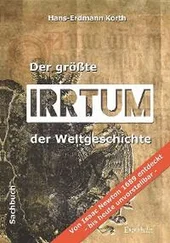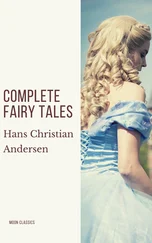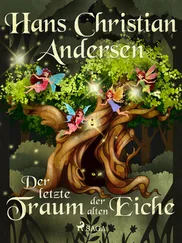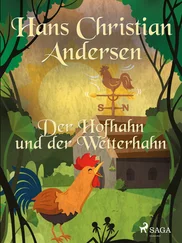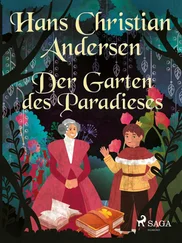Durch das antike Griechenland bis nach Ägypten wanderte Pausanias und schrieb alles auf, was ihm von Bedeutung erschien. Auch die islamische Welt des Mittelalters kannte phänomenale Reisende wie Ibn Jubayr und Ibn Batuta, die wirklich unglaubliche Touren durch ferne Gegenden und Kulturen unternahmen, alle Widrigkeiten und Gefahren überlebten und zu Hause von ihren Erlebnissen berichteten. Stellen Sie sich einmal vor, eine Reise in fremde Länder über viele Jahre zu unternehmen, ohne Reiseführer, Sprachkenntnisse, Reiseleiter, ohne Kreditkarte, Autos, Expeditionsbekleidung, ohne Medikamente oder Ärzte, ohne Landkarten oder Navigationsgeräte, durch Landstriche, in denen wilde Tiere und Räuberbanden den Reisenden erwarten, durch die Staaten verrückter Gewaltherrscher, in denen Krieg und Anarchie herrschen. Können Sie sich nicht vorstellen? Diese Reisenden haben genau das getan.
Mit den Eroberungszügen der Europäer und den verbesserten Verkehrsmitteln zu Wasser und zu Land wurde es dann immer einfacher, die Welt zu umrunden. Der Erste, der das aus rein touristischem Interesse tat, quasi unser aller Urahn im Bereich der Urlaubsreise, war ein heute ziemlich vergessener italienischer Kavalier namens Giovanni Francesco Gemelli Careri. Er startete seine Reise 1693 und brauchte für die Weltumrundung volle fünf Jahre. Nicht ganz 200 Jahre später ging das deutlich schneller. 1872 organisierte der britische Prediger Thomas Cook für eine Touristengruppe die erste kommerzielle Reise um die Welt. Zu sehr stolzem Preis enthielt sie den Dampfschifftransfer über den Atlantik, eine Postkutschenreise quer durch die USA, die Fahrt von der Westküste mit dem Schaufelraddampfer nach Japan und eine anschließende Landpartie durch China und Indien inklusive Rückreise. Thomas Cook und seine Gruppe benötigten dafür genau 222 Tage. Nur ein Jahr später schrieb der französische Abenteuerschriftsteller Jules Verne seinen berühmten Roman »In achtzig Tagen um die Welt«. Klar, woher er seine Inspiration hatte.
Rund um den Globus hatten die staunenden Reisenden Orte gefunden, an denen sich die Geschichte der Weltkulturen ablesen ließ. Was hatten diese Orte zu bedeuten, und wie hing das alles zusammen? Stellen Sie sich einmal vor, wir wären solche Reisende und flögen mit einem Heißluftballon über eine ganz unbekannte Landschaft. Das wäre ein Abenteuer! Nun, wagen wir einmal einen Blick hinunter über den Rand des Ballonkorbes. Hoffentlich sind Sie schwindelfrei. Eine trockene Ebene, darin ein Fluss, der in der Hitze ein bisschen ermüdet daliegt. Der Euphrat. Es ist gewaltig heiß, selbst hier oben im Ballon. In der flirrenden Hitze erkennt man auf einem gewaltigen Areal deutlich Reste von Lehmbauten. Das ist Babylon oder jedenfalls das, was davon heute noch übrig ist. Eigentlich unglaublich, dass ein solcher Mythos wirklich existiert. Aber hier ist der Beweis. Man spricht immer vom »Turmbau zu Babel«, vom »babylonischem Sprachengewirr«. Aber den Ort gibt es, man kann ihn ansehen. In Babylon wurde der erste Gesetzestext festgehalten, jedenfalls der erste, den man bisher gefunden hat. Sie werden lachen, aber letztlich gehen alle unsere Gesetze auf diese ersten Versuche zurück. Ein Grund mehr, sich mit dieser Geschichte konkret zu beschäftigen.
Nur ein Experiment: Stellen Sie sich einmal vor, wir hätten für Sie eine Zeitmaschine gebaut. Sie dürfen den Apparat jetzt ausprobieren. Schnell die Koordinaten von Babylon eingestellt, die Zielanzeige wird auf das Jahr 1680 vor der Zeitenwende fixiert. Gut festhalten, es wird unruhig, immerhin reisen wir fast 3700 Jahre zurück in der Zeit. Ah, das Rütteln hört auf, wir sind offenbar angekommen. Nun die Tür der Zeitkapsel öffnen. Gleißendes Licht, furchtbare Hitze. Und da hinten eine gewaltige Lehmmauer, die sich aus der Ebene erhebt. Sieht aus wie eine Großstadt. Man ahnt die Zinnen vieler Türme. Hinter den Umfassungsmauern scheinen sich noch viel höhere Gebäude zu erheben. Der Weg durch eines der Haupttore, die mit bunt glasierten Ziegeln verkleidet sind, führt hinein in dieses Weltwunder, die Stadt des Gottes Marduk und seiner Könige. Man sieht die Türme der Tempel hoch aufragen, das ist wirklich unvorstellbar.
Noch ein Versuch gefällig? Gut, wir stellen den Apparat auf das alte Ägypten ein. Schon sind wir da. Sehen Sie diese steinernen Spitzen, gewaltige Baukörper, die aus der Wüste ragen? Man sieht Rampen, die hinaufführen, und Heerscharen von Arbeitern, die mit Seilen, Hölzern und Winden Steine über den Abhang nach oben fördern. Das sind die Pyramiden von Giseh, bis heute unbegreifliche Wunder der Ingenieurskunst. Sie bestätigen, dass die Menschen früherer Zeiten nicht dümmer waren, als wir es heute sind. Vielleicht können Sie mit Computern umgehen, aber diese Leute kennen dafür die Gesetze der Mechanik. Die wissen, wie man mit Seilen, Rollen, Schlitten und ein paar Kanthölzern schwerste Lasten bewegt. Die Pyramiden, die wir hier eben im Bau sehen, sind der Versuch, die Unsterblichkeit und unendliche Macht eines einzigen Menschen zu beweisen, des Pharao, des göttlichen Herrschers über ganz Ägypten. Tausende von Jahren besteht das ägyptische Reich mit seiner eigenen Schrift und Sprache, mit seinen Kulten, seiner komplizierten Landwirtschaft, die das Überleben im Niltal sichert. Was sind da schon ein paar Jahrhunderte unserer eigenen Epoche! Babylon und die Pyramiden von Giseh, das sind Monumente der Vergangenheit, die längst selber zu Begriffen geworden sind, zu Mythen unserer Welt. Jeder von uns hat ein Bild vor Augen, wenn man von ihnen spricht.
Das sind die Grundlagen unserer Kultur, in Stein gehauen: die weißen Steine der Akropolis, hoch oben über Athen, die immer noch gigantischen Reste der Bauten des alten Rom. Ohne Athen kein Rom, ohne Rom kein Europa. In Rom zeugen das Kolosseum und der mächtige Vatikan von den beiden Epochen seiner weltumspannenden Macht. Auf dem Tempelberg in Jerusalem, der Juden, Christen und Muslimen heilig ist, sieht man, wie diese scheinbar weit entfernten Religionen zusammengehören, wie sie aus einer gemeinsamen Wurzel stammen. In der Hagia Sophia im heutigen Istanbul, einst Kirche der byzantinischen Welt, dann Moschee, schließlich Gedenkort und Museum, wird die fließende Grenze zwischen dem sichtbar, was wir Orient und Okzident bzw. Westen nennen. In Aachen kann man heute den Kaiserthron bestaunen, auf dem Karl der Große vor 1200 Jahren Platz nahm, jener le-gendenumwobene Kaiser, der allen späteren Herrschern Europas zum Vorbild diente.
Die italienischen Städte Venedig und Florenz erzählen mit ihren Palästen und Museen noch immer von der Erfindung des modernen Kapitalismus in der italienischen Renaissance. Madrid mit den Goldschätzen der spanischen Könige ist der Ort des vollendeten Kolonialismus, Paris mit dem Palast von Versailles das Zentrum einer vollkommenen Königsmacht. Im Gegensatz dazu war Berlin lange eine verschlafene Kleinstadt, aber als die preußischen Könige das ganze Land zur gut gedrillten Kaserne umfunktionierten, da entstanden Fabriken und Vorstädte in der damals modernsten Stadt der Welt. In London fand die weltumspannende Industrialisierung, die Globalisierung des 19. Jahrhunderts, ihren Höhepunkt. Auf den Schlachtfeldern von Verdun endete dann für Jahrzehnte jede Hoffnung auf eine menschliche Gesellschaft. Und New York, das ist das Symbol unserer Zeit, eine Megacity voller Geschwindigkeit und Größe. Das Wahrzeichen der Stadt waren die sogenannten Twin Towers. Dass ebenso naive wie gewissenlose Verschwörer glaubten, sie müssten nur die Türme zu Fall bringen, um auch die von ihnen verabscheute Modernität abzuschaffen, zeigt, wie mächtig diese Symbole sind.
Der Sichtbarmacher Nicht alle Zeugnisse der Vergangenheit sind so leicht erkennbar. Was im sogenannten Neolithikum geschah, in der Jungsteinzeit, das war mindestens so revolutionär wie die Industrialisierung der Welt in unserer Zeit. Vielleicht sogar bedeutender. Nur sind die Zeichen jener Epoche längst verfallen, alle Holzhäuser und Hütten verrottet, die Töpferwaren zu Scherben zermahlen, die Steinwerkzeuge unter der Erdoberfläche verborgen. Und kein Korrespondent, kein Reisender hat seine Erlebnisse aus dieser Zeit für uns aufgeschrieben. Dabei hätten uns die Menschen des Neolithikums viel zu erzählen, denn sie vollzogen den Übergang zum Ackerbau und zur Sesshaftigkeit in festen Siedlungen. Wie sie bearbeiten wir immer noch das Land und leben heute in unserem wohlgeordneten Wohnviertel. Wir sind unseren Vorfahren viel näher, als wir denken. Um diese ferne und doch nahe Vergangenheit aufzudecken, braucht man eine ganz andere Art von Reisenden. Er zieht nicht in die Ferne, sondern gräbt sich ganz geduldig und maulwurfsartig großflächig nach unten in Richtung Erdmittelpunkt. Das ist der Archäologe.
Читать дальше