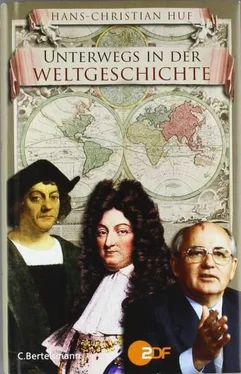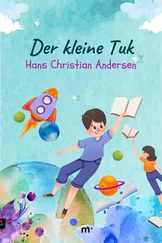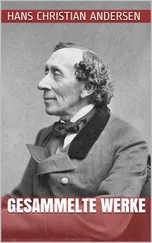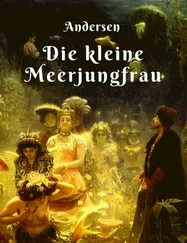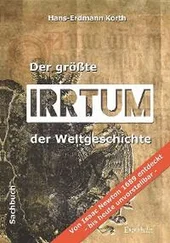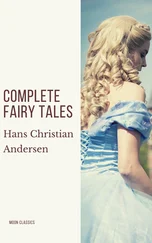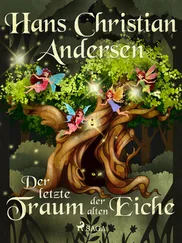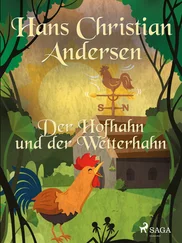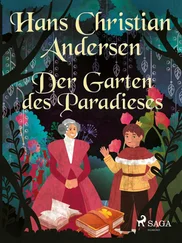Nicht immer waren die Funde das, für das die Leakeys sie hielten, aber stets erwiesen sie sich als signifikante Elementarteilchen im großen Puzzle der Evolution. Und, in der Summe, als unwiderlegbares Votum für Afrika als Wiege der Menschheit, als Kontinent des Ursprungs. Das asiatische Modell, das manche Forscher über Jahrzehnte favorisiert hatten, war damit passé.
Das öffentliche Interesse an solch mühsamer anthropologischer Detektivarbeit hielt sich freilich sehr in Grenzen. Während das Katastrophenszenario, das zur Auslöschung der Dinosaurier führte, künstlerische Fantasien jeglicher Spielart beflügelt und nicht nur in den Kinos, sondern selbst in den Museen zu Besucherrekorden geführt hat, ließen die frühen Spuren der Menschheitsgeschichte das Publikum lange Zeit merkwürdig kalt.
Jenseits verständlicher Begeisterung für das unabweisbar Spektakuläre dieses Untergangs der Giganten, die über Jahrmillionen die Erde beherrscht hatten, mag ein feines Gefühl der Trauer und der Anteilnahme dabei mitgespielt haben. Trauer darüber, wie vergänglich auch das Große und scheinbar Unzerstörbare ist, vermischt mit der Ahnung, dass auch dem Homo sapiens eine Entwicklung bevorsteht, die auf Abschied und Endlichkeit weist.
Vielleicht waren die eigenen Knochen aber auch einfach nur zu mickrig und zu uninteressant.
Auf jeden Fall hat eine einzige Filmszene aus dem Jahr 1968 das alles geändert.
Sie stammt aus Stanley Kubricks Meisterwerk »2001 - Odyssee im Weltraum«: Der Anführer einer Affenhorde - im Drehbuch heißt er Moonwatcher, im Film bleibt er unbenannt - schleudert einen großen ausgebleichten Knochen in die Luft, den er soeben als Waffe benutzt hat. Die Kamera verfolgt seinen Flug bis zum Umkehrpunkt und darüber hinaus. Dann verwandelt sich das primitive Werkzeug in einen technologisch fortgeschrittenen Erdsatelliten.
Die grandiose Ur- und Urzeitszene wurde zu einer der meistzitier-ten Bildmetaphern, einem der berühmtesten Match Cuts der Filmgeschichte. Und sie sorgte für ein neu erwachendes Interesse des Menschen am Menschen.
Davon profitierte vor allem Lucy - verdienterweise, denn sie war und blieb das am besten erhaltene Skelett einer Vormenschenart, das bislang gefunden wurde. Ein amerikanisches Forscherteam um Donald C. Johanson entdeckte die Knochenreste 1974 in der Nähe des Awash-Flusses in Äthiopien und konnte sein Glück kaum fassen: Sie konnten einem einzigen Individuum zugeordnet werden, das mit 23 Prozent Skelettsubstanz eine ungewöhnlich breite Untersuchungsbasis bot.
Der Sensationsfund wurde unter dem Kürzel »A. L. 288« registriert und entpuppte sich als Australopithecus afarensis. Besser und weltweit bekannt aber wurde er als Lucy - eine Reverenz vor dem Beatles-Song »Lucy in the Sky with Diamonds«, den die nimmermüden Anthropologen in den Tagen vor und nach dem Glückstreffer häufig im Radio gehört hatten.
Die sogenannten Australopithecinen (aus lat. australis = südlich und griech. pithekos = Affe), die sich mit der schönen deutschen Übersetzung »Südaffen« schmücken dürfen, gehören zu den frühesten bekannten Vorfahren des Menschen. Vor vier Millionen Jahren hatten sich in den Landschaften Ostafrikas viele unterschiedliche Arten davon herausgebildet, die eines gemeinsam hatten: Sie gingen aufrecht, auf zwei Beinen, wie die Wanderer in der Vulkanasche von Laetoli oder wie Lucy aus der Region Afar in Äthiopien.
Aber hinter der Namensgebung für die mindestens 3,2 Millionen Jahre alte Vormenschendame steckt mehr als eine Laune. Dahinter verbirgt sich der Wunschtraum, den schon die Leakeys und vor und nach ihnen viele andere Anthropologen und Archäologen träumten: Aus den verstreuten Knochen, den Fußspuren oder Artefakten möge ein Mensch, ein Schicksal, ein Leben hervorblicken.
Dieser Wunsch blieb letztlich unerfüllt. Es gab jedoch, wenn Sie so wollen, eine Art »Ersatzmann«, dem die Sympathien der zuständigen Wissenschaften geradezu in den Schoß fielen und der von einer fürsorglichen Öffentlichkeit gleichsam adoptiert wurde. Allerdings trat er erst viel später in Erscheinung: gut drei Millionen Jahre später, wenn man seine Lebenszeit, und gut anderthalb Jahrzehnte später, wenn man das Entdeckungsdatum betrachtet. Machen wir also einen Exkurs, einen Zeitsprung, und schauen ihn uns an.
Sie ahnen es - es ist der Ötzi. Erst jene Gletschermumie aus dem Neolithikum, der späten Jungsteinzeit, die Urlauber am 19. September 1991 in Südtirol im Bereich der Similaungruppe der Ötztaler Alpen in 3210 Metern Höhe fanden, bot einen Ausgleich für so manche Enttäuschung der prähistorischen Knochensammler. Indem sie - sehr spät, sozusagen in der Nachspielzeit - ihrer Hoffnung entsprach, die Evolution möge ein Gesicht, wenigstens einer unserer frühen Vorfahren möge eine konkrete Biografie haben.
Verschleißerscheinungen am Gebiss, an den Gelenken, an der Wirbelsäule, gebrochene und wieder verheilte Rippen, ausgeprägte Wachstumsstörungen, mehrere bedrohliche Erkrankungen, die dem Tod vorausgingen, darunter möglicherweise ein Magengeschwür, Brot und Fleisch als letzte Mahlzeit - durchgecheckt wie ein verunglückter Bergsteiger des 20. Jahrhunderts, wurde der »Similaun-mann« einer von uns.
Und die Steinzeit, die späte Jungsteinzeit, die schon zur Kupferzeit geworden war, verlor ein Stück ihrer kalten, unnahbaren Anonymität.
Den Radiokarbondatierungen folgend, kam der Ötzi um 3300 v. Chr. bei der Überquerung der Alpen ums Leben. Vermutlich hatte er braune (nicht, wie bisher angenommen, blaue) Augen, war 1,60 Meter groß oder vielmehr klein, fünfzig Kilogramm schwer und würde nach heutigen Maßstäben wahrscheinlich Schuhgröße 35 tragen. Er bleibt eine archäologische Sensation, weil er der einzige vollständig erhaltene, auf natürliche Weise konservierte und nicht bestattete Mensch aus vorgeschichtlicher Zeit ist. Und weil außerdem zahlreiche Gebrauchsgegenstände - darunter ein Kupferbeil - erhalten blieben, aus denen sich eine komplette jungsteinzeitliche Ausrüstung rekonstruieren ließ.
Aber zurück nach Afrika.
An eine Ausrüstung war beim Homo rudolfensis, dem ersten Vertreter der Gattung Homo, dem frühesten Menschen der Geschichte, natürlich nicht einmal ansatzweise zu denken. Aber während seine Ahnen einen Teil des Tages noch auf Bäumen zubrachten, ist er bereits stärker an ein Leben in der offenen Steppe Ostafrikas angepasst: Die Stirn ist steiler, die Backenzähne sind kleiner als die der robusten Menschenaffen, Arme und Beine ähneln schon denen späterer Menschen, ermöglichen eine rasche Fortbewegung und die Bewältigung größerer Strecken.
Homo rudolfiensis , benannt nach seinem Fundort am Rudolfsee, dem späteren Turkanasee in Kenia, verfügt über ein beachtliches Gehirn, das auf ein durchschnittliches Volumen von 700 Kubikzentimetern anwächst. Zum Homo qualifiziert ihn außerdem die Tatsache, dass er mit seinen Händen bereits Splitter von Steinen abschlägt, um damit zu schneiden. Erstmals stellt also - vor rund 2,5 Millionen Jahren - ein Erdenbewohner planvoll Steinwerkzeuge her und gibt sein Wissen an nachfolgende Generationen weiter. So kommt der technische Fortschritt in die Welt - eine Traditionslinie, die bis zum Ötzi und zu Stanley Kubricks Erdsatelliten reicht.
Aus den ersten Formen der Gattung Homo, mit noch relativ langen Armen, entsteht nun vor 1,9 Millionen Jahren in Ostafrika Homo ergaster: ein hochgeschossener Savannenläufer, schnell, intelligent und neugierig. Sein Gehirn ist weitaus größer als das seiner Vorgänger, seine Werkzeuge werden raffinierter. Getrieben von einer unbändigen Neugier macht er sich schließlich auf, die Welt zu erkunden.
Der Mensch ist noch lange nicht fertig, aber reisefertig.
Читать дальше