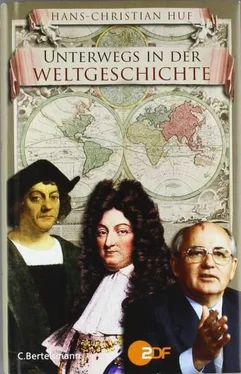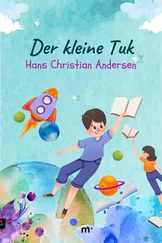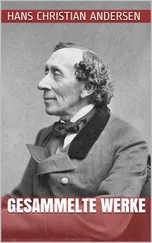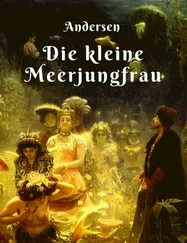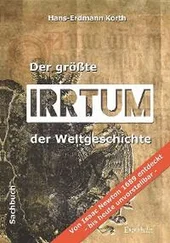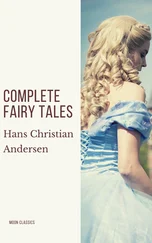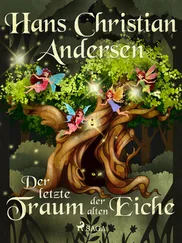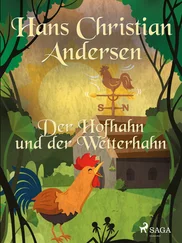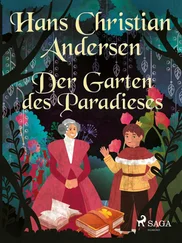Die unbestritten berühmtesten Totentempel sind die drei majestätischen Pyramiden von Giseh am Rand der Libyschen Wüste, erbaut von König Cheops, seinem Sohn Chephren und seinem Enkel Mykerinos. Prunkstück der monumentalen Trias ist das Grabmal des Cheops, dessen Regierungszeit - wie die seiner beiden Nachfolger - in die vierte Dynastie fällt und etwa von 2580 bis 2555 v. Chr. dauerte.
Die Cheops-Pyramide als größte je gebaute Pyramide gilt als das Symbol des Pharaonenreichs schlechthin. Um sie herum wurden vier Schiffe deponiert, von denen eines nach der Ausgrabung vollständig rekonstruiert werden konnte. Ihr Holz kam aus dem Libanon. Ihr Auftrag war es, dem toten König die Fahrt durch die Himmelsgewässer zu ermöglichen. Es darf vermutet werden, dass auch die Planung für den sogenannten Sphinxtempel in Giseh und für den geheimnisumwitterten Sphinx selbst, der aus einem Felskern der für den Pyramidenbau benutzten Steinbrüche modelliert wurde, noch auf König Cheops zurückgeht.
Der Friedhof um das Weltwunder von Giseh spiegelt den straff organisierten Beamtenstaat, seine Ausrichtung auf den König und auf das jenseitige Reich der Götter. Dieser Götterhimmel, das Pantheon der Ägypter, präsentierte sich schon früh als bunt und reichhaltig. Zuerst traten die göttlichen Mächte in Gestalt von Tieren und Fetischen auf, bevor sie ab etwa 3000 v. Chr. menschliche Züge annahmen, wobei zahlreiche Attribute aus der Tierwelt auch weiterhin verwendet wurden, so der falkenköpfige Horus oder der widderköpfige Amun. Rund 1500 Götter lassen sich heute unterscheiden.
Immer wieder hatten Perioden der Ordnungs- und Rechtlosigkeit, der inneren Machtkämpfe und der Auseinandersetzung mit ausländischen Invasoren das ägyptische Reich vor historische Herausforderungen gestellt. Epochen des Niedergangs, des Zerfalls und der Auflösung, als »Zwischenzeiten« bezeichnet, wechselten mit den Glanzzeiten des Alten (2850 - 2150 v. Chr.), des Mittleren (2050 -1650) und des Neuen Reiches (1570 -1085).
Eine der größten Bedrohungen für den Pharaonenstaat waren Invasoren von Nordosten gewesen, die dank einer neuen, von Indogermanen übernommenen Waffe tief nach Ägypten eindrangen und dem Reich eine bis 1570 v. Chr. dauernde Fremdherrschaft aufzwangen. Es waren die ersten Streitwagen der Militärgeschichte - eine primitive Plattform mit Rädern, auf der zwei bewaffnete Soldaten Platz finden konnten -, die Panik bei den ägyptischen Verteidigern auslösten. Einer der beiden Angreifer lenkte das Pferd, der andere war mit Pfeil und Bogen oder einem Speer ausgerüstet. Mühelos überrannten sie die Soldaten des Pharao, die der neuen Kampftechnik nichts Entscheidendes entgegensetzen konnten. Nur flussaufwärts in Theben konnten die Ägypter ihre Herrschaft bewahren und selber den Umgang mit der neuen Waffe lernen, um allmählich die Hyksos (ägypt. = Fürsten der Fremdländer) wieder aus dem Land zu vertreiben.
Kraftvolle, eigenwillige Persönlichkeiten kennzeichnen insbesondere die 18. Dynastie. Königin Hatschepsut, die ab 1490 v. Chr. als erste Frau den Pharaonenstaat regierte, verstand sich vor allem als Friedensstifterin. Sie sorgte aber für die Aufrüstung des stehenden Heeres und führte einige Feldzüge nach Vorderasien und Nubien. Ihr lang gestreckter, terrassenförmiger Totentempel mit Säulenhallen und Altären im Deir el-Bahari, einem Talkessel von ThebenWest (heute Luxor), gehört zu den eigenwilligsten Bauwerken der ägyptischen Architektur.
Dagegen wurde ihr Stiefsohn Thutmosis III. (1490 -1436 v. Chr.) zum großen Kriegshelden des Neuen Reiches. In 17 Feldzügen eroberte er Teile Vorderasiens und stieß bis zum Oberlauf des Euphrat vor. An der strategisch wichtigen Handelsstraße zwischen Ägypten und Mesopotamien schlug Thutmosis III. um 1460 v. Chr. einen Aufstand kanaanäischer Fürsten und phönizischer Stadtstaaten nieder. Dem endgültigen Sieg ging eine monatelange Belagerung der Festung Megiddo im heutigen Israel, vielleicht gleichbedeutend mit dem biblischen Armageddon (Offenbarung 16, 16), voraus.
Im Süden erweiterten die Pharaonen ihre Herrschaft bis zum vierten Katarakt. Ägypten war auf dem Zenit seiner Macht, stand an der Spitze der Völker der damaligen Welt, empfing die Goldlieferungen Nubiens, die Luxusgüter aus dem Weihrauchland Punt, die Tribute des Vorderen Orients, die Gunstbezeigungen des babylonischen Königshofes. Die ägyptische Sonne erreichte den Höhepunkt ihrer Strahlkraft.
Und der Sphinx meldete sich zu Wort. Sie erinnern sich. Er war dankbar, dass er vom Sand befreit wurde. Und er erlebte eine Revolution.
Schon unter Cheops und seinen Nachfolgern war die Sonne mehr und mehr zum Leitgestirn des Götterhimmels geworden. Der Sonnengott Re beherrscht die Szene, wird identisch mit dem Pharao, dessen Nachkommen sich als Söhne des Re fühlen dürfen. Unter dem Titel Aton (ägypt. = Sonnenscheibe) ruft ihn schließlich Amenophis IV. (1364 -1347 v. Chr.), Gatte der Nofretete, zur alleinigen Gottheit aus und begründet damit den ersten monotheistischen Ansatz der Religionsgeschichte. Er lässt die Tempel der anderen Götter schließen, um den radikalen Bruch mit der Vergangenheit deutlich zu machen.
Aber die neue - eher spirituelle, einzig auf das Sonnensymbol gestützte - Religion findet wenig Anklang. Möglicherweise weil sie zu wenig konkret, zu wenig anschaulich ist. Nach dem Tod dieses revolutionären Pharaos, der seinen ursprünglichen, dem von ihm verachteten Reichsgott Amun nachgebildeten Namen abgelegt hatte und sich Echnaton (»Diener Atons«) nannte, kehrt man schnell zur Göttervielfalt zurück. Auch die von Echnaton degradierte Hauptstadt Theben, die er durch seine Neugründung Amarna (Tell el-Amarna) ersetzte, gewinnt wieder an Bedeutung. Neue Residenz wird nun aber das nordägyptische Memphis.
Dafür sorgt Echnatons Sohn, der 1347 v. Chr. als Neunjähriger den Pharaonenthron besteigt und in einer programmatischen Geste seinen Namen von Tutanchaton in Tutanchamun ändert, um den alten Gott wieder zu installieren. Obwohl er nur 18 Jahre alt wurde, zählt er zu den berühmtesten Pharaonen, seit Howard Carter am 4. November 1922 seine goldgeschmückte Grabkammer entdeckte.
Mit Echnatons Tod waren auch die denkmalstürzenden Impulse erloschen, mit denen er nicht nur die Religion, sondern das gesamte geistige Leben seiner Zeit verändern wollte. Sein Name wurde aus den Königslisten gestrichen, seine Inschriften getilgt, seine Bauten abgerissen. In den Ruinen der mittelägyptischen Stadt Amarna, wo Amenophis IV. seine dem Gott Aton geweihte Residenz errichtet hatte, fanden Ausgräber 1912 eines der berühmtesten Zeugnisse der ägyptischen Kunst: die um 1340 v. Chr. aus bemaltem Kalkstein und Gips gefertigte Modellbüste der Nofretete (ägypt. = die Schöne ist gekommen) mit ihrem charakteristischen hohen Kopfschmuck, nach ihrem Aufenthaltsort »Berliner Nofretete« genannt und in unzähligen Kopien verbreitet, welche sie zur bekanntesten Herrscherin Ägyptens machten.
Der Sphinx von Giseh sah sein Land nun durch ein anderes Volk bedroht, das den Sphingen in seiner Baukunst und seiner Mythologie großen Raum gewährte. Es waren die Hethiter, die im zweiten Jahrtausend v. Chr. im Osten Kleinasiens ihr Reich Hatti mit der Hauptstadt Hattusa gegründet hatten.
Ihre Heerführer waren bereits über den Taurus nach Nordsyrien gezogen, hatten dort Aleppo, eine der ältesten und bedeutendsten Städte des Orients, erobert und einen Kriegszug in das südliche Mesopotamien unternommen. Die dritte Großmacht ihrer Zeit neben Ägypten und Babylon richtete den Blick nun zur Mittagssonne und bedrohte das Land am Nil, das seinerseits im vierten Jahr der Regierung von Ramses II. einen Vorstoß nach Vorderasien unternommen und somit den hethitischen Gegenschlag provoziert hatte.
Die entscheidende Schlacht in der Nähe der für den Nord-SüdHandel wichtigen Stadt Kadesch am oberen Orontes, die im Jahr 1275 v. Chr. stattfand, hat Ramses II. auf vielfache Weise dokumentieren lassen, nicht nur auf amtlichen Papyri, sondern auch für alle sichtbar auf großformatigen Tempelwänden. Muwatalli, der Hethiterkönig, hatte ein beeindruckendes Heer aus eigenen Truppen und Hilfsverbänden aufmarschieren lassen, darunter 2500 Streitwagen und 37 000 Fußsoldaten.
Читать дальше