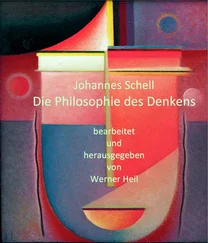„Doch, alle. Freie Plätze gibt es kaum. Da nimmt eben jeder vom andern, der eine Verse, der andere einen Roman. Und diesmal hat es dich getroffen. Führ den Prozeß, rate ich dir.
Vielleicht kommt etwas dabei heraus. Noch besser wär’ es freilich, du kaufst dir einen Motorroller. Weißt du, wenn man motorisiert ist, macht sich das immer bezahlt. Ich habe schon für ungefähr zweihundert Rubel Himbeeren, Johannisbeeren und ähnlichen Kram transportiert.“
„Hast du das verkauft oder wie?“
„Ach wo! Wäre doch viel zuviel Plackerei! Wenn mich die Kollegen auf dem Markt stehen sähen, würden sie mich auslachen. Ich mache alles gern in der Stille, ohne Aufsehen. Meine Frau weckt ein für den Winter. Wir haben uns mit dem Bruder zusammengetan; er gibt den Zucker, ich die Beeren. Ein Fahrzeug ist eben eine feine Sache. Im Winter kannst du’s auf Kredit nehmen, im Sommer macht es sich bezahlt. Bringt was ein.“
„Benjamin, ich glaube, dir will jemand deinen Roller entführen. Hör mal, man fährt ihn weg!“
Kondratjuk lauschte, wandte den Hals, war wie der Blitz zur Tür hinaus und hatte vollkommen vergessen, seinen Rubel zu wechseln.
„Wolodja, möchtest du essen?“ fragte Anja.
„Einen Wolfshunger hab’ ich“, antwortete Tschesnokow.
„Als ob ich hundert Jahre nichts gegessen hätte.“
Er lachte unbändig.
Anja betrachtete ihn mißtrauisch und stimmte dann ebenfalls in das Lachen ein.
„Dann setz dich.“
Sie hantierte mit den Tellern. Es klingelte wieder. Abermals Kondratjuk.
„Alles in Ordnung“, sagte er und lächelte selbstzufrieden,
„mit mir kann man das nicht machen. Weißt du, was ich für Schlösser dran habe?“
Doch plötzlich zuckte er mit den Schultern und fragte ungläubig: „Und bei euch ist inzwischen Hochzeit oder Geburtstagsfeier? Warum seid ihr so lustig?“
„Ich will essen, Benjamin“, sagte Tschesnokow. „Verstehst du, ich bin vor Hunger ganz ungeduldig.“
„Ach, so ist das“, meinte Kondratjuk mißtrauisch. „Dann ist alles klar. Und wie ist das mit meinem Rubel?“
Kondratjuk verließ sie zufrieden. Der Rubel war gewechselt, der Motorroller unversehrt. Was wollte man noch mehr?
„Wolodja“, sagte Anja, als sie sich schlafen legten, „ich weiß genau, daß du noch viel schreiben wirst.“
„Ja, sehr viel“, entgegnete er.
Trotz alledem war Tschesnokow nach diesem Vorfall in ein seelisches Tief geraten. Immerhin war das alles recht unangenehm. Es machte ihm nicht allzuviel aus, daß sein Gedichtband in Kürze unter anderem Namen erscheinen würde, und erst recht berührte es ihn nicht, daß dieser andere an seiner Stelle auch das Honorar dafür einsteckte. Es ging einzig und allein darum, daß Serjegin außerstande war, solche Verse zu schreiben. Tschesnokow hatte das im Gefühl. Es war doch etwas völlig anderes, Gedichte zu schreiben, damit die Augen der geliebten Frau in freudigem Staunen erglänzten, oder nur das Ziel zu kennen, sich einen Namen zu machen.
Ein Zufall? Selbstverständlich. Serjegin hatte sie ja nicht gestohlen! Doch weshalb war es gerade er? Tschesnokow wäre es leichter ums Herz gewesen, wenn es sich um jemand anderen gehandelt hätte; vielleicht Pionow oder der Redakteur der Zeitung. Dieser schrieb allerdings gar keine Verse.
Tschesnokow machte sich mit Arbeit im Haushalt zu schaffen. Die Wohnung mußte instand gesetzt und renoviert werden.
Er arbeitete mit einem gewissen Ingrimm: Beim Abklopfen der Stukkatur von der Zimmerdecke verursachte er viel Lärm und nahm sich mit Geräuschen nicht in acht, aus dem knarrenden Fußboden riß er die Nägel gleich mit Stücken der Dielenbretter heraus. Abend für Abend trank er an die drei Liter Kwaß und trällerte aus vollem Halse Arien aus volkstümlichen Operetten.
„Wowka“, meinte Anja, „denk doch dran, daß du gar nicht so bist, wie du dich im Moment gibst. Wozu dieses Theater?“
„Ich bin so, aber auch ganz anders“, entgegnete Tschesnokow gedehnt in Form eines Rezitativs. „Ich bin jedermann.“
„Das stimmt nicht. Du bist innerlich verärgert. Warum? Auf wen bist du böse?“
Tschesnokow antwortete nicht und schlug mit einem einzigen Hieb einen Nagel bis zur Kuppe in ein Brett.
Einmal sang er entsetzlich falsch: „Bist du gesund, o Fürst?
Was grübelst du?“
Anja kam mit Tränen in den Augen ins Zimmer gelaufen und schrie: „Du hast Angst! Hast aufgesteckt! Du glaubst nicht an einen Zufall. Du denkst, er hat dir die Verse gestohlen! Deshalb grollst du so umher!“
„Nein, das denke ich nicht. Aber natürlich ist mir unbehaglich zumute; peinlich, das alles! Bald werde ich darüber hinweg sein, und alles ist vergessen. Willst du ein paar neue Verse? Frisch aus dem Ofen? Möchtest du?“
„O ja doch“, sagte Anja und trocknete ihre Augen mit schmutzigen Fingern.
Es waren acht Zeilen, roh gehauen aus hartem Stein.
Anja war klar, daß Wowka alles überwunden hatte und wieder auflebte.
Zwei Wochen später begegnete er diesen seinen Versen in der „Literatur-Zeitung“. Ein Dichter, den Tschesnokow nicht kannte, hatte sie mit seinem Namen versehen.
Tschesnokow konnte darüber nicht einmal staunen, er verzichtete darauf, den Gekränkten, vom Schicksal Schwergeprüften zu spielen. Er hörte nur auf, seine Gedichte niederzuschreiben, gab sich keine Mühe, sie sich einzuprägen, sondern improvisierte lediglich an langen Winterabenden vor seiner einzigen Zuhörerin, vor Annetschka. Er war kein großer Vortragskünstler. Auf einem Podium hätte ihm wahrscheinlich überhaupt niemand zugehört. Und trotzdem… Man mußte ihm nur vertrauen, verstehen, daß die Welt, die in seinen Versen lebte, real war, trotz all ihrer Phantastik.
Annetschka glaubte ihm und verstand ihn.
Wäre Kondratjuk bei diesen abendlichen Rezitationen anwesend gewesen, hätte er sicherlich gestaunt und gesagt: „Aus dir sprudelt es ja förmlich, Tschesnokow! Direkt in Versen sprudelt es! Schreib es auf, und mach es zu Geld! Einen Motorroller solltest du kau…“
Doch Kondratjuk hörte sich niemals Tschesnokows Gedichte an, das zahlte sich nicht aus, hatte also keinen Sinn. Überdies wären in seiner Gegenwart Tschesnokows Gedichte wie ein Häufchen schutzloser, scheuer, unbeholfener, lächerlicher Wörter gepurzelt gekommen.
Annetschka schrieb insgeheim die Zeilen nieder, die sie sich gemerkt hatte, und sie besaß ein ausgezeichnetes Gedächtnis.
Das kleine Verspaket wurde von Monat zu Monat umfangreicher. Tschesnokow wußte, daß seine Frau versuchte, seine Werke „für die Nachwelt“ zu erhalten, und er dachte nicht daran, es ihr zu verbieten. Niemals bat er sie darum, etwas daraus vorzulesen. Wozu sollte man die Manuskripte lesen?
Alle seine Gedichte konnte er in Zeitungen, Zeitschriften und in Sammelbänden antreffen. Allerdings nur mit fremden, verschiedenen Familiennamen. Doch was bedeutet das schon!
Pionow hatte schon etliche Male bei Tschesnokow im Betrieb angerufen und ihn gebeten, etwas Neues vorbeizubringen.
Aber Tschesnokow hatte immer unter verschiedenen Vorwänden abgelehnt. Beim ersten Mal hatte er gesagt, er habe das Schreiben eingestellt, doch Pionow schenkte ihm keinen Glauben. „Das hängt jetzt nicht mehr von dir ab, ob du weiterschreibst. Die Verse werden wie von selbst in deinem Kopf entstehen, dagegen kannst du überhaupt nichts tun.“
Beim nächsten Anruf hatte Tschesnokow entgegnet, er habe nichts Besonderes. Wieder etwas später: Er habe keine Zeit.
Das war die Wahrheit, denn die Gruppe, in der Tschesnokow arbeitete, war gerade dabei, ein bestimmtes Thema abzuschließen.
Zuletzt hatte Tschesnokow nur einen einzigen Satz gesagt:
„Die ganze Geschichte würde sich nur aufs neue wiederholen.“ Dann hatte er den Hörer aufgelegt.
Читать дальше