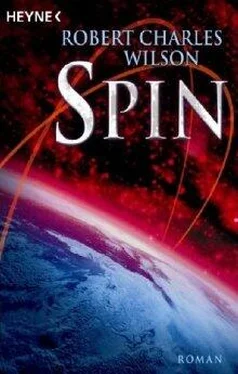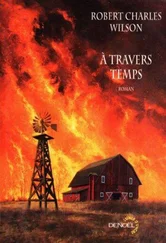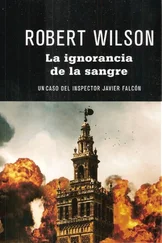Als Simon mir die Flasche reichte, neigte ich mich zu ihm und sagte: »Ich kann Diane nur helfen, wenn ich hier rauskomme. Verstehst du? Und das schaffe ich nicht ohne deine Hilfe. Wir brauchen einen Wagen mit vollem Tank, und Diane muss drinsitzen, am besten noch bevor Condon merkt, dass das Kalb tot ist.«
Simon stockte der Atem. »Ist es wirklich tot?«
»Es atmet nicht, und die Färse hält sich kaum noch am Leben.«
»Aber ist das Kalb rot? Ganz und gar rot? Ohne weiße oder schwarze Flecken?«
»Selbst wenn es ein beschissenes Feuerwehrauto wäre, Simon, würde es Diane nicht das Geringste nützen.«
Er sah mich an, als hätte ich ihm gerade mitgeteilt, sein kleiner Hund sei überfahren worden. Ich fragte mich, wann er seine überschäumende Selbstsicherheit gegen diese hilflose Verwirrung eingetauscht hatte, ob es plötzlich geschehen oder ob sie Stück für Stück aus ihm herausgerieselt war, wie Sand durch ein Stundenglas.
»Sprich mit ihr. Frag sie, ob sie bereit ist, hier wegzugehen.« Falls sie noch in der Lage war, zu sprechen. Falls sie sich daran erinnerte, dass ich mit ihr gesprochen hatte.
»Ich liebe sie mehr als das Leben selbst«, murmelte Simon.
In diesem Moment rief Condon: »Wir brauchen dich wieder hier!«
Ich trank die halbe Flasche leer. Das Wasser war sauber und rein und köstlich. Simon starrte mich an, während ihm Tränen in die Augen stiegen.
Dann ging ich zurück zu Sorley und den Geburtshilfeketten, und wir zogen und zerrten im Einklang mit den Zuckungen der schwangeren Färse.
Endlich, gegen Mitternacht, hatten wir das Kalb herausgezogen, es lag auf dem Stroh, ein Knäuel von schlaffen Gliedmaßen, die blutunterlaufenen Augen leblos.
Condon stand eine Weile über dem kleinen Körper. Dann wandte er sich mir zu: »Gibt es irgendetwas, das Sie tun können?«
»Ich kann es nicht von den Toten erwecken, falls Sie das meinen.«
Sorley sah mich warnend an, als wollte er sagen: Quäl ihn nicht, es ist schon schlimm genug.
Langsam bewegte ich mich in Richtung Scheunentür. Simon war vor etwa einer Stunde verschwunden, als wir noch mit starken Blutungen kämpften, die sich über das Stroh und unsere Kleidung, unsere Arme und Hände ergossen. Durch den offenen Spalt der Tür konnte ich beim Auto — meinem Auto — Bewegungen ausmachen und ein Aufblitzen von kariertem Stoff, möglicherweise Simons Hemd. Er war da draußen mit irgendwas beschäftigt.
Sorley sah von dem toten Kalb zu Pastor Dan Condon und wieder zurück, strich sich den Bart, ohne zu merken, dass er Blut hineinrieb. »Vielleicht, wenn wir es verbrennen«, sagte er.
Condon richtete einen welken, hoffnungslos starrenden Blick auf ihn.
Plötzlich riss Simon die Scheunentüren auf und ließ einen Schwall kühler Luft herein. Wir drehten uns um. Der Mond über seinen Schultern war aufgedunsen, fremd. »Sie ist im Auto«, sagte er. »Wir können fahren.« Er sprach zu mir, sah aber unverwandt in Richtung Sorley und Condon.
Pastor Dan zuckte nur mit den Achseln — als seien derlei weltliche Dinge nicht länger relevant.
Ich sah Bruder Aaron an. Bruder Aarons Hand streckte sich nach dem Gewehr.
»Ich kann Sie nicht hindern«, sagte ich. »Aber ich gehe jetzt.«
Er hielt inne, ließ die Hand in der Luft hängen, runzelte die Stirn. Es war, als versuchte er die Abfolge von Vorgängen zu rekonstruieren, die zu dem gegenwärtigen Augenblick geführt hatten, einer aus dem anderen notwendig hervorgehend, mit unerbittlicher Logik, und doch, und doch… Seine Hand fiel schlaff hinunter. Er wandte sich Pastor Dan zu. »Ich glaube, wenn wir es trotzdem verbrennen, dann wäre das in Ordnung.«
Ich ging zur Scheunentür, blickte mich nicht um. Sorley hätte es sich anders überlegen, zum Gewehr greifen können, aber ich war nicht mehr imstande, mich dafür zu interessieren.
»Vielleicht noch verbrennen, bevor es Morgen wird«, hörte ich ihn sagen. »Bevor die Sonne wieder aufgeht.«
»Fahr du«, sagte Simon, als wir das Auto erreichten. »Es ist Benzin im Tank und ein paar Extrakanister im Kofferraum. Außerdem etwas zu essen und noch mehr Wasserflaschen. Du fährst, und ich sitz hinten, um sie zu stützen.«
Ich ließ den Wagen an und fuhr langsam den Hügel hoch, an dem Weidezaun und der mondbeschienenen Ocotilla vorbei in Richtung Highway.
Nach einigen Kilometern, in sicherer Entfernung zur Condon-Ranch, fuhr ich an den Straßenrand und sagte zu Simon, er solle aussteigen.
»Was? Hier?«
»Ich muss Diane untersuchen. Und dafür brauche ich die Taschenlampe aus dem Kofferraum. Okay?«
Er nickte mit weit aufgerissenen Augen.
Diane hatte kein Wort gesagt, seit wir die Ranch verlassen hatten. Sie hatte einfach nur auf dem Rücksitz gelegen, den Kopf in Simons Schoß, und versucht, Luft zu bekommen. Ihr Atem war das lauteste Geräusch, das im Auto zu hören war.
Während Simon mit der Taschenlampe in der Hand wartete, entledigte ich mich meiner blutgetränkten Sachen und wusch mich so gründlich, wie ich konnte — eine Flasche Mineralwasser mit ein bisschen Benzin vermischt, um den gröbsten Dreck abzuschrubben, eine weitere Flasche zum Nachspülen. Dann zog ich eine frische Jeans und ein Sweatshirt aus meinem Gepäck an und streifte ein paar Latexhandschuhe aus dem Arztkoffer über. Eine dritte Flasche Wasser trank ich in einem Zug leer, und dann ließ ich Simon das Licht auf Diane richten, während ich sie mir ansah.
Sie war mehr oder weniger bei Bewusstsein, aber zu erschöpft, um einen zusammenhängenden Satz herauszubringen. Sie war dünner, als ich sie je gesehen hatte, fast wie eine Magersüchtige, und sie hatte gefährlich hohes Fieber. Blutdruck und Puls waren ebenfalls erhöht. Als ich ihr die Lunge abhörte, klang es, als würde ein Kind seinen Milkshake durch einen dünnen Strohhalm saugen. Es gelang mir, ihr ein bisschen Wasser und dazu ein Aspirin einzuflößen. Dann riss ich die Versiegelung einer sterilen Subkutannadel auf.
»Was ist das?«, fragte Simon.
»Ein Universalantibiotikum.« Ich tupfte Dianas Arm ab und spürte mit etwas Mühe eine Vene auf. »Du wirst auch eins brauchen.« Genau wie ich — das Blut der Färse war zweifellos mit aktiven KVES-Bakterien verseucht gewesen.
»Wird sie das von der Krankheit heilen?«
»Nein, ich fürchte nicht. Vor einem Monat vielleicht. Jetzt nicht mehr. Sie braucht ärztliche Behandlung.«
»Du bist doch Arzt.«
»Ich bin Arzt, aber ich bin kein Krankenhaus.«
»Dann können wir sie vielleicht nach Phoenix bringen.«
Ich dachte darüber nach. Alle während des Flackerns gemachten Erfahrungen sprachen dafür, dass städtische Krankenhäuser im besten Fall überlaufen waren, im schlechtesten in Schutt und Asche lagen. Ich zückte mein Handy und suchte im Adressverzeichnis nach einer halb vergessenen Nummer.
»Wen rufst du an?«
»Jemand, den ich von früher kenne.«
Er hieß Colin Hinz. Wir waren Zimmergenossen in Stony Brook gewesen und hatten den Kontakt nie ganz abreißen lassen. Als ich zuletzt von ihm gehört hatte, war er in der Leitung des St.-Joseph-Hospitals in Phoenix beschäftigt gewesen. Es war einen Versuch wert — jetzt sofort, bevor die Sonne wieder aufging und jede Telekommunikation für einen weiteren Tag lahm legte.
Das Telefon klingelte lange, doch schließlich nahm er ab. »Wollen schwer hoffen, dass es was Wichtiges ist«, murmelte er.
Ich entschuldigte mich und erklärte ihm, ich sei etwa eine Stunde von der Stadt entfernt und hätte eine Kranke bei mir, die dringender Behandlung bedürfe — jemand, der mir sehr nahe stehe.
Colin seufzte. »Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, Tyler. St. Joe ist in Betrieb und, wie ich gehört habe, ist auch die Mayo Clinic in Scottsdale offen, aber beide haben ganz wenig Personal. Es gibt widersprüchliche Berichte von anderen Krankenhäusern. Eine schnelle Behandlung kriegst du jedenfalls nirgendwo, und hier schon mal gar nicht. Bei uns stapeln sich die Leute: Schusswunden, Suizidversuche, Autounfälle, Herzinfarkte, die ganze Palette. Und Cops an der Tür, die verhindern, dass sie die Notaufnahme stürmen. Wie ist der Zustand deiner Patientin?«
Читать дальше