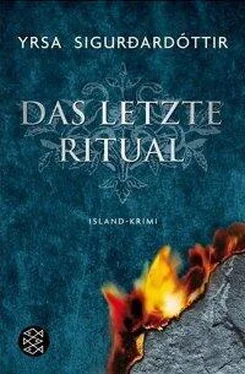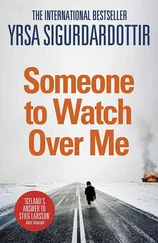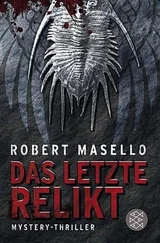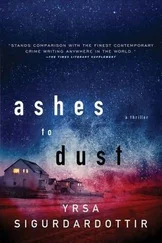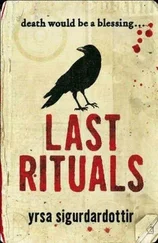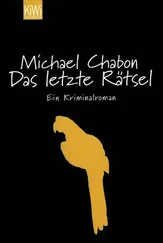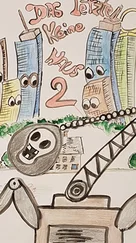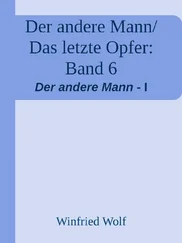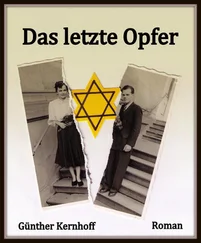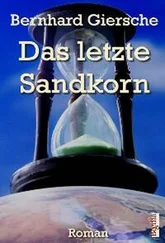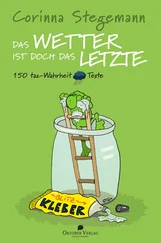»Um was für ein Dokument handelt es sich?«, fragte Dóra. »Hier findet sich so einiges.«
»Es ist ein alter Brief an den Bischof von Roskilde von etwa 1500. Er wurde in Dänemark ausgeliehen und es ist sehr wichtig, dass er nicht verschwindet.«
»Das klingt ziemlich ernst«, stellte Dóra fest. »Warum hast du dein Anliegen nicht der Polizei mitgeteilt? Sie hätte den Brief bestimmt gefunden.«
»Es hat sich gerade erst herausgestellt — ich hatte noch keine Ahnung davon, als ich verhört wurde; sonst hätte ich sie darum gebeten, mir das Dokument auszuhändigen. Die Polizei wollte ich mit der Sache nicht belästigen und hatte gehofft, das Problem auf einfacherem Wege lösen zu können. Ich habe wirklich keine große Lust, schon wieder eine Aussage zu machen. Das ist eine Lebenserfahrung, von der ich erst mal genug habe. Dieses Dokument steht überhaupt nicht mit dem Mord in Verbindung, das kann ich versichern.«
»Vielleicht nicht«, sagte Dóra. »Ich bin leider bisher nicht darauf gestoßen. Wir haben allerdings noch nicht alle Unterlagen von Harald durchgeschaut. Gut möglich, dass der Brief auftaucht.«
Matthias kam mit irgendwelchen Papieren in der Hand ins Zimmer geeilt und setzte sich auf das schicke Sofa. Er bat Dóra und Gunnar mit einer Handbewegung zu sich. Dóra machte es sich im Sessel bequem, während Gunnar auf dem Sofa gegenüber von Matthias Platz nahm. Dóra erläuterte Matthias Gunnars Anliegen. Dieser ging nicht näher darauf ein, sondern fragte nur: »Sie haben Haralds Forschungen betreut oder habe ich das falsch verstanden?«
»Nein und ja, kann man sagen«, antwortete Gunnar bedächtig.
»So?«, sagte Matthias brüsk. »Wird bei der Abschlussarbeit nicht festgelegt, wer sich um welche Studenten kümmert?«
»Doch, doch. Natürlich«, beeilte sich Gunnar zu sagen. »Harald war nur noch nicht so weit vorangekommen, dass er einen Fakultätsbevollmächtigten gebraucht hätte. Das meinte ich damit. þórbjörn Ólafsson hat Haralds Arbeit betreut. Ich habe die Sache nur oberflächlich verfolgt, wenn man so sagen darf.«
»Verstehe. Er hatte aber vermutlich bereits einen Entwurf oder ein Konzept für das Thema eingereicht, oder?«
»Ja. Er hatte ein Exposé abgegeben — wenn mich nicht alles täuscht, war das zu Beginn seines ersten Semesters an unserer Fakultät. Wir haben das Thema begutachtet und es im Großen und Ganzen anerkannt. Das Thema fiel in þórbjörns Gebiet.«
»Worum ging es in der Arbeit?«, fragte Dóra.
»Um einen Vergleich der Hexenverbrennungen in Island und im übrigen Europa, vor allem in den Gebieten, die zum heutigen Deutschland gehören. Dort gab es die heftigsten Auseinandersetzungen, wenn ich so sagen darf. Harald hatte schon vorher verwandte Themenbereiche behandelt — im Zusammenhang mit seiner Magisterarbeit in Geschichte an der Universität München.«
Matthias nickte nachdenklich. »Habe ich das richtig verstanden, dass Hexenverbrennungen in Island erst im 17. Jahrhundert stattfanden?«
»Ja. Quellen berichten auch von Leuten, die schon vor dieser Zeit der Hexerei bezichtigt wurden, aber die eigentliche Hexenverfolgung begann erst im 17. Jahrhundert. Die erste Verbrennung, von der wir wissen, fand im Jahr 1625 statt.«
»Ja, das dachte ich mir«, sagte Matthias und wirkte irritiert. Er breitete die Papiere auf dem Tisch aus. »Es gibt merkwürdigerweise nur sehr wenig über isländische Hexenverbrennungen in Haralds Unterlagen und ich verstehe nicht, warum er sich so stark für Ereignisse interessierte, die viel früher stattfanden. Möglicherweise können Sie mich aufklären und einen historischen Zusammenhang herstellen, der uns verborgen ist.«
»Welche Ereignisse meinen Sie?«, fragte Gunnar und beugte sich über die Papiere, die aus ausgedruckten und kopierten Aufsätzen bestanden.
Während Gunnar die Aufsätze beäugte, zählte Matthias auf: »Ausbruch der Hekla im Jahr 1510, Epidemie in Dänemark um die Jahrhundertwende 1500, Reformation im Jahr 1550, Höhlen der Papar seit der Besiedelung des Landes und so weiter. Ich für meinen Teil sehe keinen direkten Zusammenhang, aber ich bin ja auch kein Historiker.«
Gunnar blätterte weiter in den Papieren. Schließlich ergriff er das Wort. »Dies steht wirklich nicht alles in direktem Zusammenhang mit Haralds Arbeit. Er könnte sich diese Aufsätze auch für andere Seminare beschafft haben, an denen er teilnahm. Die Landnahme ist mein Fachgebiet und ich muss gestehen, dass Harald mein Seminar nicht besucht hat, was eine Erklärung für diesen Artikel über die Papar gewesen wäre. Trotzdem glaube ich, diese Unterlagen stammen aus Kursen, in die er sich parallel zu seiner Abschlussarbeit eingeschrieben hatte.«
Matthias schaute Gunnar durchdringend an. »Nein, so einfach ist es nicht. Die meisten dieser Aufsätze befanden sich in einem Ordner mit der Aufschrift Malleus — Ihnen ist der Name vermutlich bekannt.« Matthias zeigte auf die Löcher an den Seitenrändern. »Ich glaube, er hat sie im Zusammenhang mit Forschungen auf dem Gebiet der Hexerei gesammelt.«
»Ja, ich kenne den Begriff — könnte er die Aufsätze nicht einfach in einen alten Ordner geheftet haben, ohne die Aufschrift zu ändern?«, fragte Gunnar.
»Gut möglich«, entgegnete Matthias. »Aber mein Gefühl sagt mir, dass es nicht so war.«
Gunnar schaute wieder auf den Papierstapel. »Das ist zugegebenermaßen nicht so einfach. Das Einzige, was mir auf Anhieb auffällt, ist die Verbindung zur Reformation — sie ging der Inquisition auf gewisse Weise voraus, so wie im übrigen Europa auch. Die Religion veränderte sich und viele Menschen wurden durch diese Entwicklung von einer Glaubenskrise erfasst. Was den Ausbruch der Hekla und die Epidemie angeht, könnte Harald die Verbindung zwischen der Inquisition und den wirtschaftlichen Verhältnissen untersucht haben. Naturkatastrophen und Krankheiten hatten zu jener Zeit einen immensen Einfluss. Obwohl andere Vulkanausbrüche, beispielsweise der Heklaausbruch von 1663, und andere Seuchen, die zeitlich näher an den Hexenverbrennungen liegen, sich für eine genauere Untersuchung besser geeignet hätten.« Er tippte leicht auf den Stapel.
»Er hat also nicht mit Ihnen oder mit diesem þórbjörn darüber geredet, als Sie sich wegen der Abschlussarbeit getroffen haben?«, fragte Dóra.
»Nein, mit mir nicht. þórbjörn erwähnte so etwas nach seinem Treffen mit Harald auch nicht«, antwortete Gunnar, fügte dann aber hinzu: »Wie ich schon sagte, befand sich Haralds Abschlussthema noch im Entwicklungsstadium. Seine Interessen schienen in unterschiedliche Richtungen zu gehen. Er gab þórbjörn sogar zu verstehen, dass er sich mehr für den Einfluss der Reformation als für Hexenverbrennungen interessierte. Als er ermordet wurde, hatte er sein Thema aber noch nicht geändert.«
»Ist das üblich?«, fragte Dóra. »Seine Forschungsthemen derart zu ändern?«
Gunnar nickte. »Ja, das ist weit verbreitet. Man fängt voller Eifer an, merkt dann, dass das Thema gar nicht so spannend ist, wie man zunächst gedacht hat, und beginnt nach neuen Themenbereichen zu suchen. Wir haben sogar eine lange Liste mit interessanten Forschungsthemen, die wir unseren Studenten zur Auswahl vorlegen, wenn sie keine eigenen Vorschläge haben.«
»In Anbetracht von Haralds Interesse an Hexerei im Allgemeinen«, sagte Matthias und zeigte auf die sie umgebenden Wände, »ein Interesse, das ihn schon seit jungen Jahren begleitet, finde ich es fragwürdig, dass er auf einmal von der Reformation fasziniert gewesen sein soll.«
»Harald war katholisch, wie Ihnen zweifellos bekannt ist«, erklärte Gunnar. Dóra und Matthias nickten artig. »Ihn faszinierte nicht zuletzt die Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Bevölkerung hier im Land um 1550 nach der Einführung des Luthertums, vor allem bei den Ärmsten. Die katholische Kirche hatte all ihre Besitztümer im Land gehalten, aber mit der Reformation gingen die Ländereien der Kirche an den dänischen König über und das Land verarmte. Zudem hatte die katholische Kirche Almosen an die Ärmsten verteilt. Nach der Aufnahme des Luthertums wurden sie gestrichen. Harald fand das bemerkenswert, da die katholische Kirche selten in einem solchem Licht gesehen wird. Es hat ihn auch geradezu völlig begeistert, dass es katholischen Geistlichen und Bischöfen in Island gestattet war, Gefährtinnen und Kinder zu haben — was in anderen katholischen Bischofssitzen in Europa bis heute nicht geduldet wird.«
Читать дальше