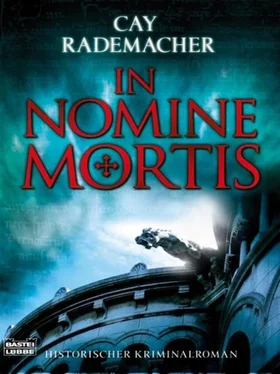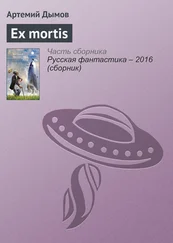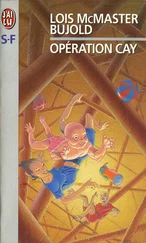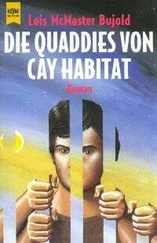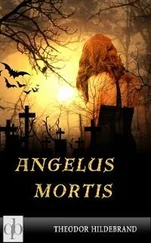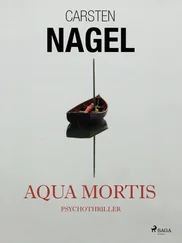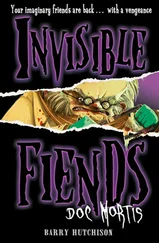Ungerührt strich der Inquisitor mit der Linken durch den Schatz. »Viel französisches Geld, Livres und Sous«, murmelte er. »Doch dazu Nürnberger Taler, Venezianische Dukaten und Soldi aus Florenz sowie ein paar Kölner Pfennige.«
Ich ging neben ihm in die Hocke, beflissen, auch etwas zur Lösung dieses Rätsels beizutragen. Lange besah ich mir das Geld. Irgendetwas kam mir seltsam vor.
»Es handelt sich um unterschiedliche Münzen aus vielen Reichen der Christenheit«, sagte der Inquisitor halblaut. »Man könnte denken, die Börse eines Großkaufmannes vor sich zu haben und nicht die eines Dominikaners. Ich weiß nicht viel über Heinrich von Lübeck - außer, dass er vor einigen Tagen hier ankam, dass er aus dem Norden des Deutschen Reiches stammte und dass er den Doktorgrad des kanonischen Rechtes erlangt hatte. Es scheint, dass er nicht nur ein Mann GOTTES und des Geistes war, sondern, heimlich wiewohl, auch ein Mann des Geldes.«
»Meister Philippe!«, rief ich, da mir endlich aufgefallen war, was mir so ungewöhnlich an dem Fund vorkam. »Seht die Prägestempel der Münzen. Ich möchte meinen, dass alle Münzen alt sind, wenigstens wohl zwanzig oder dreißig Jahre und manche wohl auch hundert. Und keiner Gold- und Silbermünze ist der Rand angeschliffen, kaum eine ist auch nur zerkratzt. Es sieht so aus, als hätten sie sehr lange unberührt gelegen.«
»Ein Schatz«, murmelte Nicolas Garmel andächtig. Er hatte mich gehört, denn ich hatte in meiner Aufregung unwillkürlich die Stimme gehoben.
Meister Philippe warf mir einen tadelnden Blick zu. » Tufidem habes penes temet ipsum habe coram Deo. Du magst Recht haben. Ob es ein Schatz ist, will ich allerdings nicht sagen. Es sieht mir eher aus wie die Rücklage, die ein vorsichtiger und geschickter Kaufmann über Jahre hinweg angesammelt hat. Ich frage mich nur, wie Heinrich von Lübeck an dieses Geld gekommen ist. Und was er damit wohl vorgehabt haben mag.«
»Vielleicht ist er deswegen getötet worden?«, fragte ich, nun wieder mit leiser Stimme.
Meister Philippe strich sich bedächtig über das Haupt. »Möglich wäre es. Jemand hat den Beutel geöffnet - und hat dann vielleicht keine Zeit mehr gehabt, die Münzen zusammenzuraffen. Die Sergeanten haben einen Bürger festgehalten, der etwas gesehen haben mag. Ich denke, dass es jetzt Zeit ist, ihn zu befragen.«
Doch gerade, als wir uns aufrichteten, fiel mein Blick noch einmal zufällig auf die blutverkrustete Hand des Toten. Ich hatte sie mir aus Scheu zunächst nicht genauer angesehen. Doch nun schien es mir, als ob ich neben der im Sterben verkrampften Hand des Toten noch etwas erblicken würde. Etwas auf dem Straßenpflaster. Eine Schrift. »Seht, Meister Philippe!«, rief ich. »Unser Mitbruder hat uns im Sterben noch eine Nachricht hinterlassen. Er hat etwas geschrieben.« Ich sprang neben die Hand des Leichnams, aufgeregt - ja, ich gestehe es beschämt —, freudig wohl, wie es die edlen Jäger zu sein pflegen, wenn sie, den Spieß erhoben, das Wild stellen. Ich glaubte, dass Heinrich von Lübeck den Namen des Frevlers, der ihn niedergestreckt hatte, mit letzter Kraft niedergeschrieben hätte. Caelum et terra transibunt verba autem mea non transient.
Doch meine Worte reichen nicht hin, die Verwunderung zu beschreiben, die mich befiel, als ich die letzten Worte des Toten entziffert hatte. Auf dem Straßenpflaster stand, zittrig, verwischt, blutbesudelt: terra perioeci.
»Land der Periöken«, murmelte Meister Philippe. Sein Gesicht zeigte, zum ersten Mal, seit ich es erblickte (und ich würde es auch nie wieder so sehen) einen Ausdruck grenzenloser Verblüffung, die ihn beinahe zu lähmen schien. Wahrscheinlich, dachte ich mir in diesem Moment ehrfürchtig und schaudernd, war selbst ihm, dem erfahrenen Inquisitor, noch nie ein so großes Rätsel gestellt worden. »Was bedeutet das?«, fragte ich leise und meinte dies in mehr als einem Sinne. Was war dieses geheimnisvolle Land der Periöken? Warum hatte Heinrich von Lübeck in seinen letzten Augenblicken ausgerechnet diese Worte niedergeschrieben? Und wie sollte uns dies zu seinem Mörder führen?
Meine Frage schien Meister Philippe aus seiner verwunderten Starre zu lösen. Er strich sich wieder über das Haupt und, ja, er lächelte. Ein Lächeln, ich ahnte es, vor dem schon unzählige Ketzer gezittert haben mussten. »Ein großes Rätsel, fürwahr«, murmelte er und schien eher erfreut zu sein, denn verzagt. »Doch ist es nicht das höchste Glück eines Inquisitors, Rätsel zu lösen?«
Es war, als sei eine neue Kraft in ihn gedrungen, als er sich aufrichtete. »Komm nun, mein junger Bruder«, rief er. »Es wird Zeit, dass wir endlich unseren Zeugen befragen!«
Wir traten zu den beiden Sergeanten, die sich mit dem Zeugen respektvoll ein paar Schritte weit zurückgezogen hatten. Der dünnere der beiden grinste, als er uns erblickte, dann warf er die Kapuze des Umhangs zurück, welche bis dahin das Gesicht des Gefesselten verhüllt hatte. Erschrocken blieb ich stehen. Es war eine Frau.
»Sie heißt Jacquette«, sagte der feixende Sergeant, »doch jedermann kennt sie hier als ›La Pigeonettes das Täubchen.« Die Frau wagte nicht, uns anzublicken. Sie war jung, fast noch ein Mädchen - sechzehn Jahre alt, schätzte ich, obwohl ich in diesen Dingen wahrhaft keine Erfahrung hatte. Ihr braunes Haar war lang und verfilzt - und doch schien mir, dass es schimmerte wie polierte Bronze. Ihre Nase war klein, ihre Augen standen eng beieinander, ihre Wangen waren beschmutzt vom Straßendreck und von Tränen, die auf der Haut getrocknet waren - und doch hatte ich nie ein Bildnis der Maria gesehen, dessen Züge mir lieblicher schienen. Unter dem groben Umhang trug sie ein dunkelrotes, verwaschenes Wollgewand, ihre Füße waren nackt - und doch wäre mir keine Königin prächtiger gewandet vorgekommen als sie. Verwirrt war ich und wusste nicht, wohin ich meinen Blick wenden sollte.
»Wir haben sie da drüben aufgelesen«, sagte der Sergeant und deutete auf eine düstere, kaum schulterbreite Gasse, die sich zwischen zwei verwahrlosten Fachwerkhäusern fast genau gegenüber des kleinen Portals von Notre-Dame öffnete, vor dem unser verstorbener Mitbruder lag.
»Sie muss dort einige Stunden gelegen haben«, fuhr der Sergeant fort. »La Pigeonette behauptet, dass sie jemand niedergeschlagen habe. Doch vielleicht war sie auch nur betrunken. Wir haben sie jedenfalls festgehalten und«, er zögerte kurz, dann grinste er verschlagen und deutete uns Mönchen gegenüber eine Verbeugung an, »verzeiht, Ihr Brüder, wir haben sie ein wenig rangenommen. Nur ein paar Ohrfeigen, mehr nicht, ich schwöre es beim heiligen Laurentius. Dann hat sie gestanden, dass sie den Mord gesehen hat.«
»Sprich, meine Tochter«, sagte Meister Philippe. Seine Stimme klang nüchtern, mit einer Spur von Mitgefühl. Ich bewunderte ihn, denn ich hätte in diesem Augenblick nichts herausgebracht. Doch Jacquette starrte nur auf den Boden und schwieg. »Ich weiß sehr wohl, dass du eine Schönfrau bist«, fuhr der Inquisitor fort. Er klang noch immer freundlich. »Und du weißt, dass schon der heilige König Ludwig den Dirnen verboten hat, außerhalb der ihnen zugewiesenen Häuser ihrem sündigen Gewerbe nachzugehen. Was hast du hier getan, nachts, in dieser dunklen Gasse?« Das Mädchen blieb noch immer stumm, doch ich sah, wie ein Zittern durch ihren Körper ging, als hätte sich das Straßenpflaster in Eis verwandelt.
»Du hast getan, was Schönfrauen eben tun, doch außerhalb der euch vom Gesetz zugewiesenen Häuser. Das allein ist ein Verbrechen, für das ich dich nach Orleans schicken könnte«, sagte Meister Philippe jetzt streng.
Da brach Jacquette zusammen: Sie warf sich auf den Boden, riss ihre gefesselten Hände so weit hoch, dass sie die Kutte des Inquisitors zu fassen bekam, krallte sich fest und küsste den Stoff. »Gnade, oh Herr, Gnade«, flehte sie.
Читать дальше