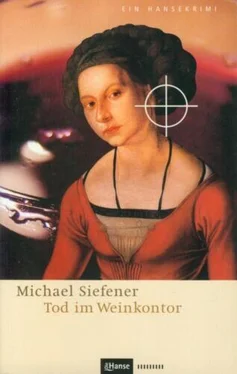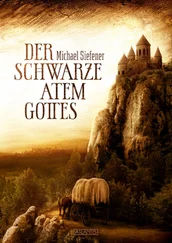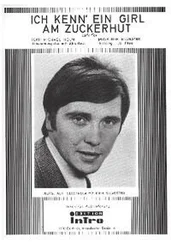Als Elisabeth die freien Felder und Wiesen sah, erinnerte sie sich an den Ausflug nach Melaten. Als sie am Morgen nach Hause zurückgekommen war, hatte ihr Mann sie zwar streng angeschaut, aber nichts über ihre nächtliche Abwesenheit gesagt. Er hatte ihr einfach mitgeteilt, dass er noch heute nach London aufbrechen werde, da gestern Abend sein jüngst eingekaufter Wein im Hafen eingetroffen sei. Elisabeth hatte sofort gefragt, ob sie mitkommen dürfe, und Heinrich war sehr erstaunt über ihre Bitte gewesen, denn sie hatte ihn noch nie auf einer Reise begleitet, aber schließlich hatte er zugestimmt. Sie war voller Zuversicht. In London musste sie etwas erfahren. Der alte Heynrici hatte gesagt, Ludwig habe dort Schreckliches gehört. Elisabeth wollte jede Gelegenheit wahrnehmen. Sie hatte zwar keine Zeit mehr gehabt, Andreas von ihrer Abreise in Kenntnis zu setzen, aber die Mägde und Diener würden ihm schon von ihrer Englandfahrt erzählen.
Hoffentlich hatte sie richtig gehandelt. Nun war sie auf ihren Gatten angewiesen. Sie war ihm ausgeliefert. Und das für die ungewisse Aussicht auf einige Informationen in einem fremden Land, unter fremden Menschen.
Als sie an Melaten vorbeifuhren, durchlief Elisabeth ein Schauer. Sie erinnerte sich gern an den alten, heiligen Mann, aber der Schrei in der Nacht, der sie geweckt hatte, war schrecklich gewesen.
Und am anderen Morgen hatte sie gehört, dass einer der Siechen in der Nacht gestorben war.
Andreas kehrte aufgeregt nach Sankt Kolumba zurück. Er eilte in das Pfarrhaus, hastete die Treppe so schnell hinauf, dass die alte Grete nur den Kopf schüttelte, und polterte in Johannes Hülshouts Studierstube, ohne anzuklopfen. »Ich muss sofort…« Er verstummte.
Der Pastor saß an seinem Tisch; vor ihm stand ein Mann mit wallenden Haaren und spitzer Nase und redete mit hoher Stimme auf den Geistlichen ein. Als dieser den Eindringling bemerkte, gebot er dem Mann mit einer barschen Handbewegung zu schweigen und fuhr Andreas an: »Siehst du nicht, dass ich mitten in einem wichtigen Gespräch bin? Warte bitte draußen.«
»Aber… aber ich muss sofort abreisen.«
Hülshout zog die Augenbrauen zusammen. »Abreisen? Wohin?«
»Nach London.«
»Warum?«
»Weil… weil Elisabeth… die Bonenbergerin mit ihrem Mann dorthin…«, stammelte Andreas.
»Es stünde dir gut an, wenn du dich weniger um Weiberröcke und Tote und dafür mehr um unsere Pfarrkinder kümmern würdest«, gab Hülshout kalt zurück.
»Aber… aber ich muss sie doch begleiten.«
»Ach ja? Glaubst du, sie kann nicht auf sich selbst aufpassen? Ich kenne die Bonenbergerin mindestens so gut wie du, mein Sohn. Sie braucht keinen Wachhund. Ist sie immer noch hinter dem angeblichen Mörder ihres Bruders her?«
Andreas nickte.
»Dann lass sie in Ruhe. Du wirst hier gebraucht, denn ich muss mit dem ehrwürdigen Meister des Maleramtes in seine Werkstatt gehen. Unser Hochaltar ist beinahe fertig. Der Meister will noch letzte Pinselstriche an meinem Bildnis ausführen, das er darauf verewigen will.« Er stand auf und lächelte dem Mann mit der spitzen Nase dankbar zu. »Weißt du, ich werde beim Tempelgang Mariens vor den Stufen knien. Und der Evangelist Johannes wird den Rock eines Universitätslehrers tragen, genau wie ich. Und er wird vor seinen Schülern sitzen, wie ich es tue. Unser Meister ist wirklich ein Genie.«
Der Gelobte verneigte sich leicht, und die geckenhafte Feder an seinem Hut tanzte dabei hektisch auf und nieder.
»Ich werde vor morgen früh nicht zurück sein. Du musst also alle Messen lesen. Vikar Peters von Sankt Laurentius wird dich ausnahmsweise unterstützen, doch auf deine Anwesenheit kann Sankt Kolumba nicht verzichten. Gefährde nicht dein Seelenheil und das deiner Anbefohlenen.« Mit diesen Worten verließ Hülshout mit dem Meister das Zimmer und ließ Andreas allein zurück.
Enttäuscht ging Andreas in die Kirche und betete vor dem Marienaltar. Warum hatte Elisabeth ihm nichts von ihrer Abreise gesagt? Vertraute sie ihm nicht? Warum hatte er es durch die Magd erfahren müssen? Er fühlte sich verletzt. Doch noch mehr verwirrte ihn die Existenz dieses Gefühls. Er gestand sich ein, dass er sich in Elisabeths Gegenwart sehr wohl fühlte.
Zu wohl für einen Geistlichen.
Und nun bangte er um sie. Die Reise nach London war nicht ungefährlich. Er betete ein Ave Maria für sie.
Die vier schwer mit Weinfässern beladenen Wagen kamen auf den holperigen Straßen langsamer voran, als Heinrich Bonenberg geplant hatte. Immer wieder trieb er seine Kutscher zur Eile an, denn wenn er das Rinck’sche Schiff in Antwerpen verpasste, käme das einer Katastrophe gleich. Er hatte den Stauraum bereits bezahlt und wusste nicht, wann sich die nächste Möglichkeit für eine Überfahrt bieten würde. Kölnische Kaufleute waren in den großen Kontorstädten wie Brügge und Antwerpen nicht mehr gern gesehen, seit Köln wegen seines Englandhandels vor vier Jahren aus der Hanse ausgeschlossen worden war. Nur der mächtige Kölner Kaufmann und Ratsherr Rinck war durch seine hervorragenden Kontakte noch in der Lage, von Antwerpen aus London anzusteuern.
Elisabeth saß auf dem Wagen, der hinter jenem ihres Gemahls fuhr. Sie sah, wie Heinrich sich immer wieder umdrehte, ungeduldige Gesten machte und bisweilen selbst die Peitsche schwang. Sie hoffte genau wie er, dass die Kolonne das Schiff noch rechtzeitig erreichte, doch sie hatte andere Gründe. Ihr war nur wichtig, nach London zu kommen und dort Licht in das Dunkel um den Tod ihres Bruders zu bringen.
Die Kolonne fuhr noch, als die Dunkelheit sich schon über das weite Land zwischen Köln und Aachen gelegt hatte. Fackeln steckten in seitlichen Halterungen an den Wagen, doch die zuckenden Flammenzungen vermochten die Finsternis kaum zu durchdringen. Das mahlende Rumpeln der Räder, das gleichmäßige Hufgetrappel und das gelegentliche Schnauben der erschöpften Pferde wirkten einschläfernd auf Elisabeth. Immer wieder sank ihr der Kopf auf die Brust. Sie hoffte, dass sie bald zu einer Herberge kämen, wo die erschöpften Menschen und Tiere wenigstens eine kurze Ruhepause einlegen konnten. Doch Heinrich war wie besessen. Elisabeth sah, wie sein dunkler Umriss auf dem vorderen Wagen unruhig hin und her schwankte. Immer wieder knallte dort vorn die Peitsche.
Etwa auf halber Strecke zwischen Aachen und Köln erbarmte sich Heinrich schließlich und ließ die Kolonne bei einem kleinen, windschiefen Gasthaus an der zerfurchten Straße anhalten. Nur Elisabeth und einem der Kutscher wurde erlaubt, das Innere zu betreten und sich dort auf der harten Ofenbank ein Lager für die Nacht zu suchen. Heinrich selbst und die anderen Kutscher und Knechte mussten bei der wertvollen Wagenladung bleiben. Ihnen wurde ein wenig Suppe und Bier hinausgereicht, und es wurden Wachen eingeteilt, damit sich niemand an dem Wein zu schaffen machen konnte.
Elisabeth war es recht so. Wenigstens brauchte sie nun nicht die Gegenwart ihres Gemahls zu ertragen. Sie nahm sich eine der harten Decken, die ihnen der mürrische Wirt gereicht hatte, und wickelte sich darin ein. So vieles ging ihr durch den Kopf, dass sie trotz ihrer Müdigkeit nicht einschlafen konnte. Sie lauschte den gleichmäßigen Atemzügen der wenigen Reisenden, die so weit wie möglich voneinander entfernt in der Schankstube lagen, und überlegte, wie sie nach ihrer Ankunft in London vorgehen sollte. Heynrici hatte gesagt, ihr Bruder habe vermutlich im Stalhof etwas Schlimmes entdeckt. Also lag es nahe, dort mit den Nachforschungen zu beginnen.
Unruhig wälzte sie sich auf der harten Holzbank hin und her. Was war, wenn sie in ein Wespennest stach? Wenn sie sich zufällig an jene Männer wandte, die Ludwigs Feinde gewesen waren? Wenn sie seinen Mördern gegenüberstand, ohne es zu wissen? Nein, der Stalhof war für sie zu gefährlich. Zunächst durfte dort niemand den wahren Grund ihrer Anwesenheit erfahren. Sie brauchte unbedingt einen Vertrauten. Aber sie kannte niemanden in London. Sie sprach nicht einmal Englisch. War diese ganze Reise bloß eine unüberlegte Narretei? Doch ihr blieb nichts anderes übrig. Sie hatte ihren Bruder so sehr geliebt, dass sie alles tun würde, um seinen Mörder zu finden.
Читать дальше