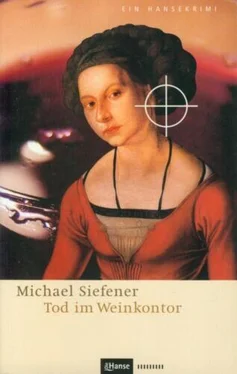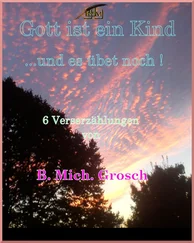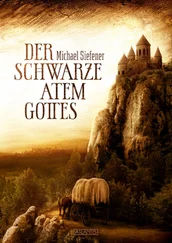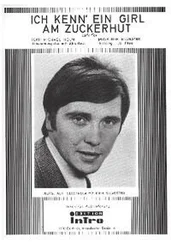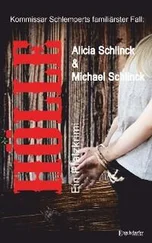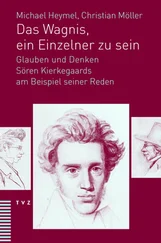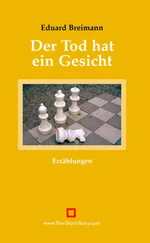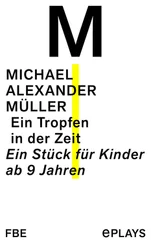Was mochte einen reichen Patrizier dazu bringen, täglich sein Leben im Kampf gegen die Krankheit aufs Spiel zu setzen und allem Wohlstand zu entsagen?
Nach einer Stunde stummen Reitens hatten sie die hohe Bruchsteinmauer erreicht, die das Leprosenhaus, die Nebengebäude, die Kirche und die Gärten von der Straße und der Welt abschirmte. Am Tor saßen sie ab. Wehmütig schaute Andreas dem weiteren Verlauf der Straße nach. Irgendwo dort hinten, in weiter Ferne, musste die alte Kaiserstadt Aachen liegen und dahinter Paris, Poitiers, Santiago de Compostela. Viel lieber wäre er bis ans Ende der Welt geritten, als diesen Ort des Schreckens und des Todes zu betreten. Er sah Elisabeth an, die ihm aufmunternd zulächelte.
Am Tor meldeten sie sich und fragten nach Ulrich Heynrici. Es wurde ihnen sofort aufgeschlossen. Im Innenhof durften sie ihre Reittiere anbinden; dann ging der Pförtner mit ihnen an der Kirche und dem Wirtshaus vorbei, dessen Eingang an der Straße nach Aachen lag und das den Reisenden vorbehalten war. Die Siechen durften es bei der Androhung des Verlustes ihrer Pfründe nicht betreten. Eine dieser armen Kreaturen kam trotzdem über den Hof gehumpelt, hielt das, was einmal ihre Hände gewesen waren, vor und bettelte um Geld. Der Pförtner scheuchte die zerlumpte Gestalt fort und bekreuzigte sich. Der Aussätzige taumelte zurück zu den kleinen Unterkünften, die im rechten Winkel zur Kirche standen. Andreas schüttelte sich, doch Elisabeth hatte Bedauern in den Augen. Der Pförtner sah es, zuckte die Schultern und sagte: »Niemand kann diesen armen Geschöpfen helfen; es gibt kein Heilmittel gegen den Aussatz. Man kann sie nur von den Gesunden absondern. Sie dürfen nichts berühren, was auch Gesunde berühren könnten. Wenn sie ein Geländer anfassen, müssen sie Handschuhe tragen. Wenn sie mit einem Gesunden sprechen, müssen sie aus dem Wind gehen, weil man nicht weiß, ob der Wind möglicherweise die Krankheit überträgt. Und natürlich dürfen sie nicht in fließendem Wasser baden oder sich waschen. Dennoch werden ihrer immer mehr. Keiner wagt sich nahe an sie heran, auch der Arzt nicht. Ich geb zu, auch ich hab Angst vor ihnen. Hab schließlich Frau und Kinder. Nur einer hilft ihnen, unser Küster.«
Er klopfte an die Tür des kleinen Häuschens hinter der Kirche, das wie das Wirtshaus an die Mauer gebaut war. »Unser frommer Herr Ulrich bekommt viel Besuch aus der Stadt«, sagte der Pförtner und zwinkerte stolz. »Er ist wirklich ein Heiliger. Hat man so etwas schon einmal gesehen? Vermacht sein ganzes Geld dem Siechenhaus und legt selbst noch Hand an. Er ist besser als all die gelehrten Pfaffen zusammen.« Er warf Andreas einen scheelen Blick zu, drehte sich um und ging.
Die Tür wurde geöffnet, und im Rahmen stand eine Gestalt, bei deren Anblick Andreas nur die Bezeichnung »alttestamentarisch« einfiel. Der Mann war etwa siebzig Jahre alt, sehr groß, stämmig, ohne dick zu sein, und hatte einen schlohweißen Haarkranz, der sein kahles Haupt wie ein Heiligenschein umgab, sowie einen langen, ebenso weißen Bart. Seine Augen waren sehr dunkel, entweder braun oder schwarz. Er sah die junge Frau und den Geistlichen fragend an und lächelte warmherzig.
Es war Elisabeth, die den Grund ihres Besuches erklärte. Nun wurde auch der Blick des beeindruckenden Mannes heller. »Ich habe von dieser schrecklichen Sache gehört«, sagte er mit einer volltönenden Bassstimme. »Kommt doch bitte herein. Entschuldigt, dass es nicht sehr herrschaftlich ist, doch wie Ihr bestimmt schon erfahren habt, hänge ich nicht mehr an weltlichen Gütern.« Er geleitete die beiden in eine enge Stube, die mit Büchern gefüllt war. Andreas glaubte sich in die Universität versetzt. Noch nie hatte er so viele Bücher in einem privaten Haushalt gesehen. Heynrici musste seinen erstaunten Blick bemerkt haben und erklärte: »Ein wenig von meinen Schätzen habe ich mitgebracht. Aber es sind geistige Güter.
Ich ziehe meinen Frieden und mein Heil aus ihnen – und aus Gott.« Er bot Elisabeth einen bequemen Stuhl mit zwei dicken Polsterkissen an und rückte Andreas einen Dreifuß zurecht. Er selbst setzte sich im Schneidersitz auf den blank gescheuerten Holzfußboden.
Die Kammer war nicht groß. Schatten klebten überall. Das einzige Fenster steckte neben der Tür und maß kaum eine Elle im Quadrat. Eine Stiege im hinteren Teil führte in den ersten Stock, wahrscheinlich zum Schlafraum des seltsamen Küsters.
Heynrici sagte: »Verzeiht, dass ich Euch weder Wein noch Bier anbieten kann. Ich trinke keinen Alkohol und habe daher auch keinen im Hause. Wollt Ihr einen Becher Wasser haben?«
Andreas und Elisabeth lehnten ab. Sie sahen sich erstaunt um und wähnten sich in einer anderen Welt. Der Kaplan sagte schließlich: »Ihr habt den Ruf eines Heiligen, Heynrici. Darf ich fragen, wieso Ihr Euch hierher zurückgezogen habt?«
»Seid Ihr hergekommen, um mich das zu fragen?«, meinte er. Seine dunklen Augen glitzerten belustigt. »Ich will Euch aber gern antworten. Nachdem ich meinen Sitz im Rat der Stadt aufgegeben hatte, starb meine liebe Frau, und ich hatte keine Freude mehr am Leben. Ich wollte etwas tun, das den Ärmsten der Armen zugute kommt. Daher habe ich all mein Geld Melaten vermacht und bin hergezogen, um mich um die Aussätzigen zu kümmern, vor denen jedermann eine so große Furcht hat. Ich versehe Küsterdienste, mache Besorgungen für die Kranken und helfe bei der Lepraschau, wenn sich die Ärzte nicht bereit erklären, die Aussätzigen anzufassen.«
»Ihr setzt dabei Euer Leben aufs Spiel«, bemerkte Elisabeth beeindruckt. Andreas sah, wie sie an den Lippen des alten Mannes hing. Nichts anderes schien für sie mehr zu existieren. Er hatte sie ganz in seinen Bann gezogen.
»Ja, aber ich bin schon alt und habe mein Leben gelebt. Was soll mir denn noch passieren?«, sagte Heynrici langsam. »Endlich kann ich einmal etwas tun, was den Menschen unmittelbar zugute kommt.«
Andreas gefiel nicht, wie Elisabeth den alten Mann ansah. Er räusperte sich und fragte: »Was habt Ihr über den Tod Ludwig Leyendeckers gehört?«
Heynrici richtete den Blick auf ihn. Er zog die weißen, buschigen Brauen zusammen. »Eine furchtbare Sache. Stimmt es, dass er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben soll?«
»Es geht das Gerücht um, aber wir glauben es nicht«, sagte Andreas und stützte die Hände auf die Knie.
»Es ist gut, dass Ihr es nicht glaubt«, pflichtete Heynrici ihm bei. »Dass Ludwig Leyendecker ein Bündnis mit dem Widersacher Christi eingegangen sein soll, ist lächerlich. Das hatte er gar nicht nötig. Er war ein gewitzter Kaufmann. Immer, wenn es günstige Ernten an Mosel, Rhein oder Nahe gab, war er zur Stelle. Er kannte den Wein besser als jeder andere. Manchmal glaube ich, er brauchte nur die Fässer anzuschauen, um zu wissen, wie viel Fruchtzucker der Wein hat und von welchen Lagen er kam. Warum sollte so jemand, der überdies noch ausgezeichnete Kontakte vor allem nach London hatte, den Teufel zu Hilfe rufen?«
»Ganz meine Meinung«, stimmte Elisabeth eifrig zu. »Es muss um etwas völlig anderes gegangen sein.« Sie berichtete ihm alles, was Andreas und sie bisher herausgefunden hatten. Heynrici hörte schweigend zu, nickte manchmal, sagte aber nichts. Schließlich sagte Elisabeth: »Aus diesen Gründen glauben wir an einen Mord. Könnte er etwas mit der Verhansung Kölns zu tun haben?«
»Mit dem Hinauswurf Kölns aus dem hansischen Bund?« Heynrici fuhr sich mit der langgliedrigen Hand durch den Bart. »Schwer zu sagen.«
»Wir haben gehört, dass er Feinde im Rat hatte«, warf Andreas ein.
Heynrici erhob sich so mühelos aus dem Schneidersitz, als würde er von einem hohen Stuhl aufstehen, und ging in dem kleinen Zimmer auf und ab. »Jedermann im Rat hat Feinde, das ist ganz natürlich. Es stimmt, dass Leyendecker damals entschlossen für den Englandhandel gestimmt hat – genau wie ich übrigens. Wir waren der Meinung, dass wir diese alte Tradition nicht der Hanse opfern dürfen. Natürlich gab es auch Gegenstimmen. Sie kamen vor allem von jenen Kaufleuten, denen die Verhansung schwere Schäden zugefügt hätte, was dann ja auch geschehen ist.«
Читать дальше