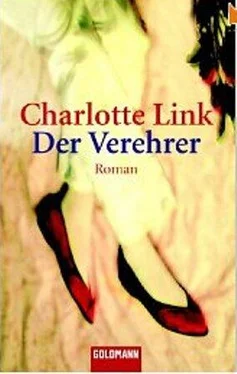Ich sitze in Lydias gepflegtem Wohnzimmer am Eßtisch und schreibe. Das Frühstücksgeschirr habe ich zur Seite geschoben, aber ab und zu tunke ich einen Löffel in die Aprikosenmarmelade und lecke ihn dann genießerisch ab.
Ich hatte ja keine Ahnung, wie sehr ich die Zivilisation vermißt habe! Es ist ein herrliches Gefühl, frisch gebadet zu sein, sich sauber zu fühlen am ganzen Körper. Ziemlich dilettantisch, aber eigentlich gar nicht so schlecht, habe ich mir die Haare geschnitten, sie natürlich auch gewaschen und dann gefönt, und nun glänzen sie wie dunkelbraune Seide. Ich habe mich rasiert und sehe wie ein neuer Mensch aus. Allmählich nähere ich mich dem Zustand, in dem ich es wagen kann, vor Leona hinzutreten, ohne dabei zu riskieren, daß sie umfällt vor Schreck. Ich fürchte allerdings, erschrecken wird sie so oder so, aber wenigstens nicht wegen meines Aussehens. Das würde mich in meiner Eitelkeit doch schwer kränken.
Meine Kleider trocknen in der Sonne auf dem Balkon. So warm, wie es heute ist, kann ich sie bestimmt abends schon wieder anziehen. Zweimal bin ich bereits hinausgegangen, habe meine Nase in den Stoff gedrückt und den herrlichen Geruch des Waschpulvers geatmet. Im Augenblick könnte ich in schönen Dingen förmlich ertrinken, endlich befreit von dem Pennergestank, der mich tagelang umgab. Ich habe sogar Lydias Deostift benutzt, trotz der femininen Duftnote. Morgen werde ich mir einen eigenen kaufen. Und ein schönes Aftershave und frische Wäsche. Und was mir noch so einfällt. Ich habe Lydias Handtasche umgestülpt. Immerhin fast fünfhundert Mark hat sie im Geldbeutel und — was noch besser ist — ihre Scheckkarte. Die Geheimnummer wird sie mir verraten, da bin ich sicher, wenn ich ihr sage, daß ich sonst wiederkomme und was ich dann mit ihr mache.
Ich habe sie mit den Wäscheleinen, die über der Badewanne gespannt waren, gefesselt; so gründlich, daß sie sich garantiert nicht wird befreien können. Ich habe ihr Heftpflaster kreuz und quer über den Mund geklebt und mit einem Mullverband, der sich mehrfach um den Kopf herumwindet, verstärkt. Sie liegt auf dem Sofa und schwitzt vor Angst. Ihre Augen quellen hervor, und sie stößt eigenartige Kehlkopflaute aus. Irgend etwas will sie mir wahrscheinlich sagen, aber, ehrlich gesagt, das interessiert mich im Augenblick überhaupt nicht. Das Gegurgele nervt mich nur etwas. Wenn sie nicht bald damit aufhört, schaffe ich sie ins Schlafzimmer und lasse sie dort allein.
Als ich vorhin nach dem Baden wieder ins Wohnzimmer kam, mit nichts bekleidet als einem Handtuch um die Hüften, da bekam sie ein hysterisches Flackern in den Augen und wurde kalkweiß. Ob sie schon jemals einen halbnackten Mann gesehen hat? Ich nehme an, sie fürchtete, ich wolle sie vergewaltigen. Eher würde ich kotzen! Ich habe selten eine so unattraktive Frau gesehen wie Lydia, das fand ich schon früher, wenn ich Eva besuchte und wir mindestens einen Abend mit ihrer gräßlichen Freundin verbringen mußten. Entweder gingen wir zu ihr, oder sie kam zu uns, und dann saß sie da und himmelte mich die ganze Zeit über an. Ich vermute, sie hatte mich ernsthaft in ihre Liste möglicher Ehekandidaten aufgenommen. Laut Eva tat sie das allerdings mit jedem Mann. Die Hoffnung, jemanden zu finden, der sie heiratet, hat sie nie aufgegeben.
Ich muß so stark an Eva denken, hier in dem Haus, in dem sie gelebt, in der Wohnung, in der sie sich so oft aufgehalten hat. Es ist, als wäre hier noch etwas von ihr, etwas von ihrer Seele, ihrem Geist. Ich kann sie ohnehin nie als das sehen, was sie jetzt ist — Gebein, das in einem Sarg in der Erde liegt. Ich sehe sie nicht einmal so, wie sie in den letzten Jahren war, so depressiv und verstört, immer im Schlepptau dieser scheußlichen Frau, deren erstickender Zuwendung sie sich nicht entziehen konnte, weil ihr die Kraft dazu fehlte.
Ich sehe sie, wie sie früher war, als wir zusammen auf dem Dachboden unseres schäbigen Reihenhauses saßen und uns Ronco ausdachten.
Ein ehemaliger Schulfreund hatte mir eine Karte aus Ascona geschickt, wo er Ferien gemacht hatte, und das Bild der schneebedeckten Berge und des leuchtendblauen Sees davor ließ mich nicht mehr los.
«Da möchte ich einmal leben«, sagte ich, als ich Eva die Karte zeigte. Sie war siebzehn und hungrig nach Leben; Berge und Seen vermochten sie kaum zu reizen.
«Da?«fragte sie gedehnt.»Was willst du denn da? Ich würde viel lieber in New York leben!«
Mich stimmte das traurig, wie alles, was auf unsere charakterliche Unterschiedlichkeit hindeutete. Ich kaufte mir einen Reiseführer über das Tessin und las so oft darin, daß ich mich schließlich dort unten wirklich auszukeimen meinte. Zum Abitur hatte ich von Vater einen größeren Geldbetrag bekommen, und davon lud ich Eva zu einer Reise nach Ascona ein. Anfangs hatte sie keine rechte Lust, und auch Vater sah den Plan offensichtlich nicht gern.
«Hast du nicht eine Freundin, die du mitnehmen kannst?«fragte er mich.
Er wußte, daß ich keine hatte, aber vielleicht meinte er, ich würde ein Mädchen wie ein Kaninchen aus dem Hut zaubern, wenn er nur danach fragte. Den Gefallen konnte ich ihm leider nicht tun.
«Eva hat sich die Reise so gewünscht«, log ich.
Vater machte ein sorgenvolles Gesicht, aber das machte er eigentlich immer seit Mamas Tod. Das Herumstreunen in fremden Betten hat er übrigens von einem Tag zum anderen aufgegeben. Was seiner Linie nicht bekam; er hatte etliche Kilo zugelegt und einiges an Attraktivität verloren.
«Du verbringst ziemlich viel Zeit mit deiner Schwester«, sagte er vorsichtig.»Du hast gar keine Freunde, triffst dich nie mit anderen Leuten. Das ist ungewöhnlich, mein Junge. Du… blockierst auch Eva dadurch, möglicherweise.«
Was er gesagt hatte, traf mich tief, aber ich wußte den Schlag abzufangen.
«Du hast offenbar nicht mitbekommen, wie sehr Mamas Tod Eva traumatisiert hat«, entgegnete ich sehr ernst.»Sie klammert sich an mich, und ich denke, es ist meine Pflicht, mich um sie zu kümmern.«
Dieser Satz brachte Vater in dieser Angelegenheit für immer zum Schweigen. In Wahrheit war er nämlich traumatisiert durch Mamas Tod. Man hatte ihn von jeder Verantwortung freigesprochen, aber ich wußte, daß er sich selbst nicht freizusprechen vermochte. Er hätte das Messer rechtzeitig sehen müssen. Er hätte es Mama entreißen müssen, ehe sie Unheil damit anrichten konnte. Er hätte dem Notarzt nicht die falsche Adresse sagen dürfen. Er hätte das Blut stoppen müssen, anstatt sich in eine sinnlose Mund-zu-Mund-Beatmung zu flüchten.
Er sagte das nie, aber ich wußte, daß diese Gedanken in seinem Kopf herumspukten. Er wollte um Gottes willen nicht über Mama sprechen, und so kommentierte er meine Fürsorge gegenüber Eva nie wieder.
Auf jener Reise wurde Ronco geboren, das paradiesische Ronco, das von da an in meiner und Evas Phantasie einen festen Platz hatte.
Wir entdeckten das Haus auf einem Spaziergang, der uns auf einem Wanderweg hoch über dem See bis eben nach Ronco führte. Es war Anfang Oktober und noch sehr warm. Wir waren lange gelaufen und schon ziemlich erschöpft. Eva wirkte abgekämpft, und ich hatte das Gefühl, sie irgendwie aufmuntern zu müssen. Die ganze Reise machte ihr nicht sonderlich viel Spaß, das hatte ich längst gemerkt. Sie mochte das Zimmer in der schäbigen Pension nicht, das ich für uns gemietet hatte, und sie langweilte sich, weil ich sie daran hinderte, abends herumzuziehen, sich zu amüsieren und interessante Leute kennenzulernen. An manchen Tagen verhielt sie sich deshalb bockig wie ein kleines Kind. Dieser Tag war so ein Tag.
«Blöde Wanderung«, murrte sie, während wir die heiße, staubige Straße entlangtrotteten, die uns nach Ronco führen sollte.»Mir tun schon die Füße weh, und ich habe Hunger!«
«Dir kann es nichts schaden, mal ein bißchen hungrig zu sein«, meinte ich boshaft,»du hast ziemlich zugelegt in der letzten Zeit.«
Читать дальше